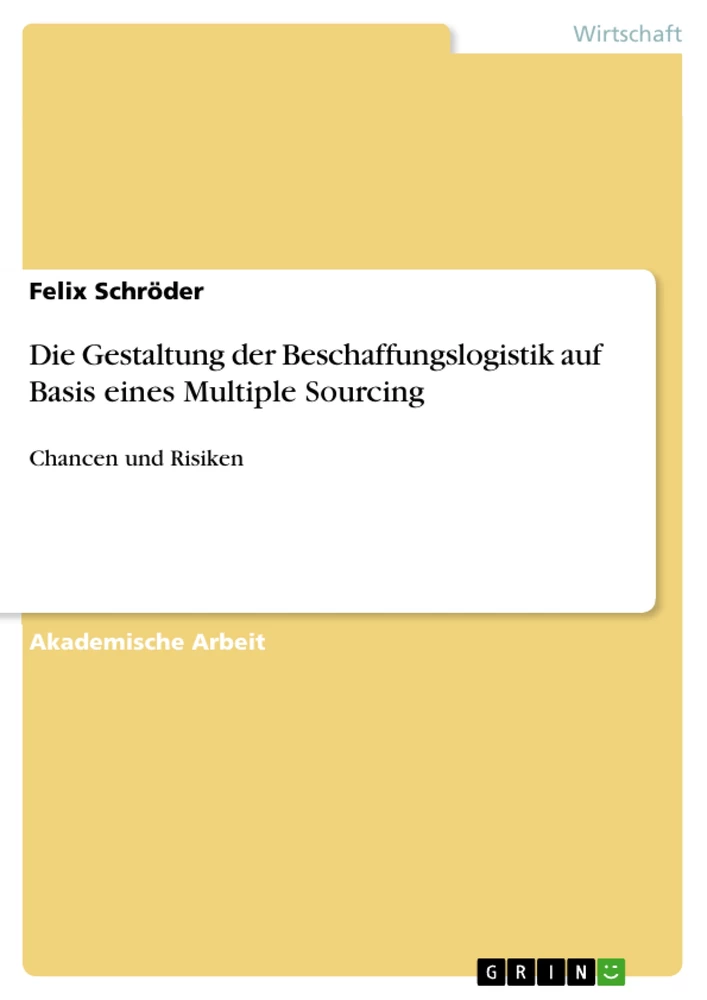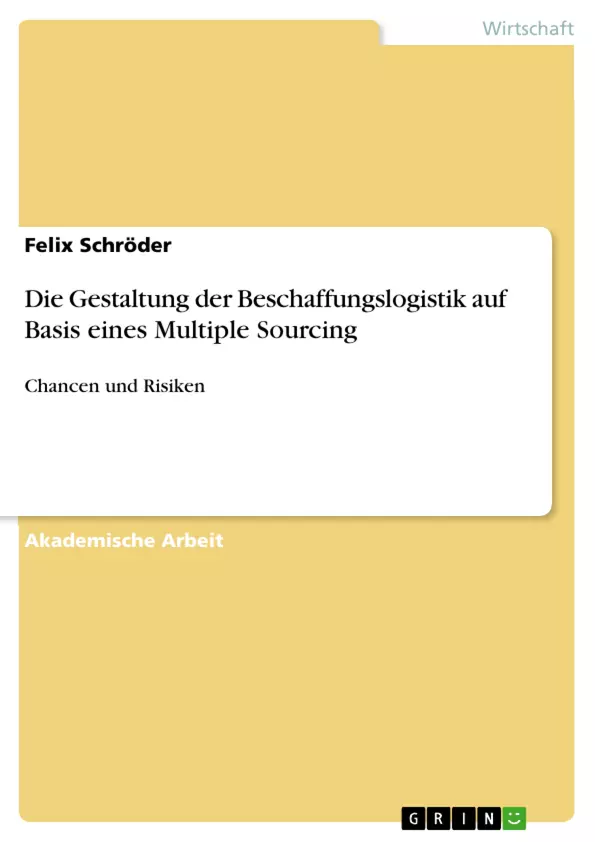Mit der vorliegenden Arbeit soll die Frage, mit welchen Chancen und Risiken die Gestaltung der Beschaffungslogistik auf Basis eines Multiple Sourcing verbunden ist, diskutiert werden. Es erfolgen zunächst definitorische Abgrenzungen. Darin enthalten sind Einordnungen und Erklärungen von Fachbegriffen, um verständlich zu machen, was sich hinter den Wörtern „Beschaffungslogistik“, „Sourcing-Konzept“, und dem dessen untergeordneten Multiple Sourcing verbirgt. Daraufhin werden die Chancen und Risiken einer Beschaffungsstrategie, die das Multiple Sourcing enthält, erläutert. Dies erfolgt häufig mit einem Vergleich des dem gegenüberstehenden Konzeptes, dem Single Sourcing. Differenziert wird in diesem Teil zwischen beschaffenden und beliefernden Unternehmen, da für Auftraggeber und Auftragnehmer unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen sind. Anschließend erfolgt die Schlussbetrachtung, in der die im Hauptteil genannten Argumente zusammengefasst werden und ein subjektives Fazit sowie einen Lösungsansatz zu der oben genannten Fragestellung bilden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definitorische Abgrenzungen
- 2.1. Die Beschaffungslogistik
- 2.1.1. Einordnung
- 2.1.2. Aufgaben
- 2.2. Sourcing-Konzepte
- 2.2.1. Darstellung verschiedener Sourcing-Konzepte
- 2.2.2. Das Multiple Sourcing
- 2.1. Die Beschaffungslogistik
- 3. Die Beschaffungslogistik auf Basis eines Multiple Sourcing
- 3.1. Aus Sicht eines beschaffenden Unternehmens
- 3.1.1. Chancen
- 3.1.2. Risiken
- 3.2. Aus Sicht eines beliefernden Unternehmens
- 3.2.1. Chancen
- 3.2.2. Risiken
- 3.1. Aus Sicht eines beschaffenden Unternehmens
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Chancen und Risiken der Gestaltung der Beschaffungslogistik auf Basis eines Multiple Sourcing. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Sourcing-Konzepte, beschreibt die Beschaffungslogistik als Teil der Unternehmenslogistik und analysiert die Auswirkungen eines Multiple Sourcing auf sowohl das beschaffende als auch das beliefernde Unternehmen.
- Die Beschaffungslogistik als Teil der Unternehmenslogistik
- Verschiedene Sourcing-Konzepte
- Chancen und Risiken des Multiple Sourcing für beschaffende Unternehmen
- Chancen und Risiken des Multiple Sourcing für beliefernde Unternehmen
- Zusammenhang zwischen Beschaffungslogistik und Produktionslogistik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung, in der das Thema der Studienarbeit vorgestellt wird. Es wird die Relevanz der Beschaffungslogistik im Kontext der Unternehmenslogistik und die Bedeutung verschiedener Sourcing-Konzepte erläutert. Das Kapitel 2 liefert definitorische Abgrenzungen. Es definiert die Beschaffungslogistik, ihre Einordnung und Aufgaben und stellt verschiedene Sourcing-Konzepte vor, insbesondere das Multiple Sourcing. Kapitel 3 untersucht die Beschaffungslogistik auf Basis eines Multiple Sourcing aus der Sicht eines beschaffenden Unternehmens und eines beliefernden Unternehmens. Dabei werden Chancen und Risiken in beiden Perspektiven beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Beschaffungslogistik, Sourcing-Konzepte, insbesondere Multiple Sourcing, Chancen und Risiken, Supply Chain Management, Produktionslogistik, Unternehmenslogistik, Beschaffungsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Multiple Sourcing in der Beschaffungslogistik?
Multiple Sourcing ist eine Beschaffungsstrategie, bei der ein Unternehmen ein Produkt oder eine Dienstleistung von mehreren verschiedenen Lieferanten gleichzeitig bezieht.
Welche Chancen bietet Multiple Sourcing für Unternehmen?
Zu den Vorteilen zählen eine geringere Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, ein höherer Wettbewerbsdruck (was die Preise senken kann) und eine höhere Versorgungssicherheit.
Welche Risiken sind mit Multiple Sourcing verbunden?
Risiken sind der höhere Verwaltungsaufwand, geringere Mengenrabatte im Vergleich zum Single Sourcing und ein potenziell schwierigerer Qualitätsstandard über verschiedene Quellen hinweg.
Wie unterscheidet sich Multiple Sourcing vom Single Sourcing?
Beim Single Sourcing setzt man auf eine enge Partnerschaft mit nur einem Lieferanten, was Prozessvorteile bietet, aber das Klumpenrisiko bei Lieferausfällen erhöht.
Welche Rolle spielt die Produktionslogistik dabei?
Die Beschaffungslogistik muss sicherstellen, dass die durch Multiple Sourcing bezogenen Teile rechtzeitig und in der richtigen Qualität für die Produktion zur Verfügung stehen.
- Citar trabajo
- Felix Schröder (Autor), 2019, Die Gestaltung der Beschaffungslogistik auf Basis eines Multiple Sourcing, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958238