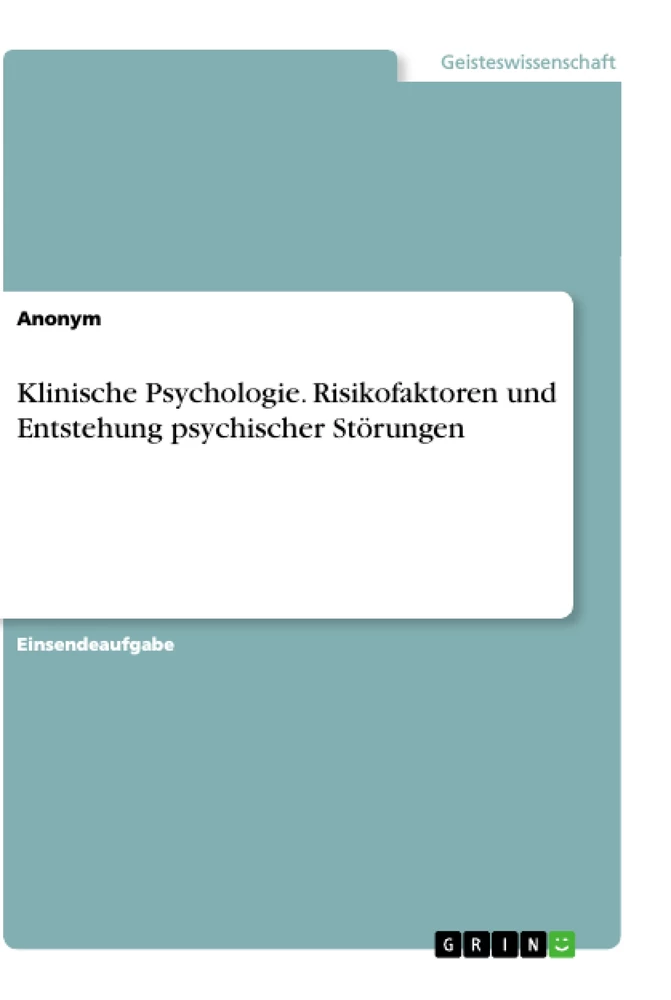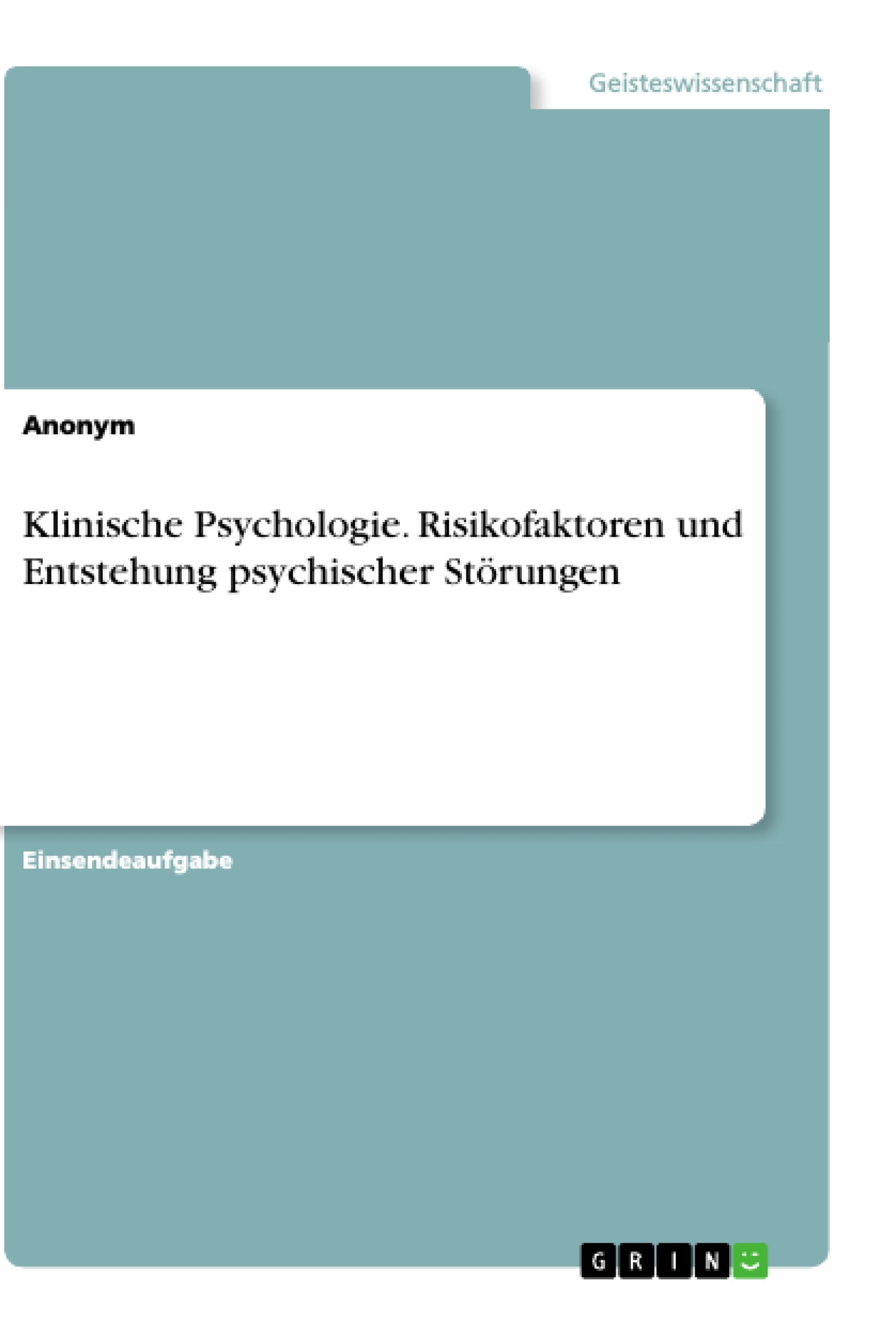Diese Arbeit bietet einen Einblick in verschiedene Themen der klinischen Psychologie. Zunächst wird die Bedeutung von Risikofaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen dargestellt. Anschließend wird auf den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen eingegangen. Abschließend werden die Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen einer psychotherapeutischen Intervention erläutert.
Psychische Störungen setzten sich aus den Beeinträchtigungen in den Bereichen Verhalten, kognitive Denkprozesse und Emotionen zusammen, die zu einem persönlichen Leidensdruck beim Betroffenen führen oder aber die Fähigkeit zur Zielerreichung einer Person abblocken. Die Bandbreite psychischer Funktionsweisen, die beeinträchtigt sein können und psychische Störung beziehungsweise Psychopathologie genannt werden können, ist groß.
Der Forschungsbereich in der Psychologie, der sich mit Pathologien der Emotionen, des Geistes und des Verhaltens beschäftigt, nennt sich klinische Psychologie. Ein Aufgabengebiet der klinischen Psychologie ist zudem im Rahmen der psychischen Erkrankungen, das Auseinandersetzten mit der Ätiologie psychischer Störungen. Das bedeutet, die Untersuchung der Faktoren, die das Entstehen von psychischen Problemlagen bedingen oder deren Ausbreitung begünstigen. Werden die Ursachen für eine psychische Störung bzw. Erkrankung aufgedeckt und erkannt, so lassen sich passende Behandlungsansätze und passgenaue Interventionen einleiten. Ferner ist es möglich psychischen Erkrankungen präventiv zu begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- Teilaufgabe 1 – Bedeutung von Risikofaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen
- Teilaufgabe 2 – Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- Teilaufgabe 3 – Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen psychotherapeutischer Intervention
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Sie beleuchtet die Bedeutung von Risikofaktoren, den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition, sowie die Schritte des diagnostischen Prozesses in der Psychotherapie.
- Risikofaktoren für psychische Störungen
- Einfluss sozialer Unterstützung
- Rolle dysfunktionaler Kognitionen
- Diagnostischer Prozess in der Psychotherapie
- Ätiologie psychischer Störungen
Zusammenfassung der Kapitel
Teilaufgabe 1 – Bedeutung von Risikofaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen: Diese Teilaufgabe erörtert die Definition psychischer Störungen als Beeinträchtigungen von Verhalten, Kognition und Emotionen, die zu Leiden oder Beeinträchtigungen führen. Sie führt in den Forschungsbereich der klinischen Psychologie ein und beleuchtet deren Fokus auf die Ätiologie psychischer Störungen. Die Teilaufgabe diskutiert verschiedene Erklärungsansätze, darunter den biologischen Ansatz (Betonung biologischer Faktoren und kognitiver Prozesse), den psychodynamischen Ansatz (Fokus auf intrapersonelle Konflikte nach Freud) und deutet auf weitere psychologische Modelle hin, ohne diese im Detail zu erläutern. Die Bedeutung der Erforschung von Ursachen für die Entwicklung passender Interventionen und Präventionsmaßnahmen wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Psychische Störungen, Risikofaktoren, Soziale Unterstützung, Dysfunktionale Kognition, Diagnostischer Prozess, Ätiologie, Klinische Psychologie, Biologischer Ansatz, Psychodynamischer Ansatz, Behaviorales Modell.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenfassende Spracheingabe zu psychischen Störungen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen. Sie untersucht die Bedeutung von Risikofaktoren, den Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognitionen sowie den diagnostischen Prozess in der Psychotherapie.
Welche Teilaufgaben werden behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teilaufgaben: 1. Bedeutung von Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen; 2. Einfluss sozialer Unterstützung und dysfunktionaler Kognition auf Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen; 3. Schritte des diagnostischen Prozesses im Rahmen psychotherapeutischer Intervention.
Welche Themenschwerpunkte werden beleuchtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Risikofaktoren für psychische Störungen, den Einfluss sozialer Unterstützung, die Rolle dysfunktionaler Kognitionen, den diagnostischen Prozess in der Psychotherapie und die Ätiologie psychischer Störungen.
Wie wird die Bedeutung von Risikofaktoren behandelt?
Teilaufgabe 1 definiert psychische Störungen als Beeinträchtigungen von Verhalten, Kognition und Emotionen. Sie führt in die klinische Psychologie ein und beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze, darunter den biologischen und psychodynamischen Ansatz. Die Bedeutung der Erforschung von Ursachen für die Entwicklung passender Interventionen und Präventionsmaßnahmen wird hervorgehoben.
Welche weiteren Ansätze werden erwähnt?
Neben dem biologischen und psychodynamischen Ansatz werden weitere psychologische Modelle angedeutet, ohne detailliert erläutert zu werden. Ein explizit genanntes weiteres Modell ist das behaviorale Modell.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Psychische Störungen, Risikofaktoren, Soziale Unterstützung, Dysfunktionale Kognition, Diagnostischer Prozess, Ätiologie, Klinische Psychologie, Biologischer Ansatz, Psychodynamischer Ansatz, Behaviorales Modell.
Was beinhaltet die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die Inhalte jeder Teilaufgabe, wobei besonders Teilaufgabe 1 detailliert beschrieben wird, die sich mit der Definition und den Erklärungsansätzen psychischer Störungen auseinandersetzt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Klinische Psychologie. Risikofaktoren und Entstehung psychischer Störungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958707