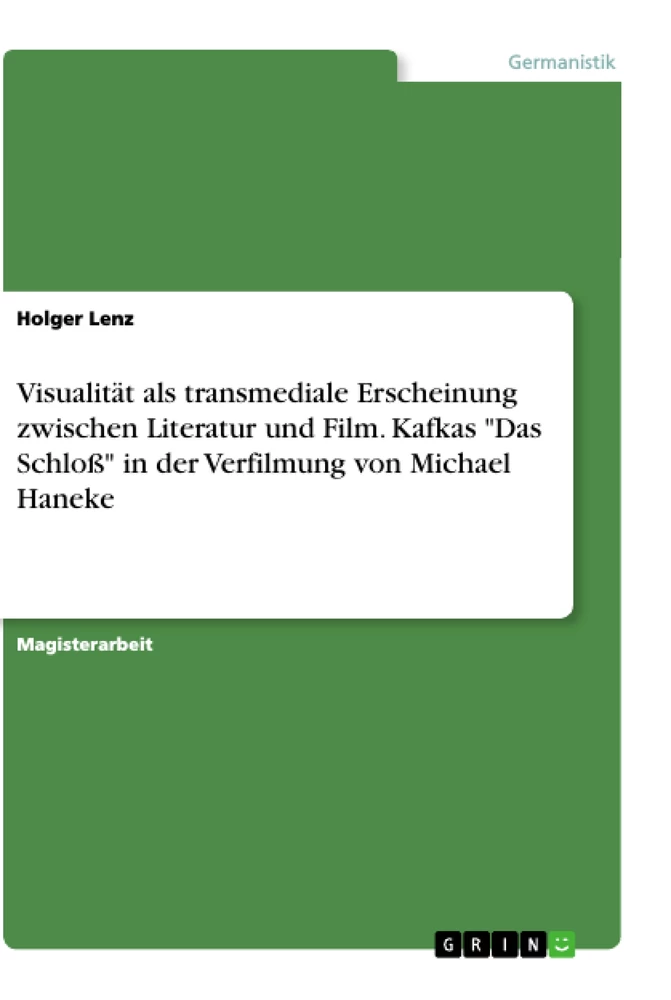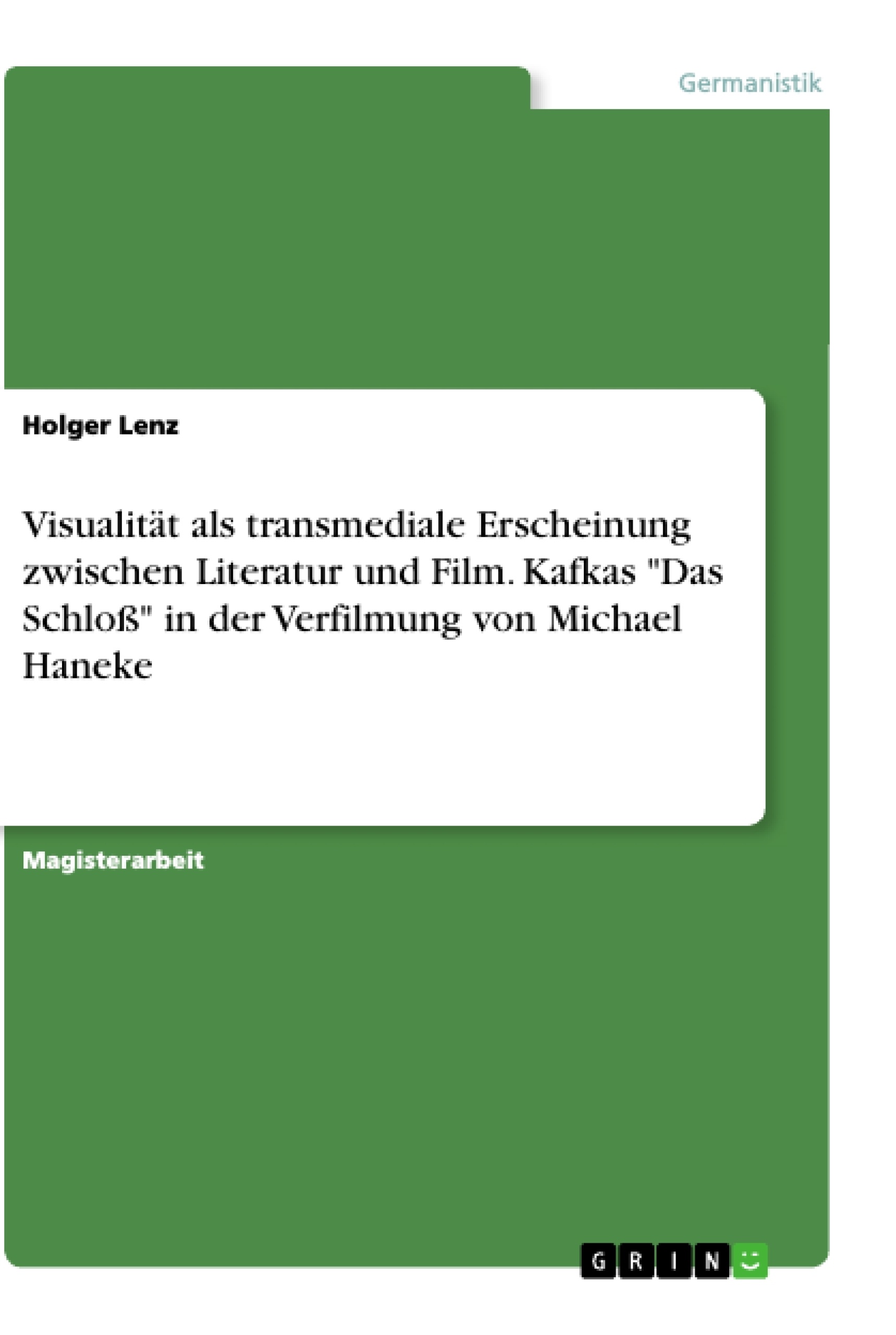Diese Arbeit beschäftigt sich mit Michael Hanekes Verfilmung von Franz Kafkas "Das Schloß" und der Visualität als transmediale Erscheinung zwischen Literatur und Film. Um sowohl der Ästhetik als auch dem Phänomen der Visualität im Film "Das Schloss" gerecht zu werden, wird die Arbeit in zwei Abschnitte geteilt. Im theoretischen Teil wird die begriffliche und methodologische Präzisierung der hier eingeführten Termini verfolgt. Dabei geht es einerseits darum, die filmische Transformation literarischer Texte im Kontext der Intermedialität zu verorten. Andererseits erfolgt hier die notwendige Ausführung zum Konzept der Visualität.
Anschließend wird im theoretischen Teil geklärt, welche Funktionen Visualität im transmedialen Vergleich ausübt und inwiefern Visualität dazu geeignet ist, das kreative Potenzial von Literaturverfilmungen aufzuzeigen. Wichtig ist an dieser Stelle der Hinweis, dass der Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit dabei auf der filmischen Umsetzung von Visualität liegt. Diesem Aspekt wird der Großteil der theoretischen Erklärungen gewidmet.
Nachdem die hier diskutierte Problematik theoretisch skizziert und erarbeitet wurde, erfolgt schließlich die Erprobung der gewonnen Erkenntnisse am Fallbeispiel. Die Analyse von "Das Schloss" bildet somit den zweiten Teil dieser Arbeit und überprüft dabei die eingangs formulierte These, dass mit dem Phänomen der Visualität ein transmediales Analyseinstrument gefunden wurde, das sowohl im literarischen als auch im filmischen Medium dazu verwendet werden kann, neue Interpretationsspielräume zu eröffnen und dem jeweiligen Potenzial von sowohl Film als auch Literatur Transparenz zu verleihen. Schwerpunkt der Analyse bildet hierbei wieder die filmische Transformation.
Seit die Bilder laufen lernten, haben sich die Medien Film und Literatur gegenseitig beeinflusst, erweitert, verändert. Bereits wenige Monate nach der ersten Filmvorführung durch die Brüder Skladanowsky im Berliner Varieté Wintergarten, begann das noch junge Medium Film sich literarischer Vorlagen zu bedienen: 1896 drehte der Filmpionier Louis Lumière kurze Sequenzen aus Goethes Faust, und eröffnete damit jenes Symbioseverhältnis zwischen Literatur und Film, das bis heute andauert. Aus der Zeit der Frühphase des Films war es vor allem die Romanliteratur, die sich aufgrund ihrer Form zur intensiven Austauschbasis zwischen den Künsten entwickelte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 1.1 Methodisches Vorgehen
- 1.2 Forschungsstand
- 2. Kafka Intermedial
- 2.1 Kafka und der Film
- 2.2 Kafka und das Bild
- 3. Theoretischer Teil
- 3.1 Der Begriff Intermedialität
- 3.1.1 Intermedialität im Kontext der Untersuchung
- 3.1.2 Intermedialität und Transmedialität
- 3.1.3 Fazit
- 3.2 Visualität in Literatur und Film
- 3.2.1 Visualität und Visibilität
- 3.2.2 Visualität und Visibilität in Literatur und Film
- 3.2.3 Exkurs: Das filmische Zeichensystem
- 3.2.4 Visibilität und Visualität im Film
- 3.3 Die filmische Transformation literarischer Texte
- 3.3.1 Die Transformation als Interpretation
- 3.3.2 Visibilität und Visualität zwischen Literatur und Film
- 3.3.3 Fazit
- 4. Vorbemerkungen zur Analyse
- 5. Michael Hanekes Filmsprache
- 5.1 Rezeptionsästhetik im Filmwerk Michael Hanekes
- 5.2 Das Phänomen der Gewalt im Filmwerk Michael Hanekes
- 5.3 Fazit
- 6. Analytischer Teil
- 6.1 Franz Kafkas Das Schloß in der Verfilmung von Michael Haneke
- 6.2 Das Dargestellte - Das optische Material
- 6.2.1 Zeit
- 6.2.2 Figuren
- 6.2.3 Raum
- 6.3 Das Dargestellte - Die Aufarbeitung des optischen Materials
- 6.4 Die Art der Darstellung - Die Kamera
- 6.4.1 Die Einstellungsgröße
- 6.4.2 Perspektive
- 6.4.3 Die Kamerabewegung
- 6.4.4 Die Schwarzbilder
- 6.4.5 Exkurs: Das akustische Material - Die Off-Kommentare
- 6.4.6 Filmische Ekphrasis: Das Schloss an/in der Tür
- 6.4.7 Zusammenfassung
- 7. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der Verfilmung von Franz Kafkas „Das Schloss“ durch Michael Haneke, wobei der Fokus auf der visuellen Gestaltung des Films und dessen Beziehung zur literarischen Vorlage liegt.
- Intermedialität und Transmedialität: Analyse der Beziehung zwischen Literatur und Film, insbesondere der visuellen Dimension.
- Visualität in Literatur und Film: Untersuchung des Konzepts der Visualität und dessen Anwendung in beiden Medien.
- Filmische Transformation literarischer Texte: Analyse der Transformation von Kafkas Text in eine filmische Form und deren Interpretation.
- Michael Hanekes Filmsprache: Begutachtung der spezifischen filmischen Mittel und Stilmittel Hanekes, die in der Verfilmung von „Das Schloss“ zum Einsatz kommen.
- Die filmische Gestaltung von Raum, Zeit und Figuren: Analyse der visuellen Gestaltung von Raum, Zeit und Figuren im Film, im Vergleich zu Kafkas literarischem Entwurf.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das methodische Vorgehen und den Forschungsstand der Arbeit vor. Kapitel 2 widmet sich dem Thema Kafka und Intermedialität, insbesondere der Beziehung zwischen Kafkas Werk und dem Medium Film. Im theoretischen Teil (Kapitel 3) werden die Konzepte der Intermedialität, Transmedialität und Visualität sowie die filmische Transformation literarischer Texte diskutiert.
Kapitel 4 beinhaltet Vorbemerkungen zur Analyse von Hanekes Filmsprache. In Kapitel 5 werden Rezeptionsästhetik und das Phänomen der Gewalt im Filmwerk Hanekes beleuchtet.
Der analytische Teil (Kapitel 6) befasst sich mit der Verfilmung von Kafkas „Das Schloss“ durch Michael Haneke. Dabei werden die optischen Materialien, die filmische Gestaltung und die Kameraführung detailliert analysiert.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Michael Haneke, Das Schloss, Literaturverfilmung, Intermedialität, Transmedialität, Visualität, Filmsprache, Kameraführung, Raum, Zeit, Figuren, Gewalt, Rezeptionsästhetik.
- Arbeit zitieren
- Holger Lenz (Autor:in), 2009, Visualität als transmediale Erscheinung zwischen Literatur und Film. Kafkas "Das Schloß" in der Verfilmung von Michael Haneke, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958721