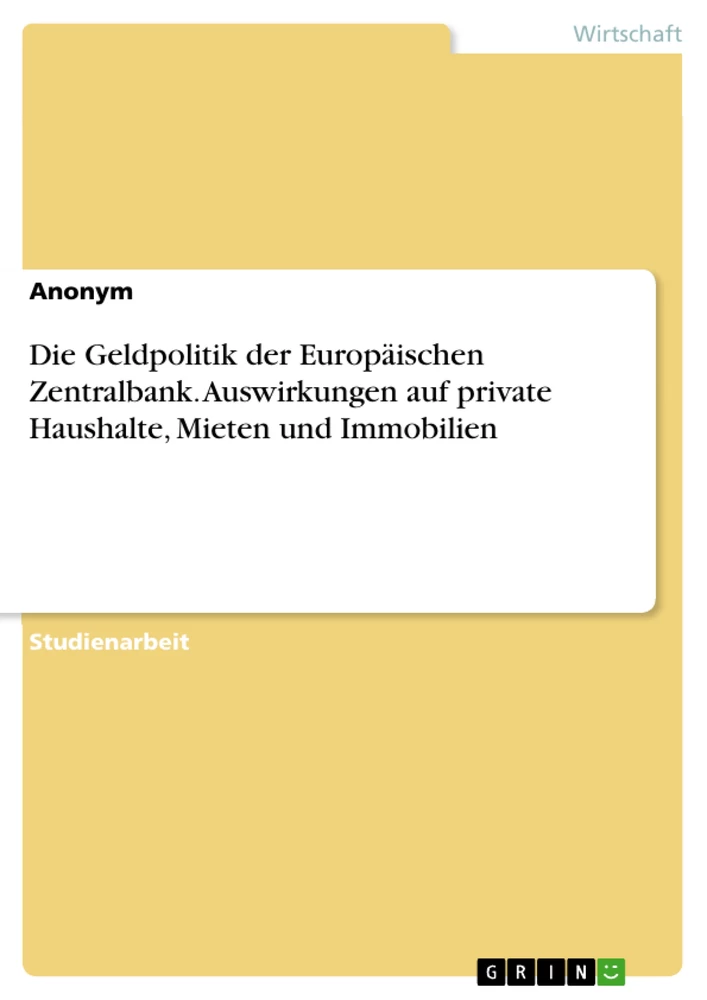Das Ziel dieser Projektarbeit ist, die Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank auf die privaten Haushalte, Mieten und Immobilien näher zu beleuchten.
Neben einer theoretischen Aufbereitung dieses Themas wird versucht, in einer eingehenden Analyse das Verhalten der privaten Haushalte näher zu erläutern und sich einen Überblick über die derzeitige Situation am Immobilienmarkt und den Bereich der Mieten zu verschaffen. Man versucht ein mögliches mittelfristiges Zukunftsszenario zu entwerfen.
Europa steckt in der Krise. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, mangelnde Strukturmaßnahmen, drohender Wettbewerbsverlust in manchen Ländern sowie hohe Staatsschulden. Europas Wirtschaft leidet. Drohende Strafzölle von Seiten der USA belasten die Stimmung noch mehr. Viele Experten warnen bereits vor einem möglichen Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten.
Der Euroraum ist geprägt durch eine momentane niedrige Inflationsrate. Die Angst vor einer möglichen Deflation geht um. Die Europäische Zentralbank versucht mit allen Mitteln die Inflation anzuheizen und pumpt große Geldmengen in das System. Leider mit bisher wenig Erfolg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Begriffserklärungen
- Definition Zinsen
- Definition Inflation
- Messung der Inflation
- Berechnung der Inflationsrate
- Ursachen für Inflation
- Definition Deflation
- Definition Geld
- Geldmenge
- Geldschöpfung
- Quantitätsgleichung
- Geld und Geldmenge
- Die Europäische Zentralbank
- Verhalten der EZB
- Das Verhalten der privaten Haushalte
- Auswirkungen auf den Immobilienmarkt
- Auswirkungen auf die Mietpreise
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Projektarbeit befasst sich mit den Auswirkungen der geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank auf die privaten Haushalte, Mieten und Immobilien. Neben der theoretischen Behandlung des Themas wird das Verhalten der privaten Haushalte analysiert und ein Überblick über die aktuelle Situation am Immobilienmarkt und im Bereich der Mieten gegeben. Ziel ist es, ein mögliches mittelfristiges Zukunftsszenario zu entwerfen.
- Einfluss der Geldpolitik auf private Haushalte
- Entwicklung des Immobilienmarktes
- Entwicklung der Mietpreise
- Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Inflation
- Mögliche Folgen von Deflation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die aktuelle wirtschaftliche Situation in Europa dar und erläutert die Herausforderungen, vor denen die Europäische Zentralbank steht. Sie definiert die Zielsetzung und den Aufbau der Projektarbeit.
- Begriffserklärungen: Dieses Kapitel definiert wichtige Begriffe wie Zinsen, Inflation, Deflation und Geld. Es stellt die verschiedenen Faktoren dar, die die Zinshöhe beeinflussen, und erläutert die verschiedenen Arten der Inflation und ihre Ursachen.
- Geld und Geldmenge: Dieses Kapitel erläutert das Wesen des Geldes und die Bedeutung der Geldmenge für die Wirtschaft. Es beleuchtet die Rolle der Europäischen Zentralbank als Geldpolitikgestalter.
- Verhalten der EZB: Dieses Kapitel analysiert das Verhalten der Europäischen Zentralbank in Bezug auf die Geldpolitik und die Auswirkungen auf den Immobilienmarkt und die Mietpreise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Geldpolitik, Europäische Zentralbank, Inflation, Deflation, private Haushalte, Immobilienmarkt, Mietpreise und Zinsen. Die Analyse umfasst sowohl theoretische Aspekte als auch praktische Auswirkungen der Geldpolitik auf die genannten Bereiche.
Häufig gestellte Fragen zur EZB-Geldpolitik
Welchen Einfluss hat die EZB auf die Immobilienpreise?
Durch niedrige Leitzinsen werden Kredite günstiger, was die Nachfrage nach Immobilien erhöht und somit oft zu steigenden Preisen am Immobilienmarkt führt.
Was ist das Hauptziel der geldpolitischen Maßnahmen der EZB?
Das primäre Ziel ist die Gewährleistung der Preisstabilität. In Krisenzeiten versucht die EZB zudem, durch eine lockere Geldpolitik die Inflation anzuheizen und eine Deflation zu verhindern.
Wie wird die Inflationsrate gemessen?
Die Inflation wird meist über den Verbraucherpreisindex gemessen, der die Preisentwicklung eines repräsentativen Warenkorbs für private Haushalte abbildet.
Warum ist Deflation für die Wirtschaft gefährlich?
Deflation kann zu einer Abwärtsspirale führen, da Konsumenten Käufe in Erwartung sinkender Preise aufschieben, was Produktion und Beschäftigung negativ beeinflusst.
Was versteht man unter Geldschöpfung?
Geldschöpfung bezeichnet den Prozess, durch den neues Geld in den Wirtschaftskreislauf gelangt, entweder durch die Zentralbank oder durch Kreditvergabe von Geschäftsbanken.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Auswirkungen auf private Haushalte, Mieten und Immobilien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/958862