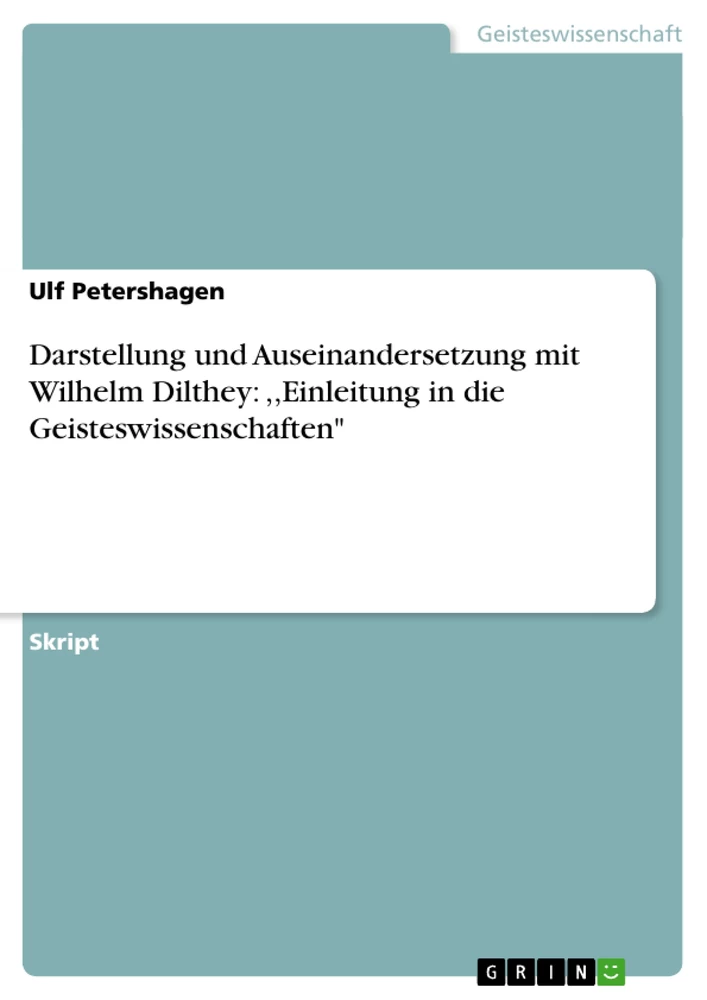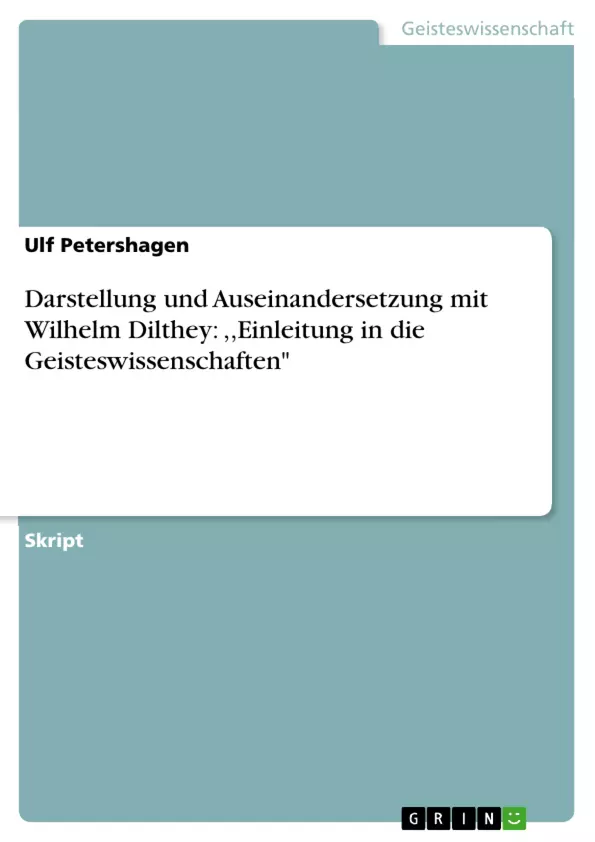Was macht den Menschen aus? Diese Frage durchzieht Wilhelm Diltheys bahnbrechende "Einleitung in die Geisteswissenschaften" wie ein roter Faden. Entdecken Sie in diesem Buch einen Denker, der sich mutig gegen die Dominanz der Naturwissenschaften seiner Zeit stemmte und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Eigenständigkeit und Bedeutung der Geisteswissenschaften – von Geschichte und Politik bis hin zu Theologie und Literatur – lieferte. Dilthey entwirft eine faszinierende Erkenntnistheorie, die das "Verstehen" als zentrale Methode der Geisteswissenschaften etabliert und dem menschlichen Bewusstsein eine Schlüsselrolle zuweist. Erleben Sie, wie Dilthey die "geistigen Tatsachen" der menschlichen Gesellschaft analysiert und die Notwendigkeit betont, die Kräfte, die in ihr wirken, zu erkennen. Tauchen Sie ein in Diltheys Überlegungen zur Abgrenzung von Natur- und Geisteswissenschaften, zum Verhältnis von "Erklären" und "Verstehen" und zur Bedeutung des "freien Willens". Lassen Sie sich von Diltheys komplexen Gedankengängen herausfordern und diskutieren Sie seine Thesen kritisch. Dieses Werk ist nicht nur eine historische Abhandlung, sondern auch eine hochaktuelle Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir als Menschen die Welt und uns selbst verstehen können. Es bietet eine tiefgründige Analyse der menschlichen Existenz und fordert dazu auf, die Bedeutung der Geisteswissenschaften für unsere Zivilisation neu zu bewerten. Ideal für Studierende der Philosophie, Geschichte, Sozialwissenschaften und alle, die sich für die Grundlagen menschlichen Denkens und Handelns interessieren. Eine intellektuelle Reise zu den Wurzeln des Verstehens, die Ihr Weltbild nachhaltig prägen wird. Ergründen Sie die Fundamente unseres Wissens und die Essenz menschlicher Erfahrung in diesem wegweisenden Werk der Philosophiegeschichte. Wagen Sie den Blick hinter die Fassade der vermeintlichen Gewissheiten und stellen Sie sich den großen Fragen der Menschheit mit Wilhelm Dilthey als Ihrem intellektuellen Wegbegleiter.
1. Wilhelm Dilthey gehört zu den bedeutendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts. Er war, im Gegensatz zu Schopenhauer oder Nietzsche, akademisch erfolgreich und seine Werke haben bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren. Dilthey`s größte Bedeutung liegt in seinem Bemühen, die von ihm genannten Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften abzusichern, in dem er ihnen ein historisches und systematisches Fundament schuf.
Unter dem Begriff der Geisteswissenschaften verstand Dilthey nicht nur die literarischen und historischen Wissenschaften eingefaßt, sondern die „Wissenschaften des handelnden Menschen“1, also die heutigen Sozialwissenschaften ebenso.
Anders als in den Naturwissenschaften, in denen vom Menschen un- abhängige Ereignisse erklärt und systematisiert werden, muß der Geis- teswissenschaftler seinen Forschungsbereich, dessen Teil er selbst ist, also die Zusammenhänge der gesellschaftlichen Realität nachvollzie- hen. Die Gegenstände der Geisteswissenschaft umfaßt Dilthey in dem geistigen Akt des „Verstehens“, daß ein Erlebnis voraussetzt.2
Nach der Biographie von Wilhelm Dilthey stelle ich seine wichtigsten Thesen und Aussagen des im Seminar besprochenen Auszuges aus der „Einleitung in die Geisteswissenschaften“ (1883) dar.
2. Wilhelm Dilthey wurde am 19. November 1833 in Biebrich bei Wiesbaden geboren. Er war Sohn eines Pfarrers und begann auf des- sen Wunsch im Jahr 1852 ein Theologiestudium in Heidelberg. Ab dem Jahr 1853 studierte er in Berlin und legte dort 1856 das erste theologische Staatsexamen ab. In Berlin lagen Dilthey`s Studien- schwerpunkte allerdings in der Philologie, Philosophie und in dem Studium der Geschichte.
Dilthey schloß die staatliche Schulamtsprüfung ab und war kurze Zeit als Gymnasiallehrer tätig bevor er sich entschloß, die akademische Laufbahn einzuschlagen. 1864 fand Dilthey`s Pro- motion und Habilitation in Berlin statt. Es folgten mehrere Professu- ren u.a. in Basel (1867/68), Kiel (1868 - 1871), Breslau (1871 - 1882) und Berlin (1883 - 1908). Wilhelm Dilthey war der Begründer der Erkenntnistheorie der Geisteswissenschaften.3
Mit seiner „Einleitung in die Geisteswissenschaft“ erschienen 1883, beginnt seine systematische Grundlegung derselben und damit der Versuch, ihre methodische Selbständigkeit zu sichern.
3. In dem ersten Kapitel stellt Dilthey den Sinn und Zweck seiner Arbeit dar. Es existierten für ihn bis dato nur naturwissenschaftliche Grundlagenwerke, die in die Methodik derselben einführten. Sie alle waren von Naturwissenschaftlern verfaßt.
Demgegenüber wollte Dilthey für die Bereiche Geschichte, Politik, Theologie und Literatur ein ebensolches Grundlagenwerk schaffen, da seiner Meinung nach die Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert zu Unrecht ein Schattendasein neben den Naturwissenschaften führten. Zu der Unterstützung seines Anliegens, die Geisteswissenschaften in ihrer Berechtigung zu stärken, verglich Dilthey die Gesellschaft mit einem Maschinenbetrieb. Jeder geistig arbeitende Mensch sei ein Rad im Getriebe, aber es bedürfe einer übergeordneten Grundlegung in der Methodik. Dilthey wollte den Bezug zwischen Sätzen und Regeln der geistig Schaffenden und der realen menschlichen Gesellschaft herstel- len.4 Es sei für die Zivilisation zu einer existenziellen Bedingung ge- worden, die Kräfte, welche in einer Gesellschaft herrschen, zu kennen und analysieren zu können.
Im zweiten Kapitel definiert Dilthey zuerst die Begriffe „Wissen- schaft“ und „Geisteswissenschaften“. Dilthey faßt die geschichtlichgesellschaftlichen Wissenschaften unter dem Begriff der „Geisteswissenschaften“ zusammen. Wissenschaft sei die Bündelung von Sätzen und Regeln die allgemeingültig, konstant und zu einem abgeschlossenen Ganzen zusammengefaßt sind. Im 19. Jahrhundert spielten die Naturwissenschaften innerhalb der akademischen Welt eine dominierende Rolle. Dilthey hingegen behauptete nicht nur eine Gleichberechtigung, sondern sogar eine Vormachtstellung der Geis- teswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften.
Die Vorgänge innerhalb der menschlichen Gesellschaft bezeichnete Dilthey als „geistige Tatsachen“.5 Diese bilden die humane Realität, welche geistig durchdrungen und verstanden werden soll. Geistige Tatsachen, also die Wissenschaft insgesamt, teilt Dilthey in Geistes- und Naturwissenschaften, wobei der Begriff „Geisteswissenschaften“ für ihn nicht das Optimum der Bezeichnung derselben darstellt.
Der Mensch hat, so Dilthey, die Fähigkeit, seine Handlungen und Ge- danken seinem Willen zu unterwerfen. Es existiere im Menschen eine selbständige innere Welt. Für ihn ist nur real und existent, was ihm bewußt ist. Dilthey behauptet, daß es für den Menschen keine Tatsa- chen gibt, die ihm nicht bewußt sind. Tatsachen, die sich innerhalb der Natur abspielen sind uns bewußte Tatsachen, da es für sie Regeln und Sätze gibt, die eben allgemeingültig und konstant seien. Das Bewußt- sein ist laut Dilthey eine geistige Angelegenheit und naturwissen- schaftliche Erklärungen sind übergeordnet geisteswissenschaftliche Erklärungen, da sie uns bewußt sind.
Dilthey behauptet sogar, daß die Geisteswissenschaft die Naturwissenschaften nicht benötige, da die Gegenstände der Reflexion ein „eigenes Reich von Erfahrungen“ sei.6
Für Dilthey waren das „Erklären“ der Naturwissenschaften und das „Verstehen“ der Geisteswissenschaften beides dem Menschen bewuß- te Vorgänge. Die Voraussetzung der Wissenschaft insgesamt ist das Bewußtsein, also quasi eine „Bewußtseinswissenschaft“ als obere E- bene. Daraus resultierte für Dilthey, daß Aspekte der Geisteswissen- schaften in beiden Wissenschaftsteilen existieren muß.
Die Objekte der Naturwissenschaften seien die Materie, Objekte und die Natur an sich.
Die Objekte der Geisteswissenschaften aber seien der Geist und das Bewußtsein an sich. Die Naturwissenschaften sind für Dilthey nicht reflektiv, da sie Gesetze voraussetzen die allgemeingültig sind. Dage- gen seien die Geisteswissenschaften reflektiv, da sie sich sowohl mit dem Objekt „Mensch“, als auch mit dem ihm innewohnenden Vor- gängen beschäftigen.
Der „freie Wille“ des Menschen macht für Dilthey den Unterschied und somit die „Wissenschaft vom Sein“ höherwertig als die Naturwis- senschaften, denn die Objekte derselben haben diesen „freien Willen“ nicht.
4. Die Geisteswissenschaften sind laut Dilthey in der Praxis des Lebens erwachsen, jedoch zu seiner Zeit noch nicht als Ganzes konsti- tuiert.
In der Zeit als Dilthey seine philosophischen Aussagen formulierte, waren die Naturwissenschaften sehr bestimmend und es ist sehr posi- tiv, daß die Geisteswissenschaften durch ihn in ihrer Berechtigung gestärkt wurden. Allerdings läßt Dilthey auch einige Fragen offen wie z.B. die Gewichtung zwischen den Bereichen der Wissenschaften ver- läuft. Eine Aussage wie: „Für den Menschen existiert nur das, was ihm bewußt ist“, kann ich so nicht nachvollziehen. Um uns herum passiert so viel und wir nehmen es wahr ohne es zu verstehen oder weiter darüber nachzudenken. Auch das eigene Bewußtsein als Teil der Reflexion zu nehmen und quasi den eigenen Körper zu verlassen um über ihn nachzudenken halte ich für unrealistisch.
Insgesamt kann ich Dilthey`s Argumentation nur sehr schwer nach- vollziehen, was sicherlich nicht zuletzt an seiner unnötig komplizier- ten Satzbildung liegt, und ich stimme mit ihm nicht überein. Das mag an der anderen Zeit liegen und in dem geänderten Selbstverständnis der Wissenschaften, da auch im naturwissenschaftlichen Bereich die Reflexion über das eigene Tun existiert.
Literatur:
1. Dilthey, Wilhelm :
„Einleitung in die Geisteswissenschaften“ Bd.1 B.G. Teubner Verlagsgesellschaft; Stuttgart Vandenhoeck & Ruprecht; Göttingen
2. Mittelstraß, Jürgen (Hg) :
„Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie“ B.I. Verlag; Mannheim/Wien/Zürich 1980
3. Lutz, Bernd (Hg) :
„Metzler-Philosophenlexikon“ Metzler Verlag; Stuttgart 1989
4. Alexander, Dietrich und Lange, Erhard (Hg) :
„Philosophenlexikon“ Verlag das europäische Buch; Westberlin 1982
5. Brockhaus; 16. Auflage 3. Bd.
Wiesbaden 1953
[...]
1 Peter C. Lang in: „Metzler-Philosophenlexikon“ Hg. Bernd Lutz S. 194
2 Brockhaus; 16. Auflage 3. Bd. 1953 Wiesbaden
3 „Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie“ Hg. Jürgen Mittelstraß S. 483
4 Wilhelm Dilthey: „Einleitung in die Geisteswissenschaften“ S. 3
5 Ebd. S. 5
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Wilhelm Dilthey und warum ist er wichtig?
Wilhelm Dilthey war ein bedeutender Philosoph des 19. Jahrhunderts, der sich darum bemühte, die Geisteswissenschaften gegenüber den Naturwissenschaften abzusichern, indem er ihnen ein historisches und systematisches Fundament schuf. Er definierte Geisteswissenschaften als die "Wissenschaften des handelnden Menschen", einschließlich der heutigen Sozialwissenschaften.
Was versteht Dilthey unter Geisteswissenschaften?
Dilthey fasste unter dem Begriff Geisteswissenschaften nicht nur die literarischen und historischen Wissenschaften, sondern auch die "Wissenschaften des handelnden Menschen", also die heutigen Sozialwissenschaften.
Wie unterscheidet sich Diltheys Ansatz in den Geisteswissenschaften von dem in den Naturwissenschaften?
Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften, die von menschenunabhängigen Ereignissen ausgehen, muss der Geisteswissenschaftler seinen Forschungsbereich, dessen Teil er selbst ist, also die Zusammenhänge der gesellschaftlichen Realität nachvollziehen. Der geistige Akt des "Verstehens" ist dabei zentral.
Wann und wo wurde Wilhelm Dilthey geboren?
Wilhelm Dilthey wurde am 19. November 1833 in Biebrich bei Wiesbaden geboren.
Welchen akademischen Werdegang hatte Dilthey?
Dilthey studierte Theologie, Philologie, Philosophie und Geschichte in Heidelberg und Berlin. Er war als Gymnasiallehrer tätig, bevor er sich für eine akademische Laufbahn entschied. Er hatte Professuren in Basel, Kiel, Breslau und Berlin.
Was ist die "Einleitung in die Geisteswissenschaften" und warum ist sie wichtig?
Die "Einleitung in die Geisteswissenschaften", erschienen 1883, ist Diltheys systematischer Grundlegung der Geisteswissenschaften und der Versuch, ihre methodische Selbständigkeit zu sichern.
Was ist Diltheys Hauptargument in Bezug auf die Geistes- und Naturwissenschaften?
Dilthey argumentiert, dass die Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert zu Unrecht ein Schattendasein neben den Naturwissenschaften führten und versucht, ihre Berechtigung zu stärken, indem er die Gesellschaft mit einem Maschinenbetrieb vergleicht, in dem jeder geistig arbeitende Mensch ein Rad ist.
Wie definiert Dilthey "Wissenschaft" und "Geisteswissenschaften"?
Dilthey fasst die geschichtlich-gesellschaftlichen Wissenschaften unter dem Begriff der "Geisteswissenschaften" zusammen. Wissenschaft sei die Bündelung von Sätzen und Regeln, die allgemeingültig, konstant und zu einem abgeschlossenen Ganzen zusammengefasst sind.
Was sind "geistige Tatsachen" nach Dilthey?
Dilthey bezeichnet die Vorgänge innerhalb der menschlichen Gesellschaft als "geistige Tatsachen". Diese bilden die humane Realität, welche geistig durchdrungen und verstanden werden soll.
Wie sieht Dilthey das Verhältnis von Bewusstsein und Realität?
Für Dilthey ist nur das real und existent, was dem Menschen bewusst ist. Er behauptet, dass es für den Menschen keine Tatsachen gibt, die ihm nicht bewusst sind. Das Bewusstsein ist laut Dilthey eine geistige Angelegenheit.
Warum hält Dilthey die Geisteswissenschaften für höherwertig als die Naturwissenschaften?
Dilthey argumentiert, dass der "freie Wille" des Menschen den Unterschied ausmacht und somit die "Wissenschaft vom Sein" höherwertig als die Naturwissenschaften ist, da die Objekte der Naturwissenschaften diesen "freien Willen" nicht haben.
Welche Kritik wird an Diltheys Thesen geübt?
Die Kritik umfasst die Frage nach der Gewichtung zwischen den Bereichen der Wissenschaften, die Behauptung, dass für den Menschen nur das existiert, was ihm bewusst ist, und die Schwierigkeit, das eigene Bewusstsein als Teil der Reflexion zu nehmen. Auch wird Diltheys komplizierte Satzbildung kritisiert.
- Arbeit zitieren
- Ulf Petershagen (Autor:in), 1998, Darstellung und Auseinandersetzung mit Wilhelm Dilthey: ,,Einleitung in die Geisteswissenschaften", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95895