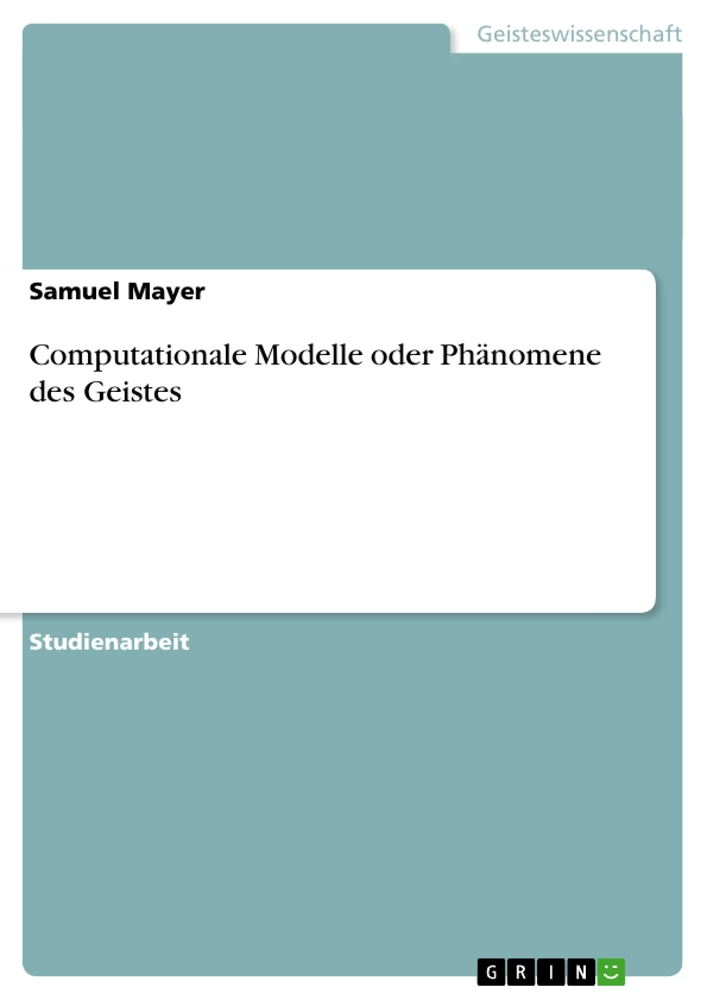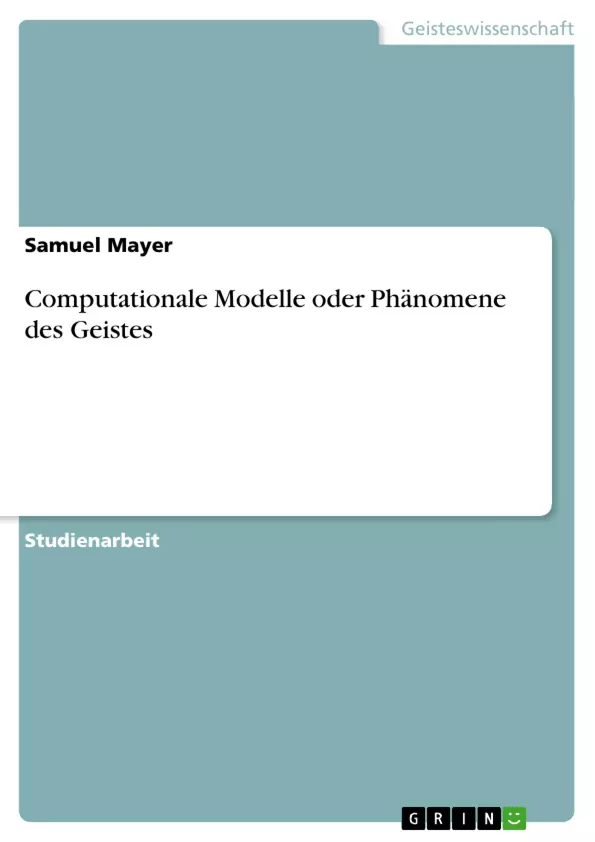INHALTSVERZEICHNIS
Zusammenfassung
1. Dietrich Dörner's Ansatz und die Entwicklung des Bauplans
1.1 Ein System der Handlungsregulation
1.1.1 Grundannahmen
1.1.2 Das Modell der Handlungsregulation
1.1.3 Die Entstehung von Emotion aus der Interaktion der Systemelemente
1.2 Über die Mechanisierbarkeit der Gefühle
1.2.1 Emotion und Computation
1.2.2 Die Definition und Funktion von Emotion
1.2.3 EMO - ein Computer mit Gefühl
1.2.4 EMO-tionalität
1.2.5 EMOs in verschiedenen Umwelten
1.2.6 EMOs und Emotionen
1.3 EMOREGUL - ein Simulationsprogramm
1.4 Von Dampfmaschinen und künstlichen Seelen
1.4.1 Fragestellung und Begründung einer systemtheoretischen Beschreibung
1.4.2 Überprüfungsmöglichkeiten von Computersimulationen anhand der Überprü- fung des Modulationsparameters Aktiviertheit
1.4.3 Implementation von Temperamenten
1.4.4 Modell und Realität - eine Zusammenfassung
2. ,,Geist" versus künstliche Intelligenz - das Phänomen Bewußtsein und die Grenzen der Computation
2.1 Einblick in die Bewußtseinsforschung
2.2 Searle und die Wiederentdeckung des Geistes
2.2.1 Grundsätzliche Fragen: das Körper-Geist-Problem
2.2.2 Kritik am Materialismus
2.2.3 Intentionalität und Bewußtsein
2.2.4 Die Struktur des Bewußtseins
2.2.5 Unbewußtes und Bewußtsein
2.2.6 Kritik der kognitiven Vernunft
Schluß
Zusammenfassung
Der Anla ß zu dieser Arbeit war nicht eine zündende Idee, die ich während eines Nachmittags, an denen die Seminare in Emotionspsychologie stattfanden, hatte, sondern - eine Fernsehsendung.1 Dietrich Dörner stellt dabei seine neue Idee des ,,Bauplans für eine Seele" vor und die Dreistigkeit und wissenschaftliche Arroganz mit der dies anhand des Simulationsprogramms: EMOREGUL vorgetragen wurde, ließ mich dann wieder mit Zufriedenheit an die Seminare denken. War es diese Art einer Psychologie, die sich über alle grundsätzlichen Fragen erhob und in einer einzigen Blickrichtung die neue, alles erklärende Theorie der menschlichen Emotionen zu proklamieren sich anspornte, die ich dort gehört hatte? Ein Glück, daß diese Antwort mit einem entschiedenen Nein zu beantworten ist und sich hoffentlich auch, wie die Lehrveranstaltungen, dieses Unternehmen meiner Hausarbeit anschickt, in differenzierter Weise nach den Möglichkeiten, zu fragen, wie sich menschliche Emotionen erklären lassen und welche grundlegenden Fragen dabei auftreten. Ein Beispiel soll die Ideen, wie sie Dörner vertritt, anhand eines Transskriptes der Dialoge erläutern:
Moderator: Wie kommen die Gefühle in den Computer?
Dörner: Emotion - die Frage war, wie könnte so etwas gesteuert werden? Und dazu haben wir uns was ausgedacht und das dann in ein Computermodell eingebaut. Dann ergab es sich, daß diese Lebewesen, die wir im Computer dann haben leben lassen, daß diese Lebewesen dann sehr deutliche Gefühlsregungen zeigten: sie ärgerten sich, resignierten und freuten sich auch - sah zumindest alles so aus. ...
Wir zerlegen also gewissermaßen die Gefühle in die darunterliegenden Prozesse der Informationsverarbeitung und studieren das Zusammenspiel des Prozesses der Informationsverarbeitung und bekommen auf diese Weise den Begriff des Gefühls in Kontrolle.
Mod: Und Sie sind der Überzeugung, daß es möglich ist - wenn Sie das alles noch ein wenig verbessern in diesem Programm - etwas zu erreichen, was tatsächlich das gleiche ist, wie die Gefühle beim Menschen?
Dörner: Ja.
Mod: (über die Ideen von Dörner et al.) Sie wollen Verstand und Gefühle analysieren. Daß eine solche Analyse möglich ist, daß sich das vielfältige Geschehen in unserer Seele in viele kleine Einheiten zerlegen läßt, daran haben Sie keinen Zweifel. Unser Intellekt und unsere Emotionen bilden zweifellos ein sehr komplexes System, aber das beweist nicht, sagen Dörner und Mitarbeiter, daß die zugrundeliegenden Prinzipien sehr kompliziert sind. In der Geschichte der Naturwissenschaft hat sich immer wieder gezeigt, daß die Natur einfach ist.
Wenn es solche Prinzipien gibt, dann lassen sie sich finden. Wenn sie sich finden lassen, dann lassen sie sich nachbauen und dann werden eines Tages die Roboter das Gesicht nicht nur verziehen, sondern auch die zugehörigen Gefühle wirklich haben.
An dieser Stelle taucht dann, mit der Erklärung des populärsten Gegenargumentes gegen eine solche Behauptung, der Autor der Idee des ,,chinesischen Zimmers", John Searle, auf. Searle vertritt die Haltung, daß geistige Prozesse nicht in Form von Computerprogrammen darstellbar sind und das Hirn nicht mit einem Computer gleichgesetzt werden kann. Wieder ist es Dietrich Dörner, der eine - im Lichte der modernen Neurowissenschaften - schon fast als ,,tolldreist" zu bezeichnende Idee, was Neuronen tun, entwirft:
Searle: Das Hirn, die Neuronen haben die Fähigkeit, Bewußtsein hervorzubringen, ein Computer hat diese Fähigkeit nicht.
Dörner: Warum denn nicht? (zum Moderator gerichtet:) Sie sind doch auch nur ein Rechner: Sie haben ja in ihrem Kopf nichts anderes als Vektormultiplikatoren .. und bei Neuronen kann man sagen: im großen und ganzen sind das solche Vektormultiplikatoren, d.h. also da kommt ein bestimmter Input hinein und was das Neuron im wesentlichen macht, ist, daß es die Inputfrequenz mit den synaptischen Übergangsgewichten multipliziert und die Ergebnisse dann aufaddiert. Und daraus bestimmt sich dann seine Eigenaktivität. Und das machen die Neurönchen milliardenfach in jedem Augenblick - pure Rechnerei . Und mehr ist das nicht !
Searle:... Unser Gehirn arbeitet nicht mit Regeln, sondern mit Fähigkeiten, ... mit know- how...
Mod: Zum Flirten braucht man keine Regeln, aber know-how. Aber womöglich läßt sich das auch analysieren ...
Dörner: Liebe ? kann man schon darüber reden, kann man auch analytisch darüber reden, das kann man auch auseinandernehmen. Da muß man eine Theorie der menschlichen Motivation, der menschlichen Gefühlsregungen, eine Theorie des menschlichen Handelns haben. All das kann ich ohne Schwierigkeiten ... in einem neuronalen Netzwerk aus Vektormultiplikatoren unterbringen und auf diese Art und Weise erhält das Netzwerk Bedeutung.
Soweit die Ausschnitte aus der Sendung.
Das waren starke Worte, aber konnte es denn wirklich eine einigermaßen wissenschaftliche Rechtfertigung für solche ,,Töne" geben und wie sollte es möglich sein, subjektive Empfindungen in binäre Computercodes zu bringen, gar, die ganze, uns noch weitgehend unverständliche Fülle und Komplexität des Gehirns, in einen Formalismus zu zwingen. Daß dies nicht die Wirklichkeit sein konnte, die mir gegenwärtig war, war schnell klar und die Argumentation von Searle's berühmtem chinesischen Zimmer war ein Ansatzpunkt, mich mit diesen Fragen detailliert auseinanderzusetzen.
Aus dieser Idee heraus habe ich in dieser Arbeit versucht, über Dörner's Entwicklung der PSI- Theorie oder ,,Theorie der Handlungsregulation", wie sie anfangs bezeichnet wurde, einen Überblick zu geben, um zu zeigen, wie sich diese Konzepte, die schließlich zur Implementation von EMOREGUL führten, aus theoretischen Konstrukten ergeben. Die Idee, ein solches Modell der Wirklichkeit als Computersimulation umzusetzen, ist sicherlich eine interessante und sehr einleuchtende Idee, die zudem über Regulationsmechanismen und Interaktionen interessante Ergebnisse erbracht hat. Wie aber dieses Modell in Beziehung zur Wirklichkeit gesetzt werden kann, welche Implikationen die »Computationen« von psychischen Phänomenen beinhalten und welchen Beschränkungen der Aussagekraft solche Modelle unterliegen, dazu war die grundsätzliche Kritik, die John Searle an der Computation von ,,intentionalen Zuständen", wie es Emotionen sind, sehr hilfreich. Diese wird im zweiten Teil der Arbeit, anhand von ,,Die Wiederentdeckung des Geistes" gezeigt; diese Arbeit hat mir gezeigt, daß Emotion sich bei weitem nicht in EMOs erschöpft, sondern die ganz Vielfalt menschlicher Bewußtseinszustände umfassen kann. Die eine, umfassende, Theorie der Emotion gibt es nicht; davon gehe ich aus.
1. Dietrich Dörner's Ansatz und die Entwicklung des Bauplans
1.1 Ein System der Handlungsregulation
Wenn es um die Darstellung der Idee: ,,Bauplan für eine Seele"2 bei Dörner geht, so werde ich zunächst versuchen, die Entwicklung und die gedanklichen Leitlinien dieser Idee anhand der wichtigsten Texte von Dörner et al.3 chronologisch darzustellen. Dabei hoffe ich deutlich machen zu können, wie Dörner's ,,computationale Idee" der Beziehungen menschlicher Emotionen aus früheren Arbeiten entstand, welche Schwierigkeiten sich in wissenschaftstheoretischer Perspektive daraus ergeben und wie sich seine ,,Erklärung menschlichen Verhaltens" in der Kritik von John Searle, als einem populären Kritiker der KI- Forschung, einordnen läßt.
Ausgangspunkt meiner Untersuchungen ist der 1988 erschienene Aufsatz von Dörner, Schaub, Stäudel und Strohschneider: ,,Ein System zur Handlungsregulation oder - Die Interaktion von Emotion, Kognition und Motivation"
Darin versuchen die Autoren zunächst eine ,,allgemeine Struktur einer Theorie zur Erklärung menschlichen Verhaltens in komplexen, dynamischen Situationen" (Dörner et al.,1988, S. 217) vorzustellen und damit Elemente der ,,Interaktion von Emotion, Kognition und Motivation" in ihrer Prozeßgestalt herauszuarbeiten. In dieser frühen Arbeit geht es meines Erachtens darum, die prinzipiellen Mechanismen der Interaktion in Form von plausiblen Abläufen darzustellen und deren Evidenz anhand menschlicher Verhaltensweisen nachzuweisen. Dazu werden verschiedene modellhafte Annahmen und Interaktionsmodelle generiert, die den Prozeßverlauf der Steuerung bzw. Regulierung von Handlung beschreiben sollen.
Aus der Forschungstradition von Dietrich Dörner, dem komplexen Problemlösen, gesehen, scheint es hier ebenfalls naheliegend, das Hauptaugenmerk auf die Prozeßmodelle, die für das beobachtbare Handlungsergebnis ausschlaggebend sind, zu legen. Insbesondere waren es die Fehler, die beim Handeln in komplexen Situationen von den Versuchspersonen in seinen Computersimulationen begangen wurden, die zum Ausgangspunkt für die Suche nach Erklärungen und Regeln, wie sich Gefühle und Denkprozesse gegenseitig beeinflussen, dienten.
1.1.1 Grundannahmen
Das heißt nun aber zunächst, daß die Interaktionsprozesse in ihrer Vernetztheit und Komplexität dargestellt werden, in ihrem Zusammenwirken geordnet und hinsichtlich des produzierten Outputs auf die jeweilige Wirkung und deren Evidenz untersucht werden müssen. Für diese Darstellung eines ,, dynamischen Interaktionismus" gehen die Autoren von bestimmten Grundannahmen aus, denen die Einheiten des Systems unterliegen:
a) Die erste Annahme betrifft die Gedächtnisstruktur des handelnden Systems. Sie besteht aus einem ,,Tripel-Netzwerk" ineinander-verschachtelter Hierarchien.
- Das sensorische Netzwerk: es fungiert als Speichermedium für Bilder und Schemata von Sachverhalten, Situationen und Gegenständen.
- Das motorische Netzwerk: es enthält die Aktionsprogramme des motorischen Systems.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- Das motivatorische System: darin befinden sich die ,,Repräsentationen der Mangelzustände, unter denen das System leiden kann" (Dörner et al.,1988, S.220). In Form einer hierarchischen Ordnung sind basale physiologische Mangelzustände unten und nach oben aufsteigend zunehmend komplexere Mangelzustände angeordnet.
Abbildung 1: Die Tripel-Hierarchie (aus Dörner et al., 1988).
Wie in Abb. 1 zu sehen ist, werden die einzelnen Elemente des Netzwerkes durch die Aktivierung der Verknüpfungsstellen (,,Knoten") miteinander verbunden. Dabei sind z.B. sensorisches und motorisches Netzwerk derart miteinander verknüpft, daß motorische Aktionsprogramme mit sensorischen Schemata verknüpft sind und von diesen aktiviert werden können. Ebenso kann auch ein sensorisches Schema von den motorischen Programmen im Sinne einer Erwartung präaktiviert werden.
Die Kopplung von motivatorischer und sensorischer Hierarchie soll dabei der Entstehung und Befriedigung von Mangelzuständen dienen: bestimmte Reizmuster wirken dabei auf der sensorischen Seite als Signale für Mangelzustände, indem sie mit den motivatorischen Elementen verglichen werden. Ebenso erzeugen aber sensorische Elemente auch bestimmte ,,situative Vorstellungen als Handlungsziele", indem sie durch Verknüpfung von motivatorischen mit sensorischen Einheiten eine Vorstellung als Grundlage eines Handlungsplanes erzeugen.
b) In der zweiten Grundannahme wird das Konzept der Absicht als ,,Bündelung von Elementen aus verschiedenen Netzwerken der Tripel-Hierarchie" beschrieben. Diese stellt eine zeitweilige Strukturierung des in a) beschriebenen Gedächtnismodells dar. Ein sensorisches Schema S_ repräsentiert dabei die Ausgangssituation. Zu jeder S_ - Situation existieren ein oder mehrere S_ -Schemata, die die jeweilige Ziel- oder Befriedigungssituation der Absicht darstellen. Eine dritte Komponente stellt das »Wissen« in Form von Einzeloperatoren oder Operatorketten dar, die zur Überführung von S_ in S_ notwendig sind. Außerdem besitzt jede Absicht eine Information über ihre »Wichtigkeit«, die sich aus der Dringlichkeit der Beseitigung eines Mangelzustandes ergibt. Die S_ - Zustände werden ebenso von den zugrundeliegenden Mangelzuständen vorgegeben.
Eine weitere Komponente der Absicht besteht in der »Zeitperspektive«, die eine zeitliche Vorgabe für die jeweilige Absicht macht und damit einen Zeitraum festlegt, in dem die Absicht realisiert sein muß. Die Bestandteile einer Absicht sind damit:
- das sensorische System S_ als Ausgangspunkt der Absicht;
- sensorische Systeme S_ als Zielpunkte der Absicht;
- die »Geschichte« der Absicht als Wissen um ihre Entstehung;
- die »Wichtigkeit« als ,,Aktionsstärke der Elemente des motivatorischen Netzwerkes";
- die »Zeitperspektive«, die u.a. auch die Ermittlung der Zeitdauer der Einzeloperationen des Komplexes »Wissen« mit einschließt;
- die »Erfolgswahrscheinlichkeit« der Realisierung der Absicht als Produkt der
Erfolgswahrscheinlichkeiten der Einzelopratoren im Verlauf von S_ zu S_;
- die »aktuelle Kompetenz« des Systems zur Durchführung der Einzeloperationen (die ja nicht immer als abrufbare Elemente direkt vorliegen, sondern in Form eines Problemlöseprozesses u.U. erst generiert werden müssen).
Das Konstrukt ,,Absicht" zeigt sich schon jetzt als recht komplexe Struktur. Ein System, welches die Handlungsregulation simulieren könnte, muß allerdings noch zusätzlich mit der Option ausgestattet sein, mehrere ,,Absichten" zu realisieren, die zudem hierarchisch geordnet sind und sich durch ihre Realisierung auch in ihrer Dynamik insgesamt verändern. Die ganze Komplexität eines solchen Systems versuchen Dörner und Mitarbeiter nun in einem kybernetischen Modell darzustellen, wobei sich allerdings schnell zeigt, daß die mannigfachen Interaktionsmöglichkeiten sich in einem zweidimensionalen Modell - ohne die Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen - kaum darstellen lassen. Dies legte schon damals die Idee nahe, eine solche Darstellung mittels Computersimulation zu realisieren, um insbesondere den Prozeßverlauf eines solchen Systems beobachtbar zu machen.
1.1.2 Das Modell der Handlungsregulation
Das Modell unterscheidet zwei Hauptelemente, zum einen die ,,Prozedurelemente" und zum andern Speicherelemente. Abbildung 2 stellt - fett umrandet - die Einheiten der Prozeßbearbeitung dar und - -normal umrandet - die Datenstrukturen des Systems.
Abbildung 2: Das Modell der Handlungsregulation (modifiziert, nach Dörner et al., 1988).
Im Folgenden sollen kurz die einzelnen Elemente beschrieben werden, ohne allerdings zu sehr ins Detail zu gehen (das Schema stellt selbst nur eine Auswahl der postulierten Interaktionsprozesse dar!). GENINT, SELECTINT, PROMINT und HYPERCEPT stellen die vier Prozedureinheiten der Informationsverarbeitung dar. Die anderen Einheiten realisieren verschiedene ,,Gedächtnissysteme" in Form von Speichereinheiten.
Die Verarbeitung von Handlungsprozessen kann hier nur sukzessiv dargestellt werden, sie läuft in ,,Wirklichkeit" natürlich meistens parallel, so daß man sich dieses System als »aktives Netzwerk« am besten als überall gleichzeitig tätiges Gefüge vorstellen kann. In GENINT4 (für »GENerate INTentions«) werden ständig Absichten gebildet und an die Speichereinheit Memint (für »MEMory for INTentions«) weitergeleitet. GENINT empfängt dabei Informationen aus den Modulen Realitätsmodelle und Mangelzustände. Dabei werden in Realitätsmodelle die Kenntnisse des Systems über den jeweiligen Ausschnitt der Wirklichkeit, sowie die Möglichkeiten, sich darin handelnd zu bewegen, repräsentiert. Dies stellt damit eine höhere Ebene der in der Tripel-Hierarchie beschriebenen Substrukturen dar, die innerhalb des Gesamtsystems eine Entität darstellen, wobei dieser Auflösungsgrad des Modells nicht an allen Stellen beschrieben wird, wenn er denn überhaupt erreichbar ist.
GENINT arbeitet nun so, daß es für die gemeldeten Mangelzustände die, per Befriedigungsrelation identifizierten Zielzustände ( S_ ), ermittelt und - unter Berücksichtigung der "augenblicklichen Gesamtsituation" SIT - die Absicht erzeugt, diesen Mangelzustand zu beseitigen. Die auf diese Weise ständig neu erzeugten Absichten werden dann in Memint, einer Art Arbeitsgedächtnis, gespeichert.
SELECTINT (für »SELECT INTentions«) wählt aus einer Vielzahl von Absichten eine aktuelle Absicht aus, die für eine gewisse Zeit handlungsleitend werden soll und in Actint gespeichert wird. Die Auswahl der aktuellen Absicht erfolgt gemäß dem »Erwartung * Wert - Prinzip«, wo die Komponente »Erwartung« durch die erwartete Erfolgswahrscheinlichkeit der Einzeloperationen und der »Wert« durch die »Wichtigkeit« der einzelnen Absichten repräsentiert ist. SELECTINT sorgt durch einen Mechanismus der lateralen Inhibition dafür, daß eine einmal ausgewählte Absicht nicht vorschnell wieder verworfen wird und es zu einem Hin-und-her-Springen von Absicht zu Absicht kommt und letztlich das System dadurch handlungsunfähig wird.
PROMINT (für »PROMote INTentions«) wird von Dörner et al. als das ,,kognitive Herzstück unserer Theorie" bezeichnet. Darin werden aus dem Input von Realitätsmodelle und der aktuellen Absicht in Actint Handlungen vollzogen. Diese Bearbeitung findet auf zwei Stufen statt: auf der ersten werden Operatorketten, die sich bereits in Memint befinden und als ausreichend für die Erreichung der intendierten Zielsituation S_ angesehen werden, auf die aktuelle Absicht angewendet und PROMINT kann wieder verlassen werden. Auf der anderen Stufe werden komplexere Planungsprozesse wirksam, wie z.B. ,,interpolatives Planen" bei dem versucht wird, durch Neukombination bekannter Operatorketten zum Ziel zu kommen. Ist dieser Weg nicht erfolgreich, wird mit Hilfe von ,,synthetischem Planen" versucht, neue Operatoren und Operatorketten zu konstruieren, indem neue und bisher auf ein Problem nicht angewandte Lösungsmöglichkeiten ausprobiert werden. Stellt sich auch damit kein Erfolg bei der Absichtsbearbeitung ein, so wird die Absicht wieder zurückgegeben und eine neue Absicht ausgewählt. Zeigt sich die vorige Absicht allerdings als dominant (oder resistent) in der Hierarchie der Absichten, so wird das System längere Zeit bei der Bearbeitung und Problemlösung verweilen - eine Art der ,,Selbstreflexion".
Das Konstrukt HYPERCEPT (für »Hypothesengeleitete PERCEPTion«) stellt den ,,Wahrnehmungsapparat des Systems" dar, indem es für räumliche und zeitliche Orientierung sorgt und dazu jeweils ein aktuelles Protokoll anfertigt, das dann in einem Protokollgedächtnis in Form einzelner Situationen SIT (t1), SIT (t2), ... abgelegt wird. Der Vergleich der Situationen - in viele Einzelprozesse aufgegliedert - erlaubt eine zeitliche Orientierung und Klassifikation von Vergangenheit, Gegenwart und zukünftig Erwartetem; der Erwartungshorizont stellt in diesem Vorgehen die Speichereinheit für antizipierte Prozesse dar. Die Prozedur HYPERCEPT sorgt, durch die Möglichkeit zukünftige Situationen zu antizipieren, für die Möglichkeit der Adaptation des Systems an verschiedene ,,Umwelten". Dazu findet in HYPERCEPT ständig ein Vergleichsprozeß zwischen aktuellem Umgebungsbild und den Erwartungen aus dem Erwartungshorizont statt.
1.1.3 Die Entstehung von Emotion als Ergebnis der Interaktion der Systemelemente
Die Entstehung von Emotion stellt sich Dörner nun als Ergebnis der Nicht-Übereinstimmung dieses Vergleichsprozesses vor: paßt das aktuelle Umgebungsbild, welches von HYPERCEPT wahrgenommen wird, nicht zu dem im Erwartungshorizont abgelegten Vorrat an möglichen Situationen, ,,so werden bestimmte Emotionen ausgelöst, die jedenfalls einen Mangelzustand, ein »Nicht-erwartet-haben« oder ein »Nicht-kennen« implizieren" (Dörner et al., 1988, S.227).
Das System ist nun genötigt, eine detailliertere Erkundung der Situation zur Beseitung des Mangels oder zu einer neuerlichen Übereinstimmung des Umgebungsbildes mit dem Erwartungshorizont zu schaffen.
Für die Entstehung von ,,Emotionen" - oder besser ausgedrückt: den Prozessen des Systems, die von einem Subjekt als Emotion erlebt werden könnten - spielt zum einen die Verzweigungsgestalt des Erwartungshorizontes eine große Rolle, zum anderen die als »FHParameter« postulierten Prozesse.
Im Falle einer starken Verzweigung des Erwartungshorizontes findet das System aus der Extrapolation vergangener Situationen keine sichere Zuordnung im Sinne von kontingenten Ereignissen und wird damit in einen Zustand der ,,Unbestimmtheit der Zukunft" versetzt, der sich als eine Art ,,Grundgestimmtheit" auf Fähigkeiten des Handlungssystems auswirkt. Ähnlich zu dem dabei erzeugten Parameter »Unbestimmtheit« werden auch sog. FH- Parameter von Dörner als das ,,Wissen" des Systems um mangelzustandserzeugende Situationen, die »Furcht« auslösen, und solchen, die als mangelzustandsbehebende Situationen »Hoffnung« kennzeichnen, postuliert.
Diese Parameter setzt Dörner nun in Beziehung zu bestimmten ,,Ausdrücken für Emotionen, die das diesen Parametern zugeordnete subjektive Erleben kennzeichnen" (Dörner et al., 1988, S.228).
Damit wird aber noch nicht die ganze ,,Emotionalität" des Systems erschöpft: der »Gesamtzustand des Systems« und ,,das Wechselspiel zwischen variablen Steuerungsparametern und dem variablen Gesamtzustand führt zu der charakteristischen Dynamik im Emotionserleben" (vgl. Dörner et al., 1988, S.228).
Abbildung 3 zeigt eine Übersicht über die Systemelemente und die damit korrespondierenden Emotionen als subjektive Empfindungen.
Neuartigkeit Nichtkonvergenz des HYPERCEPT-Prozesses
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Staunen
Unerwartetheit Nichtkonkordanz eines durch HYPERCEPT identifizierten Objektes mit dem Erwartungshorizont
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Schreck
Unbestimmtheit Verzweigungsgrad des Erwartungshorizontes
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Angst
Furcht / Hoffnung Existenz ungleichgewichtsstiftender oder ungleichgewichtsvermindernder Elemente im Erwartungshorizont
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Furcht oder Hoffnung
Abbildung 3: Informationsverarbeitung und korrespondierende emotionale Erlebnisse (modifiziert, nach Dörner, 1988).
Wenn man die Ausführungen über Emotionen in diesem Text nochmals zusammenfassend anschaut, wird deutlich, daß über die Funktion der Emotionen in einem System der Handlungsregulation und die Notwendigkeit der Emotionsentstehung keine Aussagen gemacht werden. Dies wird erst im Beitrag von Dörner (1994) explizit dargestellt werden. An dieser Vorgehensweise kann man eine generelle Kritik anbringen, deren Reichweite die ganze psychologische Wissenschaft umfaßt und die auch meinen ersten Eindruck beim Lesen recht gut wiederzugeben vermag. Schwemmer formuliert dies so: Es fällt auf, daß keine Anstrengung der Phänomenerschließung, keine »philosophische Empirie« betrieben wird, um sich erst einmal der Identität des Gegenstandes zu vergewissern, über den man reflektieren will. Sondern von Anfang an wird ein bestimmtes, sprachlich vermitteltes Verständnis von dem, was Bewußtsein ist, (...) unterstellt" (Schwemmer, 1994, S. 5).
Dörner et al. legen großen Wert darauf, zu zeigen, wie aus der Interaktion von Systemelementen Emotionen entstehen könnten, wobei sie zunächst offen lassen müssen, ob die systemtheoretische Erklärung überhaupt den empirischen Befunden entspricht. Evidenz für ihr Erklärungsmodell erhalten sie allerdings durch Erklärungsansätze für bereits zuvor beschriebene Phänomene, wie z.B. den »Rumpelstilzchen-Effekt« und das » thematische Vagabundieren «. Bei letzterem werden im System eine große Menge an Absichten mit ähnlich großem Absichtsdruck erzeugt, wobei Defizite im Realitätsmodell, d.h. ,,unzureichendes Wissen bei geringem Vertrauen in die eigenen heuristischen Fähigkeiten" (Dörner et al., 1988, S. 231), und gleichzeitig hoher Zeitdruck zu einer Form der Lähmung der Planungs- und Handlungsfähigkeit führen.
Mit diesem Modell, das sehr komplexe Interaktionsmuster (die in der Kürze hier allerdings nicht dargestellt werden können) und deren zeitlichen Verlauf detailliert darstellen kann, ist nun der Weg für eine im nächsten Schritt vorgenommene Umsetzung in ein Computerprogramm gebahnt.
2. Über die Mechanisierbarkeit der Gefühle
2.1 Emotion und Computation
5 Als Begründung für eine Untersuchung, ,,ob ein Computer Gefühle erzeugen kann", dient für Dörner die einfache Feststellung:
Unser Interesse an der Frage, ob Gefühle »computerisierbar« sind, ist grundsätzlicher Art: Wenn die Psychologie eine Wissenschaft sein will, dann muß sie, wie andere Wissenschaften auch, Theorien für ihren Gegenstand angeben können, die aus »wenn...- dann...« - Aussagen bestehen, also aus der Angabe bestimmter Regeln für Geschehnisse. In der kognitiven Psychologie ist man der Auffassung, daß Theorien der Psychologie Theorien über Informationsverarbeitungsprozesse sind. Die Frage, die wir in diesem Aufsatz untersuchen wollen, lautet also präziser: Gibt es ein Regelwerk von »wenn,... - dann ..."- Aussagen über Informationsverarbeitungsprozesse, welches emotionale Prozesse abbildet? Wenn es das gibt, so kann man Computer als beliebig formbare Medien der Informationsverarbeitung auch dazu bringen, entsprechend solcher Regeln zu arbeiten, also »Gefühle zu zeigen« (Dörner, 1994, S.131).
Das heißt nun aber, wenn ich es richtig verstehe, daß mit der Frage der Computation psychologischer Phänomene die gesamte psychologische Wissenschaft oder die wissenschaftliche Psychologie als Ganzes auf dem Prüfstand steht und sich in der Weise bewähren muß - ein hohes Ansinnen. Eine Frage, die dabei gestellt werden muß, ist die nach der Informationsverarbeitung; dies soll in Kapitel 2 anhand der Kritik von Searle's Begriff der Information und der darauf aufbauenden Kognitionswissenschaft insgesamt gezeigt werden.
Fraglich am Ansatz der Mechanisierbarkeit der Gefühle erscheint für Dörner allerdings auch, ob ein solches emotionales »System« dann diese postulierten Emotionen auch wirklich »hat«; für mich schließt das die Frage nach dem mit ein, in welchem Sinn hier überhaupt »Emotionen« erzeugt werden können. Dies ist zunächst eine prinzipielle Frage an die Möglichkeiten und Grenzen der Computation, diese Frage wird später ausführlicher diskutiert werden.
Was denn eigentlich mit dem Begriff der Computation gemeint ist, soll nun ansatzweise erklärt werden. Zunächst geht die Idee, menschliche Phänomene (wie z.B. Denken, Entscheiden, Motiviertsein usw.) in Form von Computerprogrammen darzustellen oder zu simulieren, auf die Definition von A. Turing (1950) zurück, in der es, allgemein gesagt, darum geht, eine unendliche Zahl von Problemen (zunächst waren dies mathematische Probleme in wohlgeordneter Form) mit Hilfe einer endlichen Zahl von sog. ,,internen Zuständen" einer Maschine zu lösen (vgl. Penrose, 1991, S.32 f.). Von diesem Paradigma ging zunächst die Forschung der ,,Künstlichen Intelligenz" aus und die Forschungsidee von Dörner läßt sich da problemlos einordnen.
Weniger formalisiert, beschreibt Searle die Idee einer nach Turing benannten Maschine und der daraus abgeleiteten Church-Turing-These. Sie besagt, daß es für jeden Algorithmus eine Turingmaschine gibt, die diesen Algorithmus implementiert. Turings These besagt, daß es eine universale Turingmaschine gibt, die jede Turingmaschine simulieren kann. Wenn wir dies beides zusammennehmen, erhalten wir das Resultat, daß eine universale Turingmaschine jedweden Algorithmus implementieren kann (Searle, 1996, S.227).
Zugespitzt auf die Belange dieser Arbeit geht es also darum, daß, wenn wir Phänomenbereiche der Psychologie in algorithmischer Form beschreiben können (und so versteht Dörner wohl das Phänomen ,,Emotion" in seiner Definition), dann könnte eine universelle Turingmaschine auch alle diese Phänomene und ihre Interaktionen darstellen und symbolisch manipulieren. Wenn das Gehirn nun ebenfalls eine solche universelle Turingmaschine ist - und davon geht Dörner und ein Teil der KI-Forscher aus - dann muß also die Computation intentionaler Zustände ein Merkmal der bisher in mentalistischer Sprache formulierten menschlichen Phänomene sein. Damit scheint aber die Frage nach dem, was das Wesen von Emotion, Kognition u.a. Phänomenen menschlichen Bewußtseins ist, dahingehend geklärt zu sein, daß damit prinzipiell computationale Merkmale des Geistes bezeichnet sind, daß mithin die Frage nach dem was »Geist«, »Bewußtsein« und andere Phänomene bezeichnen, für eine wissenschaftliche Beschreibung verzichtbar ist.
Um die Frage, wie denn ein so komplexes Organ, wie es das Gehirn darstellt, im Zusammenwirken mit dem Geist, Phänomene wie Intentionalität, Bewußtsein u.a. hervorbringen kann, zu beantworten, genügt die lapidare Feststellung: ,,Das Hirn funktioniert wie ein digitaler Computer, der computationale Operationen über der syntaktischen Struktur von Sätzen im Kopf ausführt" (Searle, 1996, S.227).
Zusammengefaßt läßt sich also die Idee der Computation als prinzipielle und vollständige Berechenbarkeit der in algorithmischen Strukturen vollständig erfaßbaren Wirklichkeit verstehen.
Wenn das Gehirn alle Bewußtseinsphänomene erzeugt (und woher sollten sie sonst kommen?) und das Gehirn im Sinne einer universellen Turingmaschine funktioniert, dann lassen sich alle diese Phänomene prinzipiell simulieren, also in einem Computer modellhaft nachbilden. Die Tatsache, daß Bewußtseinsphänomene nicht autonom existieren, sondern - soweit uns bisher bekannt ist - an biologische Organismen mit entsprechender Struktur gebunden sind6, wird in dieser Denkweise weitgehend vernachlässigt. Auch wenn biologische Organismen als Hardware-Basis für eine Software-Implementierung sog. geistiger Phänomene angesehen werden, bleibt von der biologischen Notwendigkeit eines realen Gehirns nichts weiter übrig. Ein künstliches Hardware-System ist für das davon separierbare Programm prinzipiell austauschbar. So wird auch für die menschliche ,,Informationsverarbeitung" eine künstliche Dichotomisierung zwischen Hard- und Software einzuführen versucht, die aber gerade für das Gehirn völlig unzutreffend ist, da sie untrennbar miteinander verwoben ist.
1.2.2 Die Definition und Funktion von Emotion
,,Die Psychologie hat sich nicht nur schwer daran getan, die Emotionen als legitimen Gegenstand der wissenschaftlichen Tätigkeit anzuerkennen, sondern auch damit, zu definieren, was denn nun Emotionen eigentlich sind" (Dörner, 1998, S.303).
Um Emotionen einerseits definieren zu können, andererseits aber auch seine Grundintention der Computation im Blick auf die angestrebte Handlungstheorie fruchtbar machen zu können, verwendet Dörner eine prozessuale Definition. Emotionen seien ,,bestimmte Modulationen psychischer Prozesse" und erfüllen damit die Funktion innerhalb des Systems, daß sie Denk-, Wahrnehmungs-, und Motivationsprozesse ,,in einer bestimmten Weise ablaufen" lassen (Dörner, 1994, S. 134).
Weiter sind Emotionen mit Verhaltensprädispositionen verbunden, Ärger z.B. mit Aggressionstendenzen, Angst mit Fluchttendenzen usw. Eine weitere Komponente ist die Lust-Unlust-Komponente, die wesentlich mit der aktuellen Bedürfnissituation verknüpft ist und in der die mit den Lust- und Unlustsignalen verknüpften Bedürfnisse als Auslöser für wichtige Emotionen angesehen werden.
Damit ist nun also der Inhalt und die Grundfunktion der Emotion für die weitere Untersuchung geklärt; der Aspekt des ,,Erlebens" wird gänzlich ausgeklammert, weil er natürlich in dieser methodologischen Vorgehensweise keinen Platz hat. Im Zentrum der Betrachtung steht also die Funktion der Emotion, nicht als eigenständiger Anteil am psychischen Geschehen, sondern als Modulationsparameter eines systemtheoretischen Modells: ,,Gefühle bestehen vielmehr im Kern darin, daß Denken, Wahrnehmen, Erinnern usw. in bestimmter Weise moduliert werden." Und am Beispiel des Ärgers bringt es Dörner noch klarer zum Ausdruck: ,,Der Ärger beeinflußt nicht mein Denken; vielmehr ist Ärger eine bestimmte Form des Denkens" (Dörner, 1994, S.138).
Die wesentlichen Merkmale der Emotionen liegen damit in ihrer Funktionalität, was in Hinsicht auf die Anpassungsleistung des Organismus an seine Umwelt einen wesentlichen Vorteil hat. Darin folgt Dörner der These von Hebb (1946), der eine Koevolution von Kognition und Emotion als evolutionärem Vorteil beim Menschen postuliert hatte. Die Modulationsfähigkeit der psychischen Prozesse durch die Emotionen wird damit zu einem erhöhten Selektionsvorteil des Menschen. So kann z.B. in einer Gefahrensituation die in den Emotionen enthaltene Verhaltensdisposition bewirken, daß von einer übermäßigen Internalisierung auf Externalisierung umgeschaltet wird. Mit einer erhöhten Aktivierung und der damit verbundenen häufigeren Auffrischungsrate des Umgebungsbildes kann dabei die Handlungssequenz für Gefahrenabwehr oder die Fluchttendenz sehr effektiv bereitgestellt werden.
Allerdings kann natürlich auch gerade die Modulation des Denkens durch Gefühle, wie sie Dörner in seinen Computerszenarien wie ,,Lohausen" (Dörner et al., 1983) beobachtet hat, eine negative Beeinflussung des Gesamtsystems bedingen. Wird z.B. das Selbstwertgefühl eines fiktiven Bürgermeisters einer Kleinstadt oder eines ,,Entwicklungshelfers" in Tanaland durch eine komplexe Problemlösesituation, die nicht bewältigt werden kann, bedroht, kann jemand noch mehr zu völlig irrationalen und ausschließlich selbstwertstabilisierenden Verhaltensweisen veranlaßt sein, und die Gesamtsituation der Aufgabe völlig aus den Augen verlieren. Solches Verhalten zeigt recht deutlich, welche Rolle den Emotionen bei der Bewältigung von Aufgaben oder Handlung ganz allgemein zukommt.
2.3 EMO - ein Computer mit Gefühlen
Die zentralen Konzepte, die bereits 1988 im Entwurf des Handlungsregulationsmodells wichtig waren, tauchen bei der Konstruktion von EMO wieder auf. EMO stellt nun das Modell dar, welches die Annahmen der Handlungsregulationstheorie in prüfbare Hypothesen in Form einer Computersimulation überführen soll und damit die Ergebnisse mit dem Handeln und Verhalten von Versuchspersonen oder real-life-Situationen vergleichbar macht. Zunächst sollen aber die für das Modell wichtigen »Konstellationsparameter« dargestellt werden:
- Wichtigkeit der aktuellen Motivation: sie stellt die ,,gewichteten Bedürfnisse" dar.
- Dringlichkeit: sie setzt zwei wesentliche Zeiten in Beziehung zueinander: a) die kalkulierte Zeit für die aktuelle Aufgabe und b) die dafür noch verbleibende Zeit.
- Unbestimmtheit: als die ,,Verzweigungen des Erwartungshorizontes"; mit der Anzahl der Entscheidungsmöglichkeiten wächst neben den ,,Freiheitsgraden" (und den positiven Möglichkeiten) natürlich auch die Möglichkeit der Gefährdung entsprechend an.
- Kompetenzgrad als ,,mittlere Erfolgserwartung" bei der Erledigung von Aufgaben und Problemen.
- Furcht / Hoffnung: als das ,,Ausmaß der erwarteten Bedürfniszustände" steht es dem Ausmaß der zu erwarteten Befriedigungsereignisse gegenüber.
- Bedürfnisdruck steht für die Summe der Wichtigkeiten der Motivationen.
Wie wirken nun die Konstellationsparameter und die als Emotion bezeichneten Modulationsformen zusammen? Abbildung 4 zeigt die Interaktionen, die für EMO als Grundlage dienen.
Abbildung 4: Konstellationsparameter und Modulationen; + bedeutet ,,je mehr ...desto mehr.." ,
- bedeutet: ,,je weniger ..., desto weniger ..." (modifiziert, nach Dörner, 1994).
EMO als ,,vergeistigte Dampfmaschine" (siehe Abb. 5):
Die Grundidee des Modells ist die einer ,,vergeistigten Dampfmaschine" und erinnert von daher auch wieder an die Vorstellungen von A.Turing, dessen Bestreben es war, eine vollständige Formalisierung des Begriffs ,,Maschine" zu erreichen (vgl. Penrose, 1991, a.a.O). Diese Dampfmaschine besteht nun aus einem Kessel, in dem Wasser erhitzt wird und in Form von Dampf durch ein System von Röhren strömt. Dabei werden Turbinen in Gang gesetzt, die wiederum bestimmte Räder und andere Mechanismen in Gang setzen, mit denen die Maschine sich bewegen kann, die Klappe des Wasserreservoirs öffnen und die Keule zur Selbstverteidigung bedienen kann.
Das ,,Geistige" der Maschine ist nun durch bestimmte »sensorische Neurone« und »Bedürfnisindikatoren« verwirklicht: mit Hilfe eines einfachen sensorischen Mechanismus können dabei Regenwolken identifiziert werden, die die notwendige Energie für die Maschine liefern. Eine Verbindung von Bedürfnisindikatoren und sensorischen Neuronen mit den ,,Motoneuronen", die die Bewegungsabfolge steuern, sichert das »intendierte Verhalten« der Maschine, indem es sie in die Lage versetzt, ihre Bedürfnisse zu erkennen, einen Handlungsplan zu konstruieren und die Befriedigung der Bedürfnisse zu erreichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dörner stellt sich dies so vor, daß die Maschine in die Lage versetzt wird, zunächst einfache Reiz- Reaktions-Strukturen zu erlernen: zunächst sind die Verknüpfungen zwischen dem sensorischen Input und dem motorischen Output nur ,,virtuell" vorhanden. Durch Befriedigungserlebnisse, die durch die Rückkehr einer Größe in ihren Sollwert entstehen, werden »Verknüpfungssignale« an bestimmte Netzwerke ausgesandt. Die Verbindung von sensorischem Input, Motoneuronenaktivität und der daraus resultierenden Bedürfnisbefriedigung wird als Reiz-Reaktions-Schema abgespeichert und dient damit zukünftig als Strategie der Bedürfnisbefriedigung. Darüber hinaus soll die Maschine auch eine Kette von sensorischen und motorischen Aktivierungen miteinander und mit einer speziellen Bedürfnisbefriedigung verknüpfen können, so daß aus dieser die Fähigkeit komplexe Verhaltensweisen zu erlernen entsteht.
Abbildung 5: Eine ,,vergeistigte" Dampfmaschine (nach Dörner, 1994)7. Weitere ,,geistige Fähigkeiten" der Maschine sind:
- ihre Fähigkeit zu »innerem Probehandeln«,
- die Bildung von Erwartungen,
- ein Bedürfnis, Schmerzen zu vermeiden oder zu lindern,
- Affiliation,
- Kompetenzstreben.
Die Fähigkeiten des inneren Probehandelns beziehen sich auf Situationen, in denen die Maschine keine für ihre Bedürfnissituation hilfreiche Verhaltenssequenz, die sie vom aktuellen Zustand zum angestrebten Zielzustand bringen könnte, vorfindet. Dann ,,versucht sie, die vorhandenen Ketten probeweise so zu rekombinieren, daß eine zielführende Kette dabei herauskommt. Wenn man akzeptiert, daß Denken ein »inneres Probehandeln« ist, ...dann kann unsere Dampfmaschine damit also denken." (Dörner, 1994, S.148).
Auch kann sie Erwartungen bilden, indem sie neue Ereignisse mit bereits gespeicherten Ereignisketten vergleicht: Aus der bekannten Sequenz von g-a-r-b-a-g-e kann sie von g-a-r-... eine Prognose für das Auftreten der bekannten Sequenz machen.
Bedürfnisse entstehen in Dörner's Maschine aus der Abweichung von Sollwerten, die für die Maschine wichtig sind.
Schmerzvermeidung entsteht durch exogene Reize, die mit bereits bekannten Reiz- Reaktionsmuster verglichen und aufgrund ihrer Ähnlichkeit oder Gleichheit als ,,schmerzhaft" antizipiert werden.
Das Bedürfnis nach Zusammensein mit anderen wurde der Maschine als periodisch entstehend eingegeben.
Aus der Erfahrung, daß Handlungen häufig nicht zum gewünschten Erfolg führen und auch durch inneres Probehandeln keine Bedürfnisbefriedigung erreicht wird, entsteht ein Defizit im Bedürfnis nach Kompetenz als einer notwendigen Wissensbasis über die ,,Welt". Wird dieses Bedürfnis nicht ausreichend befriedigt, entsteht ein Explorationsverhalten.
1.2.4 EMO-tionalität
Diese Fähigkeiten und Bedürfnisse, mit denen die Maschine jetzt ausgestattet ist, garantieren zwar ein einigermaßen kompetentes Funktionieren, aber die Emotionen, die darin als Modulationsparameter fungieren sollen, zeigen sich damit noch nicht. Wie kommen nun also die Emotionen in die Maschine oder: auf welche Beobachtungen hin können wir die Emotionalität von EMO überhaupt erkennen?
Dazu muß sich EMO nun in verschiedenen Umwelten ,,bewähren": eine jeweilige Umwelt wird mit Hilfe eines »Ereignisgenerators« erzeugt. Dabei werden hier vier verschiedene Umwelterfahrungen unterschieden: bedürfnisbefriedigende (,,positive") versus bedürfniserzeugende (,,negative") und hindernde versus fördernde Ereignisse. Auch für EMO ist die Umwelt in bestimmter Weise vorhersagbar und dazu erzeugt sie »Indikatoren«, die das Eintreten eines bestimmten Ereignisses in einer bestimmten Zeit ankündigen. Dies kann nun das EMO in einem Lernvorgang internalisieren und sich dann »Kompetenz« in einer bestimmten Umgebung erwerben. Dörner nimmt nun an, daß EMO's Grundbedürfnis darin besteht, die Umwelt zu veranlassen, positive und fördernde Ereignisse zu erzeugen, und daß es die negativen und hindernden vermeiden will.
An einem Beispiel kann man nun schrittweise nachvollziehen, wie EMO`s Aktivitäten entlang seiner Taktzyklen aussehen. Die x-Achse dient als Zeitachse und die y-Achse zeigt die Einzelaktivitäten des Systems. Die Aktivitätsleiste am unteren Rand zeigt, in welcher Stufe der Rasmussen-Leiter8 sich das System gerade befindet und welches Problemlösekonzept gerade angewandt wird, wobei die Stufe des ,,Explorierens" im Sinne von ,,Versuch und Irrtum" bei Rasmussen (1983) nicht vorkommt.
Abbildung 6: Das Verhalten von EMO.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Diagramm zeigt die Kurve ,,Zielapproximation", die Annäherung an das Ziel, das Sternchen bedeutet, daß das Ziel erreicht wurde. Emo's Geschichte beginnt nun also mit Hunger. Alles verläuft soweit in geregelten Bahnen, bis der Indikator für ,,Schmerz" auftaucht, der Emo's Aktivierungskurve ansteigen läßt, die Selektionsschwelle erhöht, die Auffrischungsrate ansteigen und die Laune deutlich absinken läßt. Die Tatsache, daß EMO's Kompetenz in Sachen Schmerzvermeidung nicht besonders hoch ist, zeigt sich nun auch darin, daß die Suche nach Eßbarem sofort durch die Motivation der Schmerzvermeidung ersetzt wird und alle Anstrengung darauf gerichtet erscheint. ,,Ein Beobachter mit dem entsprechenden Feingefühl für die Psychologie von Dampfmaschinen würde EMO »furchtsam« oder »ängstlich« nennen", (Dörner,1994, S.154) - so charakterisiert Dörner die Emotionen, die er aus den Modulationsparametern ableitet. Allerdings zeigt dieses Beispiel auch gut, wie nach der Zielerreichung der Schmerzvermeidung und -linderung die Parameter sich wieder schnell ändern und die Absicht das Hunger- und Durstbedürfnis zu befriedigen wieder Vorrang hat. Dies zeigt uns nun deutlich die ,,Emotionalität des EMO". Diese Konzeption von ,,Emotion" in Form der Modulation psychischer Prozesse stößt sicherlich bei Schmerz auf seine Grenzen: wesentlich bei Schmerz ist das Erleben eines Schmerzes, denn erst in dieser Empfindung und Bewertung als »etwas Schmerzhaftes« entsteht das Phänomen. Und es wird im 2.Teil der Arbeit gezeigt werden, (s.S.38 ff) wie Schmerz als ,,phänomenales Erleben" ein Phänomen der ,,ersten Person" ist. Die Tatsache, daß Dörner hier einen Mechanismus aus Reizen und Reaktionen und dessen Funktion im System als Schmerz bezeichnet täuscht die Erfassung eines Konstruktes vor, das sicherlich in dieser Weise nicht vollständig bestimmt werden kann. ,,Schmerz" ist nur insofern Schmerz , wie er von einem Subjekt, dessen Empfinden als schmerzhaft charakterisiert ist, erlebt wird. Diese Kritik trifft natürlich auch auf alle anderen ,,Emotionen" zu, die Dörner in seinem EMO-Modell als existent unterstellt: das Faktum, daß ein Parameter als Emotion bezeichnet wird und in ein Modell als wichtiger Modulationsparameter eingeht, bedeutet für das Erleben von Gefühlen ja noch überhaupt nichts. Hier liegt sicherlich der Hauptansatz für die Kritik an Dörner's Vorstellungen und an EMO als Modell für Emotion.
1.2.5 EMOs in verschiedenen Umwelten
Um einen möglichen Vergleich mit echten Versuchspersonen anstellen zu können, werden nun 50 EMO's in jeweils »böse« (,,maligne") oder »gute« (,,benigne") Umwelten gesetzt, denen sie 1000 Zeittakte ausgesetzt sind. Die EMOs sind bei der »Geburt« identisch und ändern sich jeweils individuell durch ihrer Erfahrungen. Wie unterscheiden sich nun aber die EMOs in den zwei unterschiedlichen Bedingungen?
Auffällig ist, daß die EMOs in der malignen Umwelt mehr lernen, vor allem problemspezifischer als in der benignen Umwelt. Sie scheinen dazu eher motiviert zu sein, um sich in einer weniger vorhersagbaren und wenig stabilen Umwelt zurechtzufinden. Die EMOs der benignen Umwelt haben dagegen die Zeit, in langen ungezielten Explorationsphasen zu ,,spielen", sie sind wenig genötigt, sich an Problemlösungen zu versuchen. Erstaunlich ist jedoch, daß sich die EMOs der malignen Umwelt wohler fühlen als diejenigen in der benignen. Eine Erklärung dafür könnte in der größeren Anzahl der Bedürfnisse und die ,,Berechnung" der Lustbilanz, die vom Ausmaß der Bedürfnisstärke abhängt, liegen. Der Aufwand für die EMOs der benignen Umwelt war im Vergleich dazu wesentlich geringer, also auch die Lustbilanz.
Ein weiterer interessanter Befund ist der, daß man bei gefühlskalten EMOs, bei denen die Modulati- onsparameter konstant gehalten wurden, ein deutlich niedrigeres Leistungsniveau messen kann als bei emotionalen. Dies scheint für Dörner die Koevolutions-These von Hebb nochmals zu bestätigen, die ja annimmt, daß Emotionen auch einen evolutionär entwickelten Selektionsvorteil darstellen und sich gemeinsam mit den kognitiven Fähigkeiten des Gehirns entwickelt haben.
1.2.6 EMOs und Emotionen
,,Die EMOs zeigen Emotionen" (Dörner, 1994, S.159). Auch wenn sie keine komplexen Emotionen wie Liebe oder Trauer zeigen, haben sie doch in dem Sinne Emotionen, daß sie sich verhalten, als hätten sie solche. Das heißt: aus ihren Verhaltensweisen, den durch gewisse Annahmen und aufgrund bestimmter Berechnungsformeln erzeugten Kurven entnehmen wir, daß EMOs ,,Gefühle zeigen". Aber: und das muß auch Dietrich Dörner natürlich einräumen, es fehlt ihnen die Möglichkeit, die Emotionen zu erleben, und in diesem Sinne haben sie natürlich auch keine Emotionen. Nun gehört aber zu den elementarsten Fähigkeiten des Menschen dies, daß er sich selbst als handelnd, denkend und emotional erlebt. Eine Trennung von Subjekt-Sein und quasi-objektivem Betrachten der eigenen Gefühle findet ja oftmals bei intensiv erlebten emotionalen Zuständen gar nicht mehr statt, da ,,bin" ich meine Trauer, meine Freude, mein Zorn, ich ,,habe" sie nicht nur.
Darin liegt also der wesentliche Unterschied zwischen der Emotionalität der EMOs und der von Menschen, auch wenn Dörner natürlich weiter an seiner EMO-tionalität weiterforschen will.
1.2 EMOREGUL - ein Simulationsprogramm
In diesem Text, der als Memorandum des Lehrstuhls II des Psychologischen Institutes in Bamberg herausgegeben wurde, wird nun eine noch stärker formalisierte Darstellung und eine mathematische Beschreibung von EMOEGUL gegeben (vgl. Dörner et al., 1996). Innerhalb der umfassenden PSI-Theorie der Handlungsregulation, die auch in einem weiterführenden PSI-Projekt 9 weitergeführt stellt EMOREGUL10 einen als Computersimulation realisierten Teilbereich der Handlunsgstheorie dar und führt damit das Konzept von 1988 in logischer Weise fort.
,,Die Theorie erlaubt es, das Handeln und Erleben von Menschen in komplexen Realitätsbereichen zu erklären und vorauszusagen. (...) Die Theorie wird in die Form eines Computerprogramms gebracht, damit die Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit der Theorie geprüft werden kann" (PSI-Homepage, S.1), so wird forsch auf der PSI-Homepage11 das Projekt und sein ehrgeiziges Ziel beschrieben. Eine weitere und ausführlichere Diskussion der theoretischen Grundlagen und der Einbettung der Handlungstheorie in die umfassendere Methodologie der psychologischen Theoriebildung finden wir später in Hille und Bartl (1997) und es soll dann dort auf diese Fragen genauer eingegangen werden.
Mit EMOREGUL sollen folgende Fragen geklärt werden als Anforderungen an eine ,,Theorie des Mehrfachhandelns" in komplexen, dynamischen Umfeldern (vgl. Dörner et al., 1996, S. 4):
- Wie setzen sich Menschen in Abhängigkeit von ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten und in Abhängigkeit von Umgebungs- und Situationsmerkmalen Ziele?
- Wie entscheiden sich Menschen in einer konkreten Situation für eines von zahlreichen Zielen?
- Wie und warum gehen Menschen zur Erreichung ihrer Ziele in bestimmtes Weise vor und wie passen sie dabei das Planen, Tun und Explorieren der jeweiligen Situation an? Einige der in dem Memorandum Nr.2 stärker formalisierten Aspekte möchte ich hier noch darstellen (ohne auf die mathematische Darstellung der einzelnen Parameter, wie sie im zweiten Teil dieses Textes ausgeführt wird, einzugehen):
Anhand der Geschichte von Rotkäppchen erzählen uns die Autoren in lockerer Weise, wie denn in EMOREGUL ein Bedürfnis, welches den Ausgangspunkt des Programms ausmacht, zu einem Motiv und schließlich zu einer Handlung und einer daraus resultierenden Stimmung führt.
Bedürfnisse stellen dabei die ,,Indikatoren für Ungleichgewichte" dar und sind mit einer grundlegenden Intention des Systems verbunden, Bedürfnisbefriedigung anhand der Reduzierung von Sollwertabweichungen zu erreichen (vgl. Dörner et al., 1996, S.4 f.). Motive werden aus Bedürfnissen erzeugt, wenn diese eine gewisse Stärke haben. Ein Schwellenwert reguliert dabei in Abhängigkeit von der Wichtigkeit der schone existierenden Motive, wann aus einem Bedürfnis ein Motiv wird.
Die Auswahl der Motive, aus welchen für eine Zeitspanne ein handlungsleitendes Motiv wird, erfolgt nach drei Kriterien:
- der Wichtigkeit des Motivs: die Größe der Sollwertabweichung,
- der Dringlichkeit eines Motivs als Vergleichsprozeß der Zeiten für die Verwirklichung des Motivs und der für die Erledigung des Motivs noch verbleibenden Zeit,
- und der Fähigkeit zur Befriedigung des Bedürfnisses.
Diese drei Faktoren bewirken - multiplikativ miteinander verknüpft - den ,,Auswahldruck eines Motivs". Dies trifft allerdings nur für das handlungsleitende Motiv zu, für alle anderen wird bei der Berechnung ein Modulationsparameter verrechnet, der eine sog. laterale Inhibition bewirkt und die Wichtigkeit der anderen Motive für eine bestimmte Zeit herabsetzt. Bedürfnisbefriedigung wird durch eine strukturierte Aktivität in EMOREGUL gewährleistet: es muß dabei eine Entscheidung gefällt werden, welche von drei grundlegenden Möglichkeiten des Handelns gewählt werden sollen. Die Entscheidung darüber wird aufgrund der Erfahrung des Systems und bestimmter Merkmale des Plans gefällt. Ein guter Plan und reichlich Erfahrung wird damit eher zu direktem Tun führen als ein ungenauer Plan.
Dem System stehen damit drei Möglichkeiten des Handelns zur Verfügung (vgl. Dörner et al., 1996, S. 10 ff.):
- Explorieren: um Erfahrungen zu sammeln und ein gewisses Maß an Wissenselementen zur Verfügung zu haben, wird das System, solange es für ein bestimmtes Problem keine Lösungsmöglichkeiten hat, ungezielt explorieren. Dabei kann auf dem Hintergrund von gemachten Erfahrungen und Wissen schneller neues Wissen akkumuliert werden. Diese Strategie hängt (wie so vieles in einem komplexes System) wiederum von anderen Parametern ab:
- vom Auflösungsgrad der Betrachtungsweise, ob etwas oberflächlich oder sehr detailliert betrachtet wird; er hat Einfluß, auf die Menge, die gelernt wird;
- von der Aktiviertheit (AROUSAL), also dem Maß, wieviel Energie eingesetzt wird;
- von der Abtastrate, mit der die Umgebungsbedingungen - der Hintergrund, vor dem die fokussierte Handlung stattfindet - pro Zeiteinheit einbezogen werden.
- Planung als Verknüpfung von bereits bekannten Operatoren zu neuen Operatorketten. Dadurch erhöhen sich zwei Parameter, die als Ausmaß und Güte eines nicht näher spezifizierten Planes bezeichnet werden. Diese sind wiederum abhängig
- vom Auflösungsgrad der Betrachtung: je größer die Auflösung, desto langsamer verläuft die Planung;
- von der Abtastrate: je mehr Aufmerksamkeit für die Umgebungsbetrachtung aufgewendet wird, desto weniger bleibt für die Planungsaktivität übrig;
- vom Ausmaß der Erfahrung zur Befriedigung der Bedürfnisse;
- von der heuristischen Kompetenz, als einer Fähigkeit, des Wissens wie man zu Wissen kommt.
- Agieren (Tun), als eigentliches Ausführen einer Handlung: dabei wird ständig überprüft, ob das Ziel bereits erreicht wurde, wenn nicht wird neu entschieden, ob durch Explorieren, Planung oder Tun dies erreicht werden kann.
Zielerreichung führt dabei zu ,,Freude", indem es in EMOREGUL den zentralen Lustpegel erhöht und damit die ,,Stimmung" des Systems wiedergibt. Drei wesentliche Elemente veranlassen EMOREGUL, ,,sich zu freuen", deren Gegenteil, läßt das System Unlust empfinden:
- Bedürfnisbefriedigung vs. unbefriedigte Bedürfnisse,
- Erfüllte Erwartungen vs. Unbestimmtheit,
- ,,Hoffnungen" (antizipierte Befriedigungserlebnisse) vs. ,,Furcht".
Je mehr Lust EMOREGUL ,,empfindet", desto höher ist das Ausmaß seines Kompetenzempfindens.
Die Idee der Autoren, die PSI-Theorie um ein weiteres Konzept zu erweitern, wird durch die Leistungen des Systems, das nun auf diese Weise implementiert wurde, als bestätigt angesehen (vgl. Dörner et al., 1996, S.19 f):
1. Das System besitzt eine autonome Zielsetzung, es entscheidet selbständig, welches Motiv aktuell bearbeitet werden soll (allerdings sind natürlich die Motive als Basisvariablen vorgegeben).
2. Auch die Wahl der Bearbeitungsform trifft EMOREGUL selbst, indem es zwischen Planung, Explorieren und Tun auswählt.
3. Das System ist fähig, sich an eine vorgegebene Umwelt anzupassen: es moduliert sein Handeln selbst (und erzeugt damit die Emotionalität).
Die Basisfähigkeiten, die dazu in das System eingebaut wurden, sind:
1. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung einer Sollwertabweichung und damit zur Identifikation der Bedürfnisse.
2. Die Fähigkeit, die Umgebung als gegenwärtige Zustände wahrzunehmen und die Antizipation von zukünftigen Ereignissen aufgrund von Erwartungen^.
3. Die Fähigkeiten, sensorische Schemata zur Identifikation von Sachverhalten auszubilden, Lernvorgänge abzuspeichern und dadurch Verhaltensprogramme zu erwerben. Zum einen geschieht dies durch Speicherung erfolgreicher Verhaltensweisen, zum andern durch Planen in Form von ,,innerem Probehandeln". 1.4 Von Dampfmaschinen und künstlichen Seelen mit Temperament12
Die Darstellung der PSI-Theorie, wie sie in diesem Text von Katrin Hille und Christina Bartl (1996) dargestellt wird, zeigt im Vergleich zu den übrigen Darstellungen wohl die am weitesten entwickelte theoretische Reflexion über die grundlegenden wissenschaftstheoretischen Fragen, die mit der Modellbildung und Simulation verbunden sind. In dieser Weise hebt sie sich auch von den Darstellungen Dörners ab, der die Grundfragen wenig problematisiert und sehr auf die Funktionalität seines Konzeptes zentriert ist.
1.4.1 Fragestellung und Begründung einer systemtheoretischen Beschreibung
p>Psychische Prozesse sind solche, die ein hohes Maß an Dynamik, Vernetztheit und Intransparenz aufweisen. Die psychologischen Theorien, die zur Beschreibung und Erklärung dieser Phänomene herangezogen werden, weisen meist wesentlich einfachere Strukturen auf und sind demnach auch kaum in der Lage, komplexe Interaktionen zwischen psychischen Phänomenen ihrem Gegenstand entsprechend darzustellen. Dies soll nun aber mit der PSI- Theorie und deren Umsetzung als Computersimulation EMOREGUL unternommen werden.
Das Problem der Intransparenz zeigt sich dabei als die grundlegende Schwierigkeit, neben den beobachtbaren Wahrnehmungsphänomenen und den resultierenden Verhaltensweisen die Abläufe in der ,,black-box" sinnvoll zu beschreiben. Psychologen wie Skinner haben daraus die Konsequenz gezogen, sich damit überhaupt nicht zu beschäftigen. Wenn man sich nun aber mit diesen Verarbeitungsprozessen, die zwischen dem Beobachtbaren und hinter den Phänomenen stehen, beschäftigt, so muß eine Theorie diesem Gegenstand angemessen sein. Dies führt die Autorinnen dazu, die systemtheoretische Beschreibung im Gegensatz zu einer als positivis- tisch klassifizierten Erklärungsweise in der Psychologie zu favorisieren. War die positivistische Methodik lange Zeit als gültige Methode anerkannt, die in Form von induktiven Verfahren zu einer Theorie gekommen ist, so muß doch, spätestens seit der Idee von Karl Popper's Falsifikationsprinzip, die psychologische Theoriebildung neu überdacht werden. Die hier als positivistisch bezeichnete Form psychologischer Theoriegewinnung geht zunächst von empirischen Befunden aus (und sollte deshalb auch genauer als Empirismus bezeichnet werden) und kommt danach über Kovariationen zu Zusammenhängen in Form von ,,wenn-dann-Aussagen". Der Vorteil liegt dabei auf der empirischen Fundierung der Theorie, der Transparenz ihrer Methodik und der prinzipiellen Wiederholbarkeit der Untersuchungen. Im Gegensatz dazu kommt aber der kritische Rationalismus Poppers zu dem Ergebnis, daß eine Theorie niemals auf induktivem Wege beweisbar sein kann. Theorien sollten fortan durch die Suche nach den ihren Hypothesen widersprechenden Ergebnissen falsifiziert werden. Solange dies nicht der Fall ist, können sie als vorläufig bewährt gelten. In dieser Tradition suchen nun Hille und Bartl die Vorzüge einer systemtheoretischen Beschreibung darzustellen, deren Vorgehensweise zwar nicht in allen Punkten der empiristischen Methodik widerspricht, aber doch deutlich andere Schwerpunkte legt. Wenn nun versucht werden soll, eine Beschreibung menschlicher Motivation oder Handlung zu geben, so haben wir bereits aus den Entwicklungen der PSI-Theorie gesehen, mit welchem komplexen Interaktionsgefüge eine solche Beschreibung einhergeht. Ich möchte hier die einzelnen Abläufe der Handlungsregulation nicht noch einmal beschreiben, da dies zur Genüge in den Abschnitten zuvor geschah. Wenn aber nochmals resümierend aufgezeigt werden soll, welche Merkmale eine solche Beschreibung hat, kann man folgendes herausstellen (vgl. Hille und Bartl, 1997, S.11f.):
- Eine systemtheoretische Beschreibung findet auf einer abstrakten Ebene der Prozesse statt.
- Es wird von allen ,,materialqualitativen Gegebenheiten" abstrahiert, allein die Informationsverarbeitungsprozesse werden als relevant betrachtet und mit ihnen werden Variablen und deren Funktionen beschrieben.
- Die vernetzte Struktur und die Interaktionen zwischen den relevanten Variablen stellt damit die Theorie in einer systemtheoretischen Betrachtungsweise dar.
Damit wird also eine Methodik favorisiert, die es ermöglicht, die drei für psychologische Prozesse relevanten Eigenschaften der Dynamik, Vernetztheit und Intransparenz zu beschreiben. Durch die Umsetzung der theoretischen Annahmen in die formale Sprache eines Computerprogramms wird es möglich, die Abläufe des Systems in Form einer Computersimulation darzustellen. Dies kann als ein Modell die psychischen Phänomene darstellen und auf der Suche nach deren Regelhaftigkeit wertvolle Dienste leisten.
Eine solche Simulation hat gegenüber realen Versuchspersonen auch einen ,,gewichtigen Vorteil": um die zugrundeliegenden Mechanismen zu verstehen, braucht man sich nur die einzelnen Prozeduren anschauen; ,,neurochirurgische Eingriffe" oder ,,genetische Veränderungen" bei den ,,Versuchspersonen in silicio" sind ebenfalls ohne ethische Bedenken möglich.
1.4.2 Überprüfungsmöglichkeiten für Computersimulationen anhand der Überprüfung des Modulationsparameters Aktiviertheit
Der Kritik an der positivistischen Methodik und ihrer Verifizierung war natürlich auch die Vorgehensweise der Überprüfung von Theorien ausgesetzt. War es bei solchen Theorien immer nur möglich, Einzelhypothesen zu prüfen und damit ,,Bruchstücke von Theorien, losgelöst von ihrer Einbettung in eine Gesamttheorie" (Hille und Bartl, 1997, S.15) zu betrachten, so gibt uns die Computersimulation nun die Möglichkeit, die Ergebnisse der Theorie als ein Ganzes zu überprüfen, indem wir die Verhaltenssequenzen von EMOREGUL nachvollziehen und sie mit denen von menschlichen Versuchspersonen zu vergleichen. Denn mit der Zerlegung einer Theorie in prüfbare Einzelbestandteile gehen oftmals auch Interaktionswirkungen verloren und dies kann zu falsch positiven wie falsch negativen Ergebnissen führen.
Diese Einwände und Argumente, die uns die Autorinnen gegen eine ,,elementaristische" Form der Psychologie damit aufzeigen, scheinen mir eines der Fundamentalprobleme der Psychologie anzusprechen. Und es muß bei aller empirischen Prüfung die Frage nach dem, was dabei überprüft werden soll, zur Sprache kommen, um nicht valide Daten von völlig belanglosen Zusammenhängen zu erzeugen.
Will man nun aber die Plausibilität einer solchen systemtheoretisch-orientierten Theorie überprüfen, muß man feststellen, daß dies fast völlig unmöglich ist, da solche komplexen Theorien durch Nachdenken allein nicht mehr auf ihre Stimmigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen sind. Aus diesen Erwägungen geben die Autorinnen nun vier Wege an, die einen Vergleich des Modells mit der Realität ermöglichen.
1. Die Prüfung auf interne Plausibilität;
2. Prüfung auf externe Kompatibilität;
3. Prüfung auf strukturelle Ähnlichkeit zwischen Modell und Realität;
4. Prüfung auf Übereinstimmung zwischen Modellverhalten und natürlichem Verhalten.
Die erste Prüfungsmöglichkeit entspricht noch der traditionellen Art, die einzelnen möglichen Beziehungen zwischen den Variablen nachzuvollziehen. In Bezug auf EMOREGUL bedeutet dies, daß versucht wird, die einzelnen Berechnungsvorschriften genau zu betrachten und die Abläufe möglichst in eine verständliche Alltagssprache zu übersetzen, um damit Unstimmigkeiten zu erkennen. Im nächsten Abschnitt wird dazu ein Beispiel gegeben. Die zweite Möglichkeit, die Prüfung der externen Kompatibilität, versucht aufgrund anderer Theorien, die sich auf denselben Realitätsbereich beziehen, Widersprüche oder Übereinstimmungen zu entdecken. Dazu werden solche Theorien auch in Form von Computersimulationen nachzubilden versucht. Dadurch, daß die Konstellationen, wie sie in anderen Theorien vorgefunden wurden, durch bestimmte Parameterveränderungen innerhalb des Systems nachgebildet werden, kann man die Ergebnisse vergleichbar machen und so Evidenz für die eigene Theorie möglich machen.
Die dritte Form der Überprüfung versucht zu ermitteln, ob die ,,innere Struktur des Modells mit der Struktur der Wirklichkeit übereinstimmt" (Hille und Bartl, 1997, S.18). Eine Annäherung an dieses, für die Psychologie unmögliche, Unterfangen wird durch die Beachtung der Systemränder erreicht, d.h. es werden jeweils Input- und Outputsequenzen miteinander verglichen. Dies ist natürlich u.U. sehr trügerisch, da die Übereinstimmung der Input- und Outputsequenz über den Mechanismus, der diesen zugrunde liegt, noch nichts aussagt.
Aussagekräftiger ist es vielmehr, Entstehungsbedingungen für natürliches Verhalten in ein synthetisches System einzugeben und zu beobachten, ob die Reaktion dem erwarteten Verhalten entspricht. Eine Übereinstimmung kann sehr wohl als Indiz dafür gewertet werden, daß eine Homomorphie, eine Strukturgleichheit, zwischen dem künstlichen und dem natürlichen System vorliegt. (Hille und Bartl, 1997, S.18)
Zuletzt gibt es noch die Möglichkeit des Verhaltenstests. Dabei wird das ,,künstliche Verhalten" des Systems mit natürlichem Verhalten verglichen, wobei allerdings meist solange keine Überprüfung stattfindet, wie das Verhalten des Systems als plausibel erscheint. Dies Methode hängt zudem stark von einem externen Beobachter und dessen ,,Weltbild" ab; da gibt es sicherlich erhebliche Unterschiede von Beobachter zu Beobachter.
Zusammenfassend kann aber keine dieser Methoden für sich genommen die Richtigkeit einer Theorie überprüfen, sondern die Kombination der vier Möglichkeiten ergibt ein sinnvolles Kriterium für die Plausibilität der Theorie. Zwei Beispiele sollen diese allgemeinen Prinzipien verdeutlichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei der Erstellung der mathematischen Formeln für die Modulationsparameter wurden diese auf ihre interne Plausibilität überprüft. Am Beispiel der Aktiviertheit soll dieser Prozeß nun etwas transparent gemacht werden. Die Aktiviertheit des Systems berechnet sich aus dem Quotienten der Wichtigkeiten aller erzeugten Motive und der Anzahl der realisierten Bedürfnisse (siehe Formel 1).
Formel 1: Berechnungsformel für die Aktiviertheit, realisiert als der logarithmierte Wert der Stärke aller generierten Motive.
Das anatomische Korrelat dieses synthetischen Konstruktes ist das ARAS, das aufsteigende retikuläre Aktivationssystem, welches im menschlichen Organismus die Aktiviertheit reguliert. Wenn nun der Organismus aufgrund einer erschreckenden Umgebungssituation in einen Zustand erhöhter Aktivierung versetzt wird, steigt diese Kurve entsprechend an. Die EMOREGUL-Aktivierung sollte also entsprechend genauso ansteigen und tut dies auch. Allerdings findet sich nun nach einem Schreck kein abruptes Absinken dieser Aktivierung, sondern das ARAS bleibt noch eine zeitlang aktiv und paßt sich langsam der neuen Situation an. Dies läßt sich allerdings mit der obigen Formel nicht darstellen. Die Kurven der einzelnen Formeln sind zusammen in der Abbildung 7 dargestellt. Damit nun diese Option im System zustande kommen kann, wird die Formel verändert, siehe Formel 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Formel 2: Modifikation I: Berechnung der Aktivierung in Abhängigkeit vom vorausgegangenen Takt.
Der Einfluß des vorangehenden Ereignisses wird nun also im Vergleich zum aktuellen zweifach gewichtet und geht so in die Berechnung der Aktivierung ein. Wenn nun diese Aktivierung dargestellt wird, zeigt sie den für die Anfangsphase typischen steilen Anstieg allerdings nicht mehr: eine derart langsame Aktivierung könnte dem Organismus allerdings sehr schnell sein virtuelles Leben kosten, deshalb muß diese Berechnungsformel noch einmal verändert werden. Formel 3 zeigt nun, wie beide Effekte, der des steilen Anstiegs und der des langsamen Abklingens,miteinander vereinbart werden. Die ,,Künstliche Seele" ist nun mit einem dem ARAS entsprechenden Aktivierungssystem ausgestattet, dessen Funktion nun durch die Berechnungsvorschrift in EMOREGUL realisiert wurde.
Dies zeigt die Notwendigkeit einer Plausibilitätsprüfung recht deutlich auf, aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, mit denen das System an ein reales System eines Organismus angepaßt werden kann. Die Schwachstellen des Simulationsprogramms werden dabei deutlich, wenn versucht wird, die Berechnungsvorschriften und Abläufe in EMOREGUL in möglichst verständliche Verhaltensbeschreibungen zu übertragen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Formel 3: Modifikation II: Berechnungsvorschrift für die Aktiviertheit, welche einen schnellen Anstieg mit einem allmählichen Abfall vereint.
Die Abbildung 7 zeigt nun noch einmal alle Phasen der Modulation der Berechnungsformel in Form der daraus resultierenden Diagramme auf.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Die urprüngliche und die modifizierten Berechnungen für die Aktiviertheit im Vergleich.
1.4.3 Die Implementation der Temperamente
Eine weitere Überprüfungsmöglichkeit der Plausibilität der Simulation liegt in der externen Kompatibilität, also in der Evidenz, die sich aus der Implementierung einer empirisch überprüften Theorie ergibt, wenn diese auch als Computersimulation realisiert wird. Es ergab sich daraus die Frage, ob es möglich ist, eine, der Eysenck'schen Persönlichkeitsauffassung entsprechende, Persönlichkeitsstruktur durch Simulation zu generieren und damit die Plausibilität der zugrundeliegenden Berechnungen zu zeigen. Ebenso war es natürlich spannend zu sehen, ob die EMOs sich entsprechend der Eysenck`- schen Auffassung in verschiedene Charaktere einteilen lassen würden.
Eysenck geht dabei von zwei jeweils gegensätzlichen Typen von Menschen aus: den Introvertierten als gegensätzlich zu Extravertierten und den Labilen als gegensätzlich zu Stabilen. Mit den vier Typen, die schon aus dem Altertum bekannt waren und von Hippokrates als die vier grundlegenden Temperamente bekannt waren, läßt sich die Eysenck'sche Einteilung zu dem Schema in Abbildung 8 verbinden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Die Eysenckschen
Persönlichkeitsdim ensionen und deren Verknüpfung mit den Temperamenten (nach Hille und Bartl, 1997). Die Beschreibung der Typen könnte nun folgendermaßen aussehen:
- Choleriker als labil und extravertiert,
- Sanguiniker als stabil und extravertiert,
- Phlegmatiker als stabil und introvertiert,
- Melancholiker als labil und introvertiert.
Aus den empirischen Untersuchungen von Larsen und Ketelaar (1991) war bekannt, daß Extravertierte und Introvertierte verschieden auf positiven und negativen Affekt reagieren, also auf die Induktion einer Stimmung anders reagieren. Die Ergebnisse der Untersuchung ergaben, daß
1. extravertierte Vpn im Vergleich zu Introvertierten eine ,,erhöhte Empfänglichkeit für positiven Affekt nach der Induktion der positiven Stimmung aufwiesen" (nicht aber nach Induktion von negativer Stimmung),
2. ,,die labilen Vpn im Vergleich zu den stabilen eine erhöhte Empfänglichkeit für negativen Affekt, insbesondere nach der Induktion der negativen Stimmung aufwiesen.
,,Vereinfacht gesagt: Auf Extravertierte wirkt Positives positiver als auf Introvertierte; Negatives wird aber gleich bewertet. Und: Der Labile sieht die Welt, besonders die Schattenseiten, negativer als der Stabile" (Hille und Bartl , 1997, S.25).
Wenn nun EMOREGUL ein Simulationsprogramm ist, mit dem menschliches Verhalten ganz allgemein erklärt werden kann, so sollte es auch in der Lage sein, diese Fähigkeit zu entwickeln, oder besser gesagt, seine Persönlichkeitsstruktur durch entsprechendes Verhalten zu offenbaren.
Da EMO allerdings bisher nur ein ,,Durchschnitts-EMO" war, stellte sich die Frage: wie es möglich sein könnte, solche Unterschiede zu erzeugen?
Unterschiedliche Verarbeitung von positiven und negativen Reizen führt zu unterschiedlichen Persönlichkeiten, so war die Auffassung von Larsen und Ketelaar. Also müßte EMO auch durch eine unterschiedliche Strategie der Verarbeitung von äußeren Reizen persönlichkeitstypische Ausprägungen erhalten. Aber wie sollen wir ein EMO nun als ,,sanguinisch", ,,cholerisch" oder ,,melancholisch" einordnen und wie könnte EMO überhaupt solche Persönlichkeiten erzeugen?
Wir müssen uns das Verhalten von EMO hinsichtlich Extraversion und Stabilität genauer anschauen (vgl. Hille und Bartl , 1997, S.27f.):
Die aktuelle Kompetenz und das Empfinden dieser Kompetenz spielt eine wichtige Rolle, denn sie bestimmt wesentlich die Auswahl des handlungsleitenden Motives in EMO. Kompetenz finden wir in zwei verschiedenen Formen:
a) als epistemische Kompetenz, die aus den Erfahrungen von EMO in verschiedenen Situationen besteht, (Faktenwissen) und
b) der heuristischen Kompetenz, die angibt, wie sich EMO aufgrund seiner Problemlösestrategien in der Lage fühlt, auch zukünftige Probleme zu meistern.
Damit stellt also das Kompetenzempfinden ,,ein Speicher für Lust- und Unlustereignisse" in EMO dar. Immer, wenn etwas Positives oder Negatives in der Umgebung von EMO auftaucht, wird dies in Form von Bedürfnisbefriedigungserlebnissen (positive Empfindung) oder Bedürfnisentstehung (negative Empfindung) dem aktuellen Kompetenzempfinden hinzugefügt und bestimmt dessen Wert.
Man kann nun aus diesen knappen Ausführungen bereits die Idee der Berechnung des Kompetenzempfindens absehen, Formel 4 stellt die Berechnung für die aktuelle Kompetenz dar:
Kompetenzempfinden = Kompetenzempfinden + (Lust x KOMPLUST) + ...
Kompetenzempfinden = Kompetenzempfinden - (Lust x KOMPUNLUST) -
Formel 4: Die Berechnung des Kompetenzempfindens aus den Lust- und Unlusterlebnissen mit den Gewichten KOMPLUST und KOMPUNLUST.
Die Kompetenz berechnet sich als Summe der Einzelereignisse, wobei diese jeweils mit den entsprechenden Gewichtungen KOMPLUST und KOMPUNLUST in die Summe eingehen. Damit hat man nun Parameter, deren Änderung die Unterschiede hinsichtlich Extraversion und Labilität möglich machen: der Parameter KOMPLUST bestimmt hierin die Sensibilität gegenüber positiven Reizen, der Parameter KOMPUNLUST die Sensibilität gegenüber negativen Reizen.
Dem Extravertierten wird im Vergleich zu dem Introvertierten eine erhöhte Empfänglichkeit für positiven Affekt zugeschrieben. Die introvertierten Temperamente sollen demnach durch eine geringe Sensibilität gegenüber Positivem (ein niedriges KOMPLUST), die extravertierten durch eine hohe Sensibilität gegenüber Positivem (ein hohes KOMPLUST) simuliert werden. Dem Labilen wird im Vergleich zu dem Stabilen eine erhöhte Empfänglichkeit für negativen Affekt bescheinigt. Die stabilen Temperamente sollten also durch eine geringe Sensibilität gegenüber Negativem (ein niedriges KOMPUNLUST), die labilen durch eine hohe Sensibilität gegenüber Negativem (ein hohes KOMPUNLUST) simuliert werden (Hille und Bartl, 1997, S.28).
In Tabelle 1 sieht man nun die Konstruktionsbedingungen für die einzelnen EMOs als Persönlichkeitstypen (in dieser Form natürlich immer Prototypen, in denen die reale Persönlichkeit idealtypisch gezeichnet ist).
Damit haben wir nun eine Möglichkeit, Temperamente zu erzeugen, wir brauchen allerdings nun noch die Möglichkeit, in EMOs Verhalten die Parameter den einzelnen Persönlichkeitstypen zuordnen zu können, um die einzelnen EMO-Typen zu identifizieren. Dazu müssen wir wieder auf die Beschreibungen der Extraversion und Stabilität zurückkommen, um hier ein Kriterium zu finden, welches die Persönlichkeitstypen charakteristischerweise unterscheidet. Dieses findet sich in der Spontaneität des Handelns, welches den Extravertierten auszeichnet, wo hingegen der Introvertierte eher längere Planungsphasen hat und erst dann handelt. In der Möglichkeit von EMO, ein Motiv in drei Grundversionen abzuarbeiten, findet sich dieses Konstrukt auch in EMOREGUL. Es gibt
- die Möglichkeit, zu handeln (wahrscheinlich bei hoher Kompetenz und vollständigem Plan),
- zu planen (wahrscheinlich bei hoher Kompetenz und fehlendem Plan),
- zu explorieren (wahrscheinlich bei niedriger Kompetenz).
Tabelle 1: Die einzelnen Temperamente und ihre Konstruktionsbedingungen (nach Hille und Bartl, 1997).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Als Operationalisierung dieses Konstruktes wird nun diejenige Zeit, in der EMO plant oder exploriert (Planung und Vorbereitung) der Zeit gegenübergestellt, in der EMO tatsächlich handelt. Dies ergibt nun das Maß, in dem sich Extraversion von Introversion unterscheiden läßt.
Schwieriger ist dies allerdings bei der Unterscheidung zwischen Labilität und Stabilität. Hier soll der mittlere Bedürfnisdruck als Maß genommen werden. Labilität ergibt sich dabei aus der Anzahl unbefriedigter Bedürfnisse und damit der Summe der Sollwertabweichungen der Bedürfnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn EMO dagegen in der Lage ist, seine Bedürfnisse weitgehend zu befriedigen, resultiert daraus Stabilität des Gesamtsystems. Jetzt sind wir also in der Lage, die operationalen Konstrukte in EMOREGUL zu simulieren und die Reaktionen von EMO zu beobachten.
Das Experiment wurde nun mit jeweils zehn entsprechend eingestellten EMOs durchgeführt und die Ergebnisse sind in Tabelle 2 unten dargestellt:
Tabelle 2: EMOs Verhalten, gemittelt über je 10 Simulationen hinsichtlich der temperamentsrelevanten Parameter (nach Hille und Bartl, 1997).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Damit läßt sich nun zwar kein völlig eindeutiges Bild der Typen zeichnen, weil die Operationalisierungen nicht in allen Punkten den, sehr heterogenen Konzepten in Eysencks EPI gerecht werden, und zudem die Variable für Extraversion mit der Variablen Bedürfnisdruck eine signifikante Interaktion in einer Varianzanalyse zeigt. Dennoch kann man den EMOs wohl so etwas wie ,,Temperament" in der aufgezeigten Weise zuordnen und die Abbildung 9 zeigt noch einmal die Verbindung der Eysenckschen Dimensionen, die klassische Typenlehre und die Einordnung der EMOs aus den zuvor vorgestellten Simulationen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Der Eysencksche Temperamentskreis und die Daten für die simulierten Temperamente (nach Hille und Bartl, 1997).
1.4.4 Modell und Realität - eine Zusammenfassung
In verschieden Stadien ihrer Entwicklung habe ich versucht, die PSI-Theorie der Handlungsregulation darzustellen. Die komplexen Interaktionen der einzelnen Module wurden dabei meistens nur kurz gestreift, da sich das in einer solchen Arbeit nicht ausführlicher beschreiben läßt. Aber vielleicht ist dies auch gar nicht unbedingt notwendig, um die Theorie in ihren Grundzügen verstehen zu können. Die einzelnen Elemente, die dabei vertieft wurden, zeigen sicherlich, wieviel Feinabstimmung in EMOREGUL notwendig war, um aus dem Modell eine lauffähige Programmversion zu erstellen und die Handlungsabläufe sinnvoll simulieren zu können.
Die Fragestellung hier hat aber noch einen anderen Schwerpunkt, nämlich den nach dem Verhältnis von Realität und Modell oder, anders formuliert: welche Beziehungen bestehen zwischen den Emotionen, Kognitionen und Motivationen, die ein Mensch hat und dessen Erscheinungen, Ausdrucksformen und Verhaltensweisen wir an uns und anderen beobachten und erschließen können, und denen eines EMO, der - anhand plausibler Interaktionen und deren Interpretation derselben - auch Gefühle erzeugt. Die Wortwahl mag hier schon als Indiz für die Fraglichkeit des Konzeptes und den darin enthaltenen qualitativen Unterschied dienen. Dietrich Dörner und seine Mitarbeiter sehen sich gewiß an einem vorläufigen Zielpunkt angelangt, an dem EMOREGUL bereits erstaunliche Fähigkeiten ,,entwickelt" hat und eine ganze Menge menschlicher Prozesse simulieren kann: der ,,Bauplan für eine Seele" scheint also schon weitgehend vorzuliegen und seine Implementierung als EMOREGUL kann nun detailliert beobachtet werden. Die ,,Versuchs-EMOs" werden nun zunehmend ,,VersuchsEMO-Stunden" ableisten müssen, um ihnen ihre Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen zu entlocken.
Ist das nun eine ,,künstliche Seele"? Einige kritische Punkte haben Hille & Bartl bereits angeführt (vgl. Hille und Bartl, 1997, S.35 ff):
- Ähnlich wie andere psychologische Theorien kann auch eine Simulation der menschlichen Handlungen niemals empirisch verifiziert werden. Die aus der Simulation abgeleiteten Hypothesen können im Sinne Poppers verifiziert oder falsifiziert werden, nicht aber die Theorie als Ganzes. Die Argumentation, die daran anschließend eine Analogie zwischen anderen Simulationsfeldern anführt, ist ganz einfach diese: Simulationen können für bestimmte Fragestellungen nützlich sein.
- Die Beschränkung der Fragestellung auf die Anwendbarkeit der Theorie zur Erklärung und Prognose menschlichen Verhaltens wird nochmals explizit betont: die Qualität der Erlebnisfähigkeit psychischer Phänomene kann eine Maschine prinzipiell nicht erreichen. Dieses Ziel verfolgen die Autoren (im Gegensatz zu anderen KI- Forschern) aber auch nicht.
So wie wir die prognostische Qualität des Wetterberichtes, der aufgrund einer Simulationsberechnung entsteht, mit der Realität des tatsächlich eintretenden Wetters vergleichen, sollten wir dies auch mit den EMOs, deren ,,Emotionen" und der Wirklichkeit tun, die damit simuliert wird.
2. ,,Geist" versus künstliche Intelligenz - die Grenzen der Computationalität
... es tritt nunmehr, an irgend einem Punkt der Entwicklung des Lebens auf Erden, den wir nicht kennen und auf dessen Bestimmung es hier nicht ankommt, etwas Neues, bis dahin Unerhörtes auf, etwas ...Unbegreifliches. Der in negativ unendlicher Zeit angesponnene Faden des Verständnisses zerreißt, und unser Naturerkennen gelangt an eine Kluft,über die kein Steg, kein Fittich trägt: wir stehen an der ... Grenze unseres Witzes. Dies ... Unbegreifliche ist das Bewußtsein. Ich werde jetzt, wie ich glaube, in sehr zwingender Weise dartun, daßnicht allein bei dem heutigen Stand unserer Kenntnis das Bewußtsein aus seinen materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, was wohl jeder zugibt, sondern daßes auch der Natur der Dinge nach aus diesen Bedingungen nicht erklärbar sein wird. (Emil du Bois- Reymond, Über die Grenzen des Naturerkennens, 1872)13
In diesem zweiten Teil der Hausarbeit soll eine Rückkehr zu den grundlegenden Fragen der Psychologie versucht werden. Nachdem nun den Ausführungen Dörners und Mitarbeitern einige Male der Vorwurf der Phänomenreduzierung auf computationale Modelle und einer eher laxen Umgangsweise mit grundlegenden Fragen gemacht wurde, soll dies noch anhand eines erweiterten Rahmens der Kritik der KI-Forschung deutlicher werden. Dabei soll nach einer Einführung in das Forschungsgebiet der Bewußtseinsforschung anhand eines Artikels von Thomas Metzinger insbesondere auf die Einwände von John Searle eingegangen werden. Der Übergang vom ersten Teil der Arbeit in den zweiten findet an der Schnittstelle des »subjektiven Erlebens« statt. Es ist derjenige Punkt, der in den Ansätzen der computationalen Modelle in der Regel aus methodischen Erwägungen ausgeklammert wird. Fraglich ist dabei, ob dies überhaupt von den Phänomenen aus gesehen zulässig ist, oder ob wir damit nicht gerade das Wesentliche der psychologischen Elemente des Menschen, nämlich ihren jeweils »subjektiven phänomenalen Gehalt« ausklammern. Andererseits ist natürlich ebenso fraglich, wie eine solche Verknüpfung von Subjektivem und Objektivem in der empirischen Forschung bewerkstelligt werden kann.
2.1 Einblick in die Bewußtseinsforschung
Wenn wir die Ideen von Dörner et al. anschauen, findet sich darin ein Ansatz, der für die Kognitive Psychologie typisch ist: sie geht davon aus, daß das Gehirn, das die psychischen Phänomene erzeugt, in Gang setzt und auch ausführt, ein System der Informationsverarbeitung darstellt und daß man es im wesentlichen wie einen Vorgang der Informationsverarbeitung in digitalen Computersystemen behandeln kann. Später werde ich anhand der Kritik von Searle auf diesen Punkt noch eingehen.
Wenn wir für die Betrachtung der gesamten Bewußtseinsphänomene oder »Phänomene des Geistes« eine Grundstruktur hinsichtlich der Forschungsstrategien entwerfen wollen, so kann man zunächst feststellen, daß diese in drei große Bereiche unterteilt werden können:14
a) den Ansatz einer philosophischen Erschließung der Thematik, die wohl die längste Tradition und die größte Vielfalt an Ideen und Lösungsansätzen für sich beanspruchen kann;
b) die Kognitive Psychologie, Kognitionswissenschaft oder »cognitive psychology«: darin findet sich der Ansatz, psychische Phänomene innerhalb eines Informationsverarbeitungsmodells, z.B. mit Hilfe von Computersimulationen, zu beschreiben;
c) die Neurowissenschaften (im engeren Sinn): sie arbeiten auf der physiologischen Ebene, indem sie die Strukturen des Gehirns mit den beobachtbaren Phänomenen in Beziehung zu setzen versuchen.
Dies soll nur eine grobe Gliederung sein, aber sie kann bereits aufzeigen, welche divergenten Strategien angewandt werden und welche Probleme, insbesondere in der Isolierung der Wissenschaftsbereiche, in denen jeder für sich arbeitet, entstehen, wenn versucht wird, Aussagen über Phänomene oder Bewußtsein insgesamt zu machen. Eine Änderung ist hier aber schon in Sicht, wenn man sich anschaut, wie zunehmend interdisziplinäre Anstrengungen der Zusammenarbeit gemacht werden. ,,Brauchen wir eine neue Wissenschaft vom Bewußtsein?" So fragt mit völligem Recht Thomas Metzinger und benennt auch Gründe, warum dies nicht nur philosophische Spekulationen sind (Metzinger, 1996, S. 15 ff):15
1. ,,Das Problem des Bewußtseins bildet heute - vielleicht zusammen mit der Frage nach der Entstehung des Universums - die äußerste Grenze des menschlichen Strebens nach Erkenntnis." (Metzinger, 1996, S.15). Daß damit nicht nur ein quantitativer Fortschritt der Wissenschaften gemeint sein kann, zeigt die Tatsache, daß es sich bei diesem »Problem« in Wirklichkeit um ein ganzes Bündel von Problemen handelt und daß wir weder genau wissen, worin das Problem des Bewußtseins besteht, noch was wir als ,,Lösung dieses Rätsels akzeptieren würden".
2. ,,Es ist immer auch unser eigenes Bewußtsein, das wir verstehen wollen." In diesem Sinne ist das Problem ein Problem der Selbsterkenntnis, in dem wir als Subjekt vorkommen, nicht nur als Objekte wissenschaftlicher Forschung.
3. Falls eine solche Revolution stattfindet, könnte es sein, daß dies die größte kulturelle und gesellschaftliche Revolution der Zukunft werden wird: dies beträfe sowohl das Bild von uns selbst als auch die technologischen Folgen, die z.B. aus den Bereichen der KI-Forschung und der Neurowissenschaften allgemein entspringen könnten.
Auf dem Weg zu einer solchen ,,Theorie des Bewußtseins" gibt es allerdings eine Fülle von Fragen zu klären, von denen einige grundsätzliche hier genannt seien:
- Worin besteht das Problem des Bewußtseins?
- Kann man dieses Problem überhaupt mit den Mitteln der Naturwissenschaft angehen?
- Was wäre der Gegenstand, die Arbeitsweise und das Ziel einer solchen Forschung?
- Wie ist es möglich, daß Bewußtsein in einer physikalischen Welt entstehen konnte?
Ein Vorstoß in Richtung einer umfassenden Phänomenerschließung, einer ,,philosophischen Empirie" (Schwemmer, a.a.O) zu einer umfassenderen Einbettung der Frage, wie Emotion, Kognition und Motivation interagieren, ist die Frage nach einer ,,Theorie darüber, was bewußtes Erleben ist". In diesem Sinne muß dies als Ergänzung zu dem z.B. von Dörner intendierten Erklärungsansatz hinzukommen, wenn wir nicht eines der Grundmerkmale geistiger Phänomene ausklammern und - ähnlich wie der Behaviorismus - nur eine stark reduzierte Forschungsperspektive verfolgen wollen.
Um die Dimensionen der grundlegenden Fragen, die sich aus der Utopie einer ,,Unified Theory of Consciousness" (Flanagan, 1992) ergeben, etwas auszuführen, möchte ich zunächst das angesprochene Problem der Spannung zwischen Objektivität als Betrachtung der Außenwelt und Subjektivität als der Perspektive des Individuums, ansprechen.
Interessant ist außerdem, daß sich mit der Entstehung von Bewußtsein immer auch Innenwelten entfalten, Räume des inneren Erlebens. Diese Räume sind aber individuelle Räume: In einem mittelpunktslosen Universum entstehen plötzlich Ich-Zentren, Brennpunkte des Bewußtseins. Jedes dieser Bewußtseinszentren konstituiert eine eigene Perspektive auf die Welt. Diese Perspektive ist das, was die Philosophen gerne ,,die Perspektive der ersten Person" nennen. An jede einzelne dieser Perspektiven ist wiederum eine eigene phänomenale Welt gebunden. Diese individuellen Erlebniswelten besitzen außerdem eine geschichtliche Dimension. Mit ihnen entsteht fast immer auch eine psychische Biographie . (...) Man könnte deshalb auch hier von der Entstehungsgeschichte einer Welt sprechen, von einer phänomenalen Kosmologie: In und durch jeden von uns entfaltet sich vorübergehend ein eigener Kosmos des Bewußtseins, ein subjektives Universum. (Metzinger, S. 19)
Ein weiterer wesentlicher Punkt einer solchen Theorie des Bewußtseins ist, nach Metzinger, eine ,,sorgfältige begriffliche Analyse der Problematik", um damit die Voraussetzungen zu schaffen für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Philosophen, Psychologen, Kognitionswissenschaftlern und Neurowissenschaftlern. Denn nur in einer solchen Zusammenarbeit und Vernetzung der Einzelwissenschaften kann sich ein Fortschreiten in der Richtung auf eine Lösung des Problems hin ergeben16 - wenn es denn eine solche Lösung im Sinne eines ,,Endzustandes" überhaupt gibt.
In vier Punkten werde ich nun, dem Artikel von Metzinger folgend, eine Annäherung an das Problem Bewußtsein und eine begriffliche Eingrenzung versuchen, die dieses weite Feld etwas greifbarer machen sollen.
1.) Das pure Erleben
,,Zunächst scheint es nichts in der Welt zu geben, was uns vertrauter ist, als die Inhalte unseres eigenen Bewußtseins: Unsere Sinnesempfindungen, unsere Gefühle, unsere Gedanken sind uns auf eine selbstverständliche und sehr direkte Art gegeben" (Metzinger, S.21).
Die Tatsache, daß ich jetzt diese Sätze hier schreibe, daß ich angespannt bin, ist mir als Tatsache des Bewußtseins gegeben, sie ist in dieser Art nicht bezweifelbar.
In der Philosophie wird dieses pure Erleben als der ,,phänomenale Gehalt" unserer mentalen Zustände bezeichnet und es entsteht daraus ein ,,phänomenales Bewußtsein", welches dieses pure, unmittelbare Erleben zum Inhalt hat.
Thomas Nagel hat diese Zustände, die nicht nur aus Wissenselementen oder Fakten bestehen, sondern immer irgendwie auch erlebt werden, so charakterisiert: ,, Es ist irgendwie, sich in diesen Zuständen zu befinden" (zit. nach Metzinger, S.22).
Das Erleben dieses ,,phänomenalen Gehalts" zeigt sich nun in einer Sinneswahrnehmung sehr deutlich: Wenn wir jetzt wieder gelbe Forsythien in der Frühlingssonne bewundern, dann ist diese Wahrnehmung eine subjektive Empfindung der ,,Gelbheit" der Pflanze, kein Akkumulieren von Fakten über deren Aktivierung von neuronalen Netzwerken im Cortex.
Nichts, was wir über visuelle Wahrnehmungsphänomene wissen, sagt uns etwas aus über die Gelbheit der Wahrnehmung, die wir in Form von elektromagnetischer Strahlung einer bestimmten Wellenlänge in unseren Zapfen ,,empfangen". In diesem Sinne spricht man von ,,phänomenalen Eigenschaften" als subjektiven Empfindungen der wahrgenommenen Gegenstände oder auch neuerdings von ,,Qualia".
In den nächsten Schritten sollen nun drei wesentliche Eigenschaften von phänomenalen Zuständen genauer beschrieben werden, um deutlich zu machen, um welche es sich dabei handelt und was diese allgemeinen Begriffe bezeichnen.
2.) Die Transparenz phänomenaler Zustände
,,Phänomenale Zustände sind uns unendlich nah. (...) Bevor wir überhaupt beginnen können, über das Problem des Bewußtseins nachzudenken, stehen die einfachen Tatsachen des Bewußtseins schon fest" (S.25). Transparenz bedeutet in dieser Hinsicht, daß wir phänomenale Zustände nicht als solche erleben, sondern, ,,daß wir durch sie hindurch schauen". Kein bewußtes Berühren im Sinne einer aufmerksamen Tastempfindung oder ein gezieltes Hinsehen auf ein bestimmtes Objekt, sondern die einfache Tatsache des Vorhandenseins, eines unmittelbaren Daseins.
Kann man eine solche Tatsache dann aber zu einem Gegenstand naturwissenschaftlicher Forschung machen? Wenn nun in einem kognitiv-informationsverarbeitenden Ansatz auf Empfindungen als Datenstrukturen rekurriert wird und man erklärt - wie Metzinger hier vorschlägt - daß ,,die aktiven Datenstrukturen vom System nicht mehr als solche erkannt werden", was könnte an diesen, als fremd erlebten ,,aktiven Datenstrukturen" transparentes Erleben sein?
3.) Die Perspektivität phänomenaler Zustände
Das subjektive Erleben der Empfindungen, Gefühle und Wahrnehmungen ist immer das Erleben eines Ich: Ich selbst bin es, der die subjektiven Qualitäten meiner Erlebnisse und Gefühle an mir entdeckt. Dies zeigt zutiefst die ,,Perspektive der ersten Person". Wir besitzen ein ,,zentriertes Bewußtsein" , aus dessen Perspektive wir die Welt um uns normalerweise wahrnehmen und wir sind selbst dieses Zentrum. Alles, was erlebt wird, wird immer in dieser ganz und gar eigenen Sichtweise des Ich, in einer Art »präreflexiven Selbstvertrautheit« erlebt.
Fraglich wird damit aber, ob diese inneren privaten Empfindungen des Selbst jemals mit ,,äußeren" objektiv gegebenen Eigenschaften der zugrundeliegenden physischen Zustände verknüpft werden können. Als Beispiel hierzu dient das Phänomen Schmerz: das Sein von Schmerzen besteht ja gerade in ihrem Erlebtwerden. ,,Ein Schmerzerlebnis, das nicht schmerzhaft ist, ist überhaupt kein Schmerzerlebnis - und eine Theorie über Schmerzen, in der diese qualitative Eigenschaft nicht mehr vorkommt, ist überhaupt keine Theorie über Schmerzen mehr" (Metzinger, S.28). Die Frage, die sich hier anschließt, ist die, ob das ,,aperspektivische Weltbild der Wissenschaft überhaupt dem phänomenalen Gehalt Rechnung tragen kann, der an die vielen individuellen Bewußtseinsperspektiven geknüpft ist" (Metzinger, S.31)?
4.) Die Präsenz phänomenaler Zustände
Dieses dritte Merkmal phänomenalen Bewußtseins ist der zeitliche Aspekt des Erlebens: die Erlebnisse der phänomenalen Welt sind jetzt, sie werden als gegenwärtig erlebt. Die Präsenz solcher Bewußtseinszustände ist in diesem Sinne nicht konstruiert, sie ist unmittelbar vorhanden. Im Gegensatz dazu können wir natürlich auch Erlebtes re-konstruieren, indem wir uns an ein Geschmacks- oder Geruchserlebnis erinnern. Die erlebte Präsenz von Ereignissen ist davon unterschieden. Überhaupt werden Inhalte des Bewußtseins erst durch die Präsenz eines ,,durchgängigen Erlebens" zu realen Tatsachen. Diese realen Tatsachen gestalten die jeweilige reale Welt eines Individuums.
In der neuropsychologischen Literatur hingegen finden sich viele Beispiele für veränderte Zeiterlebnisse und mithin sind es diese außergewöhnlichen Phänomene, die uns zu den Fragen des Bewußtseins verholfen haben und dessen Rätselhaftigkeit deutlich machen. Ein Beispiel, das Metzinger dazu gibt, ist der Traum: in diesem ,,ganz natürlichen und sich regelmäßig wiederholenden Bewußtseinszustand, erscheint uns die Wirklichkeit als gegenwärtig und real; Obwohl die Welt des Traumes voller Widersprüche ist und sich ständig auf bizarre Weise ändert, wissen wir nicht, daß wir träumen" (Metzinger, S. 33).
Eine zukünftige Theorie des Bewußtseins wie auch andere psychologische Theorien sollten diese Strukturmerkmale von Bewußtsein und die Komplexität, mit der wir in solche Theorien immer als empfindendes Subjekt verwoben sind, als Ausgangspunkt ihrer Forschungsbemühungen ernst nehmen.
2.2 Searle`s Wiederentdeckung des Geistes
Die Vernachlässigung des Bewußtseins ist mehr als alles andere schuld an der Dürre und Sterilität in der Psychologie, in der Philosophie des Geistes und in der Kognitionswissenschaft.
( John Searle, Die Wiederentdeckung des Geistes, S.255)
2.2.1 Grundsätzliche Fragen: Das Körper-Geist-Problem (,,mind-body- problem")
Searle's Ausgangspunkt seiner ,,Wiederentdeckung des Geistes"17 ist die Frage nach der Lösung des Körper-Geist-Problems. Er kommt sogar zu der Feststellung, daß es ,,in der Philosophie des Geistes, etwa der letzten fünfzig Jahre eigentlich nur ein wichtiges Diskussionsthema gegeben hat, und zwar das Körper-Geist-Problem" (Searle, 1996, S.44). Die Grundfrage, die Philosophen seit Jahrtausenden und seit ca. 300 Jahren (mit der dualistischen Idee Descartes) auch zunehmend Naturwissenschaftler beschäftigt, läßt sich so formulieren:
,,Wie ist in einem physikalischen Universum die Entstehung von Bewußtsein möglich?" (Metzinger, 1996, S.15) oder wie Searle es ausdrückt:
Das größte Problem ist derzeit: Wir haben ein gewisses Bild von uns selbst als Menschen, das zu unseren gewöhnlichen Alltagsauffassungen gehört; dieses Bild des gesunden Menschenverstandes ist sehr schwer mit unserer umfassenden »wissenschaftlichen« Vorstellung von der materiellen Welt in Einklang zu bringen. Wir denken von uns selbst, daß wir einen Geist haben, daß wir bewußt, frei und rational in einer Welt handeln, von der uns die Wissenschaft sagt, sie bestehe ausschließlich aus Materie-Teilchen ohne Geist und Bedeutung. Wie können wir diese beiden Vorstellungen nun miteinander vereinbaren? Wie kann es beispielsweise sein, daß die Welt nichts außer Materie-Teilchen ohne Bewußtsein enthält und trotzdem auch Bewußtsein in ihr ist? (...) Kurz, wie kann eine wesentlich bedeutungslose Welt Bedeutungen enthalten (Searle, 1986, S. 12)?
Doch wenn es auch anhand der umfangreichen Literatur und philosophischen Diskussionen dieses Problems als ausgesprochen komplex erscheinen mag, gibt Searle darauf eine verblüffend einfache Antwort:
Das berühmte Körper-Geist-Problem, die Quelle so vieler Kontroversen in den vergangenen zwei Jahrtausenden, hat eine einfache Lösung. Vor etwa einem Jahrhundert begann eine ernstzunehmende Erforschung des Hirns, und seitdem ist diese Lösung jedem gebildeten Menschen zugänglich. In einem gewissen Sinne wissen wir alle, daß sie stimmt. Und das ist sie: Geistige Phänomene werden von neurophysiologischen Vorgängen im Hirn verursacht und sind selbst Merkmale des Hirns (Searle, 1996, S.13).
Scheint diese Antwort auch auf den ersten Blick einfach zu sein, so ergeben sich daraus jedoch eine Menge Fragen. Zwei davon seien exemplarisch genannt:
- Wie und durch welche Mechanismen erzeugen Neurone, Synapsen und deren Verbindungen denn nun geistige Phänomene?
- Welche Erklärung bietet die Neurophysiologie für die vielfältigen geistigen Phänomene?
Die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, ist diejenige, daß die anerkannte naturwissenschaftliche Methodik in der Regel in einem eher materialistischen Weltbild verhaftet ist. Durch einen sog. mainstream-Materialismus, der für die meisten Naturwissenschaftler charakteristisch ist, wird eine solche Lösung des Körper-Geist- Phänomens erschwert. Allerdings nur, wenn sie, wie Searle, intrinsische geistige Phänomene annehmen wollten. Für die meisten ist deshalb das Körper-Geist-Problem einfach durch die Annahme gelöst, daß es ,,Bewußtsein" und ,,Intentionalität" in dieser Weise gar nicht gibt oder wenn, dann in Form von physischen Phänomenen, auf die sich intentionale Zustände jeweils reduzieren lassen. Diese Tradition des Materialismus kritisiert Searle heftig.
2.2.2 Kritik des Materialismus
Materialistische Auffassungen gibt es indes in verschiedenen Varianten, von denen der Autor sechs Facetten als ,,unwahrscheinliche Theorien des Geistes" (S. 18) herausstellt:
a) Den eliminativen Materialismus, der davon ausgeht, daß es geistige Phänomene gar nicht gibt. Wichtige Vertreter dieser Richtung waren die Behavioristen B.F.Skinner und J.B. Watson, sowie A.Turing (vgl. Bunge, 1990, S.11).
b) Eine Auffassung, die sich gegen die Evidenz alltagspsychologischer Konzepte als theoretischer Konstrukte wendet. Sie wird z.B. von P.M. Churchland vertreten und besagt, daß die alltagspsychologischen Erklärungen oftmals, in wissenschaftlichem Licht betrachtet, falsch sind. In diesem Sinne müssen damit auch die zugrundeliegenden postulierten Entitäten, wie Wünsche, Überzeugungen, Wille usw. als falsch angesehen werden.
c) Funktionalistische Auffassungen gehen davon aus, daß geistige Phänomene lediglich aus den Kausalbeziehungen eines Systems bestehen und jedes Duplikat solcher Kausalbeziehungen die gleichen Geisteszustände erzeugen könnte. Diese verbreitete Ansicht geht in ähnliche Richtung wie
d) die Sichtweise des »Computer-Funktionalismus«, der behauptet, ein Computerprogramm, welches genau die passenden Input- und Output-Relationen eines Systems erzeugen könnte, das z.B. im Hirn als der Hardwarekomponente implementiert ist, könnte damit auch die ,,geistigen Phänomene" erzeugen, die im Gehirn auf biologischer Basis erzeugt werden. Dies muß aber nicht zwangsläufig so sein und dies stellt Searle als die Idee der ,,starken Künstlichen Intelligenz" dar.
e) Einer der prominentesten Vertreter einer Auffassung, die geistige Phänomene und ihre Sprache als ,,Vokabular des Geistigen" bezeichnet, ist D. Dennett. Er geht davon aus, daß sich dieses Vokabular als ,,intentionale Haltung" gegenüber einem System bewährt, um Aussagen über Verhalten zu machen, aber damit keine intentionalen oder intrinsischen Phänomene bezeichnet werden.
f) Dies ist wieder eine extreme Auffassung, die behauptet, daß Bewußtsein als subjektive, private und qualitative Phänomene der Sinnesempfindung überhaupt nicht existieren. Allerdings sehe ich hier keinen Unterschied zur Auffassung a).
Searle versucht nun in seinem Buch nicht die eine oder andere Spielart des Materialismus zu widerlegen, sondern die Grundlagen des Materialismus zu untergraben, indem er den in sieben Punkten formulierten Grundüberzeugungen seinerseits sieben Gegenargumente entgegenstellt. Der Materialismus geht danach von Annahmen aus, wie
1. Geistige Phänomene sind bei der Untersuchung von Kognition, Sprache und Geisteszuständen als subjektive Phänomene von geringer Wichtigkeit.
2. Wissenschaft ist objektiv, weil sie von der Realität handelt, die ebenfalls objektiv ist.
3. ,,Wegen der Objektivität der Realität besteht die beste Methode bei der Untersuchung des Geistes darin, den objektiven Standpunkt (den Standpunkt der dritten Person) einzunehmen. Die Objektivität der Wissenschaft verlangt eine durch und durch objektive Untersuchung der Phänomene (S.23). Die Konsequenz daraus ist, daß z.B. von der Kognitionswissenschaft das objektiv beobachtbare Verhalten untersucht wird.
4. Die erkenntnistheoretische Frage, die sich aus der Untersuchungsmethodik ergibt: ,,Woher wissen wir, ob irgendein anderes »System« die-und-die mentalen Eigenschaften hat?" (S.24) wird durch die Untersuchung des resultierenden Verhaltens, das ja objektiv erkennbar ist, gelöst.
5. Das Wesen des Geistigen besteht in der Intelligenz und deren kausalen Verknüpfungen. Die Kausalbeziehungen stellen das wesentliche des geistigen Phänomens dar (funktionalistische Erklärung).
6. Die Tatsache, daß unser Universum ein gänzlich physisches Universum ist und wir dessen Realität durch objektiv-wissenschaftliche Kriterien zu beschreiben versuchen, ergibt, daß die ganze physische Realität durch diese Methodik prinzipiell beschreibbar ist: ,,Wir können alle Tatsachen im Universum erkennen und verstehen" (S.24).
7. Ergibt sich eigentlich logisch aus dem vorher Gesagten: ,,die einzigen Dinge, die existieren, sind letztlich physisch, und das heißt physisch: im Gegensatz zu geistig" (S. 24).
Die Hauptgründe für das Festhalten am Materialismus sieht Searle vor allem in der Furcht vor einem ,,Absturz in den cartesianischen Dualismus" (S.26). Die durch die Tradition des Dualismus vererbten Begriffe und Kategorien sind für eine vorurteilsfreie Diskussion über die Unterschiede zwischen physischen und psychischen Phänomenen hinderlich. ,,Es fällt ihnen (den Kommentatoren von Searle's Werken, d.V.) nämlich schwer zu sehen, daß jemand die offensichtlichen Tatsachen über Geisteszustände akzeptieren könnte, ohne zugleich den cartesianischen Apparat zu akzeptieren, der traditionell mit der Anerkennung dieser Tatsachen einherging" (S.27).
Searle's Gegenargumente sind nun folgende:
1. ,,Bewußtsein ist wichtig" (S.32). Begriffe des Geistigen sind abhängig von Bewußtsein. Auch wenn in unserem Leben Dinge unbewußt sind und die geistigen Phänomene von dem Bewußtseinszustand, in dem wir uns befinden, abhängen, sind diese Phänomene immer potentiell bewußt, bewußtseinsfähig.
2. Die Wirklichkeit ist nicht nur objektiv, sondern ebenso subjektiv. Die erkenntnistheoretische Zugangsweise mag durchaus dem Ideal objektiv-erkennbarer Tatsachen ihr Augenmerk schenken, ohne dabei allerdings damit zu konstatieren, daß die ganze Realität objektiv sein müsse. Ontologisch gesehen ist die Welt sowohl objektiv als auch subjektiv. Die Beschreibungen auf der Dritte-Person-Ebene sollten daher nicht mit denjenigen der Erste-Person-Ebene vermengt werden: ,,Zuschreibungen von Intentionalität" aufgrund der Perspektive der dritten Person sind von den subjektiven geistigen Phänomenen der ersten Person (die diese hat) zu unterscheiden.
3. Die Annahme, daß die ,,Ontologie des Geistigen" (S. 34) objektiv sei, ist falsch. Damit ist aber auch eine Methodik als falsch zu bezeichnen, deren Ausgangspunkt allein die objektiv beobachtbaren Verhaltenstatsachen als Basis sind.
4. Die Tatsache, daß nur aus der Verhaltensbeobachtung die Frage, welche mentalen Zustände bei anderen Menschen wahrzunehmen seien (Das ,,Problem des Fremdpsychischen"), beantwortbar ist, ist falsch. Wir erkennen aufgrund von Kausalzusammenhängen, die eine biologische Grundlage haben, Ähnlichkeiten zwischen uns und anderen Lebewesen. Das heißt, wir erkennen mentale Vorgänge durch die Tatsache, daß wir die ,,kausalen Grundlagen des Geistigen sehen können und dadurch auch das Verhalten als eine Manifestation des Geistigen sehen" (S. 36).
5. Verhalten oder Kausalbeziehungen sind für Geisteszustände nicht essentiell, da es auch geistige Phänomene ohne resultierendes Verhalten gibt und Verhalten kontingent aus neurophysiologischen Mechanismen entstehen kann.
6. Die erkenntnistheoretische Maxime, daß wir alles wissen, läßt sich nicht mit der Ontologie eines evolutionär entstandenen Universums, in dem prinzipiell auch im Vergleich zum Menschen höhere Lebewesen mit größeren Erkenntnismöglichkeiten existieren könnten, vereinbaren. Allerdings dient uns die Erkenntnistheorie insoweit hier als »heuristisches Hilfsmittel«, da wir ja nicht wissen können, was wir nicht wissen.
7. Die physische Wirklichkeit entspricht nicht den cartesianischen Kategorien zwischen physisch und geistig. Mithin wäre nicht einmal die physikalische Welt im atomaren und subatomaren Bereich im Sinne Descartes als res extensa zu bezeichnen. Die Inkohärenz der Definitionen von Dualismus und Mentalismus vererben diese weiter an den Monismus und Materialismus, die durch die ersten beiden definiert sind. Searle zeigt dabei, daß beide Seiten sich in dem gleichen, daß sie die falschen Fragen gestellt haben und letztlich deshalb auch falsche Antworten bekommen mußten (zur Begründung und Geschichte des Materialismus, siehe Kap. 2 in Searle, 1996).
2.2.3 Intentionalität und Bewußtsein
Für die weitere Erörterung der Position Searles soll nun zunächst noch einmal explizit des Verständnis von Intentionalität und Bewußtsein aufgezeigt werden. Zunächst definiert Searle » Geist « als ,,die Abfolgen von Gedanken, Gefühlen und Erfahrungen, ob bewußt oder unbewuß" (Searle, 1986, S.10).
Als vier zentrale Merkmale des Geistes (oder ,,geistige Phänomene") bezeichnet er
1. das Bewußtsein: als das wichtigste Merkmal, in Form von ,,bewußten Zuständen";
2. die Intentionalität: ,,das, womit unsere Geisteszustände auf andere Gegenstände oder Sachverhalte gerichtet sind, von ihnen handeln, sich auf sie beziehen, über sie gehen. »Intentionalität« bezieht sich (...) nicht bloß auf Intentionen, sondern auch auf Überzeugungen, Wünsche, Hoffnungen, Befürchtungen, Liebe, Haß, (...) und alle andern Geisteszustände, die sich auf die außergeistige Welt beziehen oder von ihr handeln (vgl. Searle, 1986, S.15).
3. die Subjektivität von Geisteszuständen als einer privaten, perspektivischen und inneren ,,Tatsache", die nur dem Subjekt in dieser Weise zugänglich ist - ähnlich wie ich dies, in Anlehnung an Metzinger, in Abschnitt 1. dargestellt habe.
Subjektivität hat die (...) Konsequenz, daß alle Formen meiner bewußten Intentionalität, die mir Informationen über die von mir unabhängige Welt geben, immer von einem besonderen Standpunkt aus stattfinden. Die Welt selbst hat keinen Standpunkt, doch mein Zugang zur Welt mittels meiner Bewußtseinszustände ist immer perspektivisch, geschieht immer von meinem Standpunkt (S.115).
Weiter geht er noch in seiner Kritik, die ich hier auch und schon beim Lesen der Dörner-Texte immer wieder als die Hauptkritikpunkte in solchen funktionalen Erklärungen empfunden habe, indem er sagt:
Die Tatsache, daß die Ontologie des Geistes eine Ontologie der ersten Person ist, wurde beständig übersehen; und dies trug - in einer Weise, die sich oberflächlicher Betrachtung nicht erschließt - ganz erheblich zu dem Bankrott der meisten Arbeit im Bereich der Philosophie des Geistes und zu der Sterilität der akademischen Psychologie der vergangenen fünfzig Jahre, während meines gesamten intellektuellen Lebens, bei (S. 115).
4. das Problem der geistigen Verursachung als Modus des Ingangsetzens von neurophysiologischen Prozessen durch intentionale Phänomene. Dieser Modus muß aber nicht generell bei Bewußtsein vorliegen.
Bewußtsein definiert Searle in seiner ,,Wiederentdeckung des Geistes" mit Hilfe eines Beispiels:
,,Was ich unter Bewußtsein verstehe, läßt sich am besten mit Hilfe von Beispielen veranschaulichen. Wenn ich aus einem traumlosen Schlaf erwache, dann gelange ich in einen Zustand des Bewußtseins - ein Zustand, der solange anhält, wie ich wach bin. Wenn ich einschlafe oder eine Vollnarkose bekomme oder sterbe, dann hören meine Bewußtseinszustände auf. Wenn ich im Schlaf träume, dann bin ich in einem Bewußtseinszustand, obwohl Traumformen von Bewußtsein im allgemeinen viel weniger intensiv und lebhaft sind als gewöhnliches Wach-Bewußtsein. Der Grad an Bewußtsein kann sich auch während der Zeit, in der ich wach bin, ändern"... (S. 102).
Hinsichtlich der Intentionalität unterscheidet Searle zwischen ,,intrinsischer18 Intentionalität", ,,Als-ob-Intentionalität" und ,,abgeleiteter Intentionalität".
Anhand des einfachen Beispiels von »Durst« stellt er heraus, was damit gemeint ist:
1. Ich habe jetzt Durst, richtigen Durst, weil ich heute den ganzen Tag noch nichts getrunken habe.
2. Mein Rasen hat Durst, richtigen Durst, weil er seit einer Woche nicht gewässert worden ist.
3. Im Französischen bedeutet »J'ai grand soif«: Ich habe großen Durst.
Die Zuschreibung in 1. wird für den Fall, daß sie wahr ist, als Bezeichnung für einen intentionalen Zustand verwendet: Das Durstempfinden ist ein Zustand ,,intrinsischer Intentionalität", wenn ich dieses Gefühl empfinde, welches bestimmte Intentionen auslöst.
In 2. stellt die Aussage lediglich eine metaphorische Redeweise dar, die einen Als-ob-Zustand von Intentionalität dem Objekt des Rasens (der in Wirklichkeit keine intentionalen Zustände hat) zuschreibt.
In 3. wird dem französischen Satz eine Intentionalität als einem syntaktischen Gebilde zugeschrieben, das nicht intrinsisch ist. Der Satz an sich hat dabei keinerlei Bedeutung, nur wenn dieser von Menschen verwendet wird, um damit ihre Intentionalität zum Ausdruck zu bringen, hat dieser Satz Intentionalität. ,,Sprachliche Bedeutung ist wirkliche Intentionalität, aber keine intrinsische Intentionalität. Sie ist von der intrinsischen Intentionalität der Sprachverwender abgeleitet" (S. 97).
p>Bewußtsein ist nach Searle der ,,zentrale geistige Begriff" in einer Theorie des Geistes und mithin sind alle anderen Phänomene wie Intentionalität, Subjektivität und geistige Verursachung nur in der Beziehung zum Bewußtsein zu verstehen. Im Folgenden versucht Searle die Theorie des Bewußtseins anhand der beiden großen Rahmentheorien, die ,,konstitutiv für das moderne Weltbild" (S.105) sind, zu erklären: der Atomtheorie der Materie und der Evolutionstheorie der Biologie. In der Atomtheorie findet er dazu zwei wesentliche Ideen: zum einen sind die Teilchen, die Materie ausmachen, in Systemen organisiert. Zum andern sind größere Systeme aus kleineren Systemen zusammengesetzt und die jeweils ,,kleineren" Systeme verursachen kausal die Eigenschaften der größeren Systeme. Die Erklärungsmöglichkeiten in solchen Systemen können nun aber auf verschiedenen Ebenen erfolgen, so kann z.B. ein Makrophänomen (z.B. kochendes Wasser) durch ein Mikrophänomen erklärt werden (die kinetische Energie der H2O- Moleküle). Genauso kann aber auch ein Makrophänomen durch ein anderes Makrophänomen kausal erklärt werden, so daß sich insgesamt mehrere Kausalrelationen zwischen Mikro- und Makroebenen ergeben. Als Fazit ergibt sich: ,,Viele Eigenschaften von großen Dingen werden durch das Verhalten von kleinen Dingen erklärt" (S.107).
In der Evolutionsbiologie findet Searle hingegen weitere zwei Ebenen, die Phänomene erklären, zum ersten eine »funktionale« Ebene, zum andern die »kausale« Ebene. Am Beispiel des Blattes einer Pflanze, das sich der Sonne zuwendet, kann dies erläutert werden: die »funktionale« Antwort wäre: diese Eigenschaft hat für diese Pflanze Überlebenswert. Die »kausale« Antwort hingegen lautet: die biochemische Struktur, die in der genetischen Struktur wurzelt, bewirkt die Absonderung des Wachstumshormons Auxin, und die unterschiedlichen Auxinkonzentrationen bewirken wiederum die Drehung der Blätter zur Sonne. Die Hauptfunktion dieser evolutionstheoretischen Erklärung ist die, daß damit auf unterschiedliche Weise die Erhöhung der Überlebensfunktion erklärt werden kann. Diese Ausführungen leiten dazu über, auch den Menschen als ,,Teil der Natur" und insbesondere die Entwicklung des menschlichen Gehirns in dieser biologischen Theorie zu verankern.
Ausgedehnt auf die Frage nach dem Körper-Geist-Problem stellt Searle nun seine Bewußtseinstheorie als eine biologisch verankerte Theorie, die dennoch die Fähigkeit hat, geistige Phänomene zu erzeugen und Bewußtsein als wesentliches Merkmal des Geistes beinhaltet.
Bewußtsein ist, kurz gesagt, ein biologisches Merkmal des Menschenhirns und des Hirns gewisser anderer Lebewesen. Es wird durch neurobiologische Vorgänge verursacht und ist ein Bestandteil der natürlichen biologischen Ordnung wie jedes andere biologische Merkmal. (...) Sobald man berücksichtigt, daß Atomtheorie und Evolutionstheorie für unser heutiges wissenschaftliches Weltbild zentral sind, begreift man das Bewußtsein ganz selbstverständlich als ein aus der Evolution hervorgegangenes phänotypisches Merkmal von gewissen Organismen mit hochentwickelten Nervensystemen (S.109).
2.2.4 Die Struktur des Bewußtseins
Auf dem Weg der Entwicklung einer allgemeineren Theorie des Bewußtseins nimmt Searle bewußt zwei Themen aus, von denen er sagt, daß er sie nicht hinlänglich verstehe.19
a) die Zeitlichkeit des Bewußtseins, von der er infolge der grundlegenden Kategorisierung Kants in Raum und Zeit als einer ,,Asymmetrie" zugunsten der Zeit spricht: ,,Obgleich wir Gegenstände und Ereignisse als räumlich ausgedehnt und als zeitlich andauernd erleben, wird unser Bewußtsein selbst nicht als räumlich, wohl aber als zeitlich ausgedehnt erlebt" (S.149).
b) die gesellschaftliche Dimension des Bewußtseins: ,,ich bin überzeugt, daß die Kategorie der »anderen Leute« in der Struktur unserer bewußten Erlebnisse eine besondere Rolle spielt, eine Rolle, die der von Gegenständen und Sachverhalten unähnlich ist" ... (S.149)20. Searle nennt für die Umschreibung seiner Theorie zwölf Strukturmerkmale (vgl dazu Searle, 1996, S.150 ff).
1. Endlich viele Modalitäten strukturieren das Bewußtsein hinsichtlich der »Kanäle«, auf denen diesem Empfindungen zukommen oder durch die solche wahrgenommen werden. Er zählt dazu zunächst die herkömmlichen fünf Sinnesqualitäten (Sehen, Tasten, Riechen, Schmecken, Hören). Als ,,sechsten Sinn" bezeichnet er den Gleichgewichtssinn und zählt als weitere Kanäle noch die Körperempfindungen (»Proprozeptionen«) und den ,, Strom der Gedanken" hinzu. Dieser umfaßt auch die Gefühle, im Sinne von ,,Emotionen", die man als benennbare Gefühlsqualitäten empfinden und beschreiben kann.
Weiterhin sind diese Modalitäten alle durch eine hedonistische Komponente gekennzeichnet, indem sie in angenehm/unangenehm-Kategorien eingeordnet werden, die ihrerseits wieder modalitätsspezifisch ausgeprägt sind. Die Zuordnung der hedonistischen Komponente geschieht dabei in Verbindung mit bestimmten Intentionen: die Intentionalität, z.B. beim visuellen Geschehen bestimmt die hedonistische Komponente wesentlich. So ist die reine Sinnesempfindung des Sehens z.B. bei ekelhaften Erscheinungen nicht die ausschlaggebende Komponente für eine Wahrnehmung als unangenehm. Bei Schmerzen hingegen kann aber sowohl eine reine Schmerzempfindung ohne Intentionalität auftreten, wie auch - aufgrund der Empfindung, zu Unrecht unter Schmerzen leiden zu müssen - intentionale Zustände eine wesentliche Rolle spielen, so daß im zweiten Fall die unangenehme Empfindung wesentlich höher sein wird.
2. Einheit: dient als wichtiges Kennzeichen von nicht-pathologischen Bewußtseinszuständen. In dieser Einheit einer ganzheitlichen Wahrnehmung und Empfindung der Umwelt erleben Menschen Einzelereignisse jeweils eingebettet in den Hintergrund des gerade nicht aktiv fokussierten Zentrums der Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung eines Geräusches, das aufmerksame Hören auf ein Musikstück im Radio und das Sehen des Raumes (mit all seinen Objekten, Farben, Formen und Einzelheiten), das im Hintergrund stattfindet, ist in die Einheit eines Gesamterlebnisses eingebettet und wird nicht als eine Folge von Einzelereignissen ,,registriert", auch wenn die ,,Informationsverarbeitung", mit der die kognitive Psychologie einen Erklärungsversuch dafür anbietet, u.U. von einer sequentiellen Verarbeitung ausgeht.21 Searle postuliert hier ein zweigegliedertes Ordnungssystem, das die Bewußtseinszustände in ,,horizontal" und ,,vertikal" einordnet. Horizontale Ordnung ist dabei eine über eine kurze Zeitspanne andauernde Einheit, die es z.B. ermöglicht, auch den Anfang eines langen Satzes bis zum Ende des Sprechens im Gedächtnis zu behalten. Vertikale Ordnung bezeichnet das eingangs erwähnte Beispiel, wobei verschiedene Merkmale eines Bewußtseinszustandes gleichzeitig wahrgenommen werden und im Gegensatz zu entsprechend pathologischen Veränderungen als einheitlich erlebt werden.
3. Intentionalität kommt den meisten Bewußtseinszuständen zu, indem Bewußtsein als ein ,,Bewußtsein von ..." erlebt wird, diese Gerichtetheit der Bewußtseinszustände ist allerdings nicht notwendig vorhanden. Wenn ich einfach irgendwo sitze und mich meinen Stimmungen hingebe, kann dies ein nichtintentionaler Bewußtseinszustand sein, der ähnlich einem ,,luziden Traumerlebnis"22 die Geschehnisse einfach nur in einer Art Zuschauerrolle betrachtet.
Die bewußten Zustände sind als intentionale Zustände immer perspektivisch (vgl. Abschnitt 1.), d.h. wir nehmen die Gegenstände immer aus einer unserem Standpunkt entsprechenden Perspektive wahr:
,,Wenn wir auf den perspektivischen Charakter bewußten Erlebens aufmerksam werden, dann werden wir dadurch daran erinnert, daß alle Intentionalität aspekthaft ist" (S.153).
4. Die Subjektivität, als der ,,Wie-es-gefühlsmäßig-ist - Aspekt" der bewußten Zustände, ist der für die Wissenschaften am meisten rätselhafte Aspekt und der für die Forschung wohl am widerspenstigste. Am Beispiel des Schmerzes soll erneut verdeutlicht werden, in welchem Sinn solche Bewußtseinszustände ,,subjektiv" sind. Ein Schmerz, den ich empfinde, wenn ich mich an etwas stoße, hat eine objektive Komponente, die durch den Mechanismus der Schmerzauslösung zudem explizit wird. In diesem Sinne hängt also der Schmerz nicht von meinen Einstellungen, Vorstellungen o.ä. ab. Dennoch ist die Tatsache des Schmerzes nicht vollständig erfaßt, denn dieser Schmerz kann nur ein Schmerz sein, indem ich ihn als meinen Schmerz empfinde. Und nur dadurch, daß ich als Subjekt eine unmittelbare Zugangsweise zu dem Erleben des Schmerzes habe, wird er zu dem Schmerz, wie ich ihn empfinde, er erhält damit eine ,,subjektive Existenzweise" (S. 114).
5. Die Verbindung zwischen Bewußtsein und Intentionalität besteht darin, daß intentionale Zustände immer bewußte intentionale Zustände sind und jeder unbewußte intentionale Zustand zumindest potentiell bewußt ist. Das soll im nächsten Abschnitt noch deutlicher ausgeführt werden.
6. Die Figur/Hintergrund-Struktur bewußten Erlebens besagt, daß, in Analogie zur Wahrnehmung, eine Trennung zwischen einer aus dem Hintergrund herausgelösten Struktur und dem Hintergrund selbst stattfindet, die jegliche Wahrnehmung strukturiert. Die Ordnung des Visuellen ist dabei immer eine Ordnung in gegenständliche Formen, die als Figur vor einem meist undifferenzierter wahrgenommenen Hintergrund im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Wie aus der Wahrnehmungspsychologie jedoch bekannt ist, kann dies ein sehr dynamischer Prozeß sein, in dem ständig Figur und Hintergrund neu strukturiert werden. ,,Dies hat zur Folge, daß alles (normale) Sehen ein Sehen als ist, alles (normale) Wahrnehmen ein Wahrnehmen als und, in der Tat, alles Bewußtsein ein Bewußtsein von irgend etwas als so-und-so" (S. 154).
7. Der Aspekt des Vertrauens zeigt sich, wie Searle meint, in Anlehnung an die Aussage von Wittgenstein, recht deutlich. Dieser fragt: ,,Hast du deinen Schreibtisch wiedererkannt, wie du heute morgen in dein Zimmer getreten bist" (Wittgenstein, 1997, § 602). Wittgenstein geht davon aus, daß es diesen Akt des Wiedererkennens dabei nicht gibt. Aber die Tatsache, daß mir mein Zimmer nicht fremd vorkommt, wenn ich es betrete, fordert dennoch eine Erklärung. Was auf das Wiedererkennen des Zimmers zutrifft, muß auch auf das Wiedererkennen im allgemeinen zutreffen, meint Searle und nennt nun diese Tatsache, daß mir Dinge von Grund auf als diese Dinge vertraut sind, den Aspekt des Vertrauens. Dieses Phänomen ist nicht ein besonderer Vorgang, der zum visuellen Erleben dazukommt, wie im Ausdruck vom ,,Gefühl des Vertrauens" gesagt wird, sondern die Wahrnehmung der Objekte selbst entsteht auf dem Hintergrund dieses Gefühls des Vertrauten. Gerade diese unmittelbare Vertrautheit, die uns normalerweise diese Tatsache überhaupt nicht hinterfragen läßt (wie Wittgenstein das tut), ist im pathologischen Falle, als ein außerordentlich unverständliches Phänomen, nicht mehr in der Weise vorhanden. Searle nimmt nun an, daß diese Kategorien, die unsere Wahrnehmung von Anfang an strukturieren und Erfahrungen überhaupt erst als Erfahrungen möglich machen, bereits vor der Wahrnehmung existieren müssen, denn ohne sie wäre Wahrnehmung gar nicht als ein Strukturierungsprozeß möglich. ,,So wird denn die Wahrnehmung deshalb den Aspekt des vertrauten haben, weil die sie ermöglichenden Kategorien selbst vertraute Kategorien sind (...) Im vorhinein existierende Kategorien implizieren nun aber frühere Vertrautheit mit den Kategorien, deshalb stehen die Wahrnehmungen unter dem Aspekt des Vertrauten" (S.158/159).
8. Ü berfließen bedeutet: ,,Bewußtseinszustände haben im allgemeinen einen Bezug, der über ihren unmittelbaren Inhalt hinausreicht" (S. 159). Ein Beispiel dafür könnte sein: Das Hören eines Musikstückes, dem ich aufmerksam zuhöre, kann mich dabei z.B. in Bewußtseinsbereiche leiten, die weit ab von dem reinen Hören der Töne, der Melodieführung und der Gesamtkomposition des Stückes sind. Mitunter kommen mir dabei Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, die plötzlich auftauchen und mir als völlig unerwartet, spontan und kreativ erscheinen. Dies kann dieses Überfließen des unmittelbaren Inhaltes, denke ich, einigermaßen beschreiben helfen.
9. Das Zentrum und die Peripherie: Die Tatsache, daß wir das Maß der Aufmerksamkeit, das wir einer Tätigkeit widmen, in gradueller Abstufung einteilen, bewirkt, daß wir Dinge tun können, ohne bewußt darauf zu fokussieren, und andere Dinge gleichzeitig erledigen, denen wir aber zu diesem Zeitpunkt mehr Aufmerksamkeit widmen. Während ich mich intensiv mit philosophischen Gedanken auseinandersetze, werde ich kaum die Sitzfläche spüren, auf der ich sitze. Wenn ich nun allerdings zu lange auf der selben Stelle sitze und mir dabei die Beine ,,einschlafen", werde ich plötzlich genötigt, meine Aufmerksamkeit auf den Körper zu richten. Searle betont allerdings, daß oftmals der Eindruck entsteht, die Dinge, denen wir keine (oder sehr wenig) Aufmerksamkeit schenken, seien ,,unbewußt" getan worden. Dies wird sich aber im nächsten Abschnitt als zweifelhaft herausstellen, wenn Bewußtsein und Unbewußtes zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.
10. Randbedingungen sind Bedingungen der allgemeinen ,,raum-zeit-sozio-biologischen Lage". Diese müssen nicht unbedingt im Zentrum stehen, sie werden, wie das zuvor beschriebene Phänomen, oft erst durch eine Störung des Normalen zu einem Problem, wenn einen plötzlich ein Gefühl überkommt, diese peripheren Bedingungen seien zusammengebrochen. Im pathologischen Fall (z.B. cerebrale Schädigung nach Schlaganfall) könnte das eine anhaltende Desorientierung sein, die zeigt, daß die Orientierungsfähigkeit eine der wesentlichen Randbedingungen für eine normale Bewußtseinstätigkeit darstellt.
11. Stimmung: sie liefert oftmals die Tönung in Form einer ,,Grundstimmung", vor deren Hintergrund die anderen Bewußtseinsvorgänge ablaufen. Dies muß keine intentionale Stimmung sein, die auf eine bestimmte Absicht gerichtet ist, sondern kann auch in dieser Hintergrundaktivität all unsere bewußten Intentionalitätsformen durchziehen, ohne daß sie selbst intentional sein muß. Auch hier findet man, z.B. beim abrupten Wechsel einer solchen Stimmung, daß dadurch eine solche Verlagerung der Aufmerksamkeit eintritt, die uns erst diese Hintergrundstimmung deutlicher bewußt werden läßt.
12. Die Lust/Unlust-Dimension: ein Bewußtseinszustand als ganzer wird immer auch als lustvoll versus unlustvoll in all den graduellen Abstufungen, die auf dieser kontinuierlichen Skala möglich sind, charakterisiert. Drei Fehler23, was die Charakterisierung und die theoretische Einordnung von Bewußtsein anbelangt, nennt Searle hier noch explizit (vgl. Searle, 1996, S. 164 ff.):
1. Alle Bewußtseinszustände sind Zustände des Selbst-Bewußtseins.
2. Wissen vom Bewußtsein wird durch ein besonderes Vermögen der Introspektion erlangt.
3. Wissen von unseren eigenen Bewußtseinszuständen ist unkorrigierbar. Wir können uns über solche Dinge nicht irren.
Selbst-Bewußtsein betrifft dabei eine ,,außerordentlich differenzierte Form der Empfindsamkeit" (S. 166), die wir nicht für alle Bewußtseinszustände unterstellen können. Gerade durch die Charakterisierung der Merkmale des Zentrums und des Hintergrundes läßt sich »self-consciousness« als eine Form der Aufmerksamkeit auf die eigenen Bewußtseinszustände und die Möglichkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit nicht auf das Objekt, den Gegenstand des bewußten Erlebens, sondern auf den Prozeßdes Erlebens selbst richten. In diesem Sinne ist aber self-consciousness ein spezieller Fall von Bewußtseinszuständen und nicht in einem trivialen Sinn gemeint, daß wir prinzipiell die Möglichkeit hätten, solche Aufmerksamkeitsverschiebungen durchzuführen Introspektion: in Anlehnung an das vorher Gesagte gilt auch hier, daß wir zur Introspektion sicherlich in dem Sinne fähig sind, in dem wir unsere Gefühle und Gedanken beobachten können. Wird dabei allerdings angenommen, Introspektion sei eine besondere Fähigkeit, die uns erlaubt, in Analogie zur visuellen Wahrnehmung ein Objekt der Wahrnehmung und ein wahrnehmendes Subjekt zu unterscheiden, dann kann dieser Schluß nur falsch sein. Denn wir haben in Bezug auf unsere eigenen Bewußtseinszustände keine Möglichkeit, diese quasi ,,von außen" zu betrachten, da bereits die konstitutiven Merkmale gezeigt haben, daß Bewußtsein ontologisch gesehen immer eine Ontologie der ersten Person ist.
Unkorrigierbarkeit: sie entsteht aus der falschen Annahme, daß die Tatsache der subjektiven Ontologie gleichbedeutend ist mit der erkenntnistheoretischen Gewißheit. Dabei beruht diese Scheinsicherheit eben nur auf der Nichtunterscheidbarkeit von Erscheinung und Wirklichkeit. Das Kriterium, sich irren zu können, verlangt eine eindeutige Aussage darüber, was Erscheinung ist und wie die Wirklichkeit beschaffen ist. Doch dies läßt sich für die subjektive Ontologie nicht angeben, wenn man sie vom eigenen Standpunkt aus betrachtet. Deshalb folgt daraus aber noch nicht, daß nicht andere Menschen die Fähigkeit hätten, unsere Selbsttäuschungen zu sehen und unseren Irrtum zu enttarnen.
2.2.5 Unbewußtes und Bewußtsein
Insbesondere durch die Psychoanalyse wurde der Begriff des Unbewußten in das Zentrum der psychologischen und auch philosophischen Tradition gerückt. Nun sind jedoch gerade die Kognitionswissenschaften eine Tradition, die aus der Forschung nach der Tätigkeit des Unbewußten eine Tugend und im Gegenzug die Erforschung des Bewußtseins aus ihrem Arbeitsfeld verbannt haben, so sieht zumindest Searle die Kognitionswissenschaften an, indem er diese Sichtweise kulminieren läßt in dem Satz von Lashley: ,,Keine Tätigkeit des Geistes ist jemals bewußt".
Die zentrale These, die Searle nun zu beweisen sucht, ist die: ,,Der Begriff des unbewußten Geisteszustandes impliziert Bewußtseinszugänglichkeit. Wir haben keinen Begriff vom Unbewußten außer als von etwas potentiell Bewußtem" (S.175).
Die gängige Idee des Unbewußten ist nach Searle ,,die Idee von einem bewußten Geisteszustand minus dem Bewußtsein", einem nach dem Vorbild des Bewußtsein entworfenen Geisteszustand, ,,der hier und da zufälligerweise unbewußt ist". Und dies erinnert dann an Freud's Unterscheidung zwischen bewußten, »vorbewußten« und unbewußten Zuständen, deren Unbewußtsein darin besteht, daß sie ,,wie Gegenstände in der dunklen Dachkammer des Geistes gelagert sind" (S. 176).
Für die Klärung dieser Frage unterscheidet Searle zunächst einmal zwischen unbewußten Geisteszuständen und solchen, die keine sind. Zwei Beispiel verdeutlichen das: wenn ich die Ü berzeugung habe, daß der Eiffelturm in Paris steht, auch wenn ich gerade nicht an ihn denke, und zum andern diejenige, daß meine Nervenfasern im ZNS myelinisiert sind, dann besteht der wesentliche Unterschied der beiden darin, daß die zweite Überzeugung überhaupt kein Geisteszustand ist, ,,da die Strukturzustände meiner Nervenfasern nicht selbst Bewußtseinszustände sein könnten, weil an ihnen überhaupt nichts Geistiges ist" (S. 177). Um diese Zustände denn auch terminologisch aufzuzeigen, werden die Zustände, die keine Geisteszustände sind, als ,,nichtbewußt" bezeichnet, diejenigen Geisteszustände, an die ich gerade nicht denke, sind demnach ,,unbewußt".
Eine Theorie des Unbewußten muß nach Searle zwei Auflagen erfüllen: erstens muß sie den Unterschied zwischen wirklich intentionalen Phänomenen (intrinsisch intentional) und Als- ob-intentionalen Phänomenen erklären können und zweitens muß sie erklären können, ,,daß intentionale Zustände ihre Erfüllungsbedingungen nur unter gewissen Aspekten repräsentieren und daß diese Aspekte für die betreffende Person wichtig sind. (...) Wir können sagen, daß jeder intentionale Zustand eine gewisse Aspektgestalt hat, die Teil seiner Identität ist" (S. 178) .
Die Idee, daß wir den Begriff von einem unbewußten Geisteszustand nur so verstehen können, daß er von einem möglichen Inhalt des Bewußtseins handelt, von einem Ding, das zwar nicht bewußt ist und vielleicht auch aus verschiedenen Gründen nicht zum Bewußtsein gebracht werden kann, das aber dennoch die Art Ding ist, das bewußt sein könnte oder bewußt hätte sein können. Diese Idee, daß alle unbewußten intentionalen Zustände im Prinzip bewußtseinszugänglich sind, nenne ich »das Verbindungsprinzip« (»Connection Principle«) (S.179).
In Ansätzen soll die Argumentation, die Searle dazu vorlegt, aufgezeigt werden (vgl. dazu Searle, S.179 ff).
1. ,,Es gibt einen Unterschied zwischen intrinsischer Intentionalität und Als-ob- Intentionalität; nur intrinsische Intentionalität ist eigentlich geistig". Dies läßt sich nun anhand der Beispiele und dem Versuch, aus der gegenteiligen Annahme Schlußfolgerungen zu ziehen, leicht einsehen.
2. ,,Unbewußte intentionale Zustände sind intrinsisch". Einem Menschen im Schlaf sprechen wir demnach immer noch intrinsische intentionale Zustände zu, auch wenn diese aktuell nicht realisiert werden.
3. ,,Intrinsisch-intentionale Zustände - seien sie bewußt, seien sie unbewußt - haben immer eine Aspektgestalt." Unter einer solchen Aspektgestalt werden alle Intentionen in einer bestimmten Weise, von einem bestimmten Standpunkt oder durch andere Merkmale der Person wahrgenommen.
4. ,,Das Aspekt-Merkmal läßt sich allein mit Hilfe von Dritte-Person-Prädikaten nicht erschöpfend oder vollständig charakterisieren; für eine erschöpfende Theorie der Aspektgestalt reichen solche Prädikate nicht aus."
Neurophysiologische Beschreibungen, auch wenn sie noch so genau wären, reichen dazu nicht aus, da sie ,,keine Aspekt-Tatsachen bilden". Zudem können neurophysiologische Tatsachen immer für ,,eine beliebige Menge geistiger Tatsachen kausal hinreichend sein" und auch eine gesetzesartige Verknüpfung der Neurophysiologie mit den geistigen Tatsachen erforderte immer noch eine Schlußfolgerung, die diesen Graben nicht zu überwinden vermag.
5. ,,Doch die Ontologie der unbewußten Geisteszustände (zum Zeitpunkt ihres Unbewußt-Seins) besteht einzig und allein in der Existenz rein neurophysiologischer Phänomene."
Die Tatsache, daß jemand, der schläft, offensichtlich auch intentionale Geisteszustände hat, die eben zu diesem Zeitpunkt unbewußt sind. Wie aber sollten solche Geisteszustände existieren? ,,Nun, denn die einzigen Tatsachen, die existieren können, während er völlig ohne Bewußtsein ist, sind neurophysiologische Tatsachen. (...) Solange diese Zustände völlig unbewußt sind, gibt es einfach nichts außer neurophysiologischen Zuständen und Vorgängen. Der scheinbare Widerspruch zwischen der einzigen Existenz von neurophysiologischen Zuständen und der Tatsache, daß diese aber ihrerseits keine Aspektgestalt haben und damit intentionale Zustände nicht erklären könnten, löst sich nun durch den nächsten Schritt auf.
6. ,,Der Begriff von einem unbewußten intentionalen Zustand ist der Begriff von einem Zustand, der ein möglicher bewußter Gedanke oder ein mögliches bewußtes Erlebnis ist".
Die einzige Möglichkeit, der intentionalen Zustände, auch während ihres UnbewußtSeins ihre Aspektgestalt beizubehalten, ist die Tatsache, daß diese unbewußten Intentionalen Zustände mögliche bewußte Zustände sind.
7. ,,Die Ontologie des Unbewußten besteht in objektiven Merkmalen des Hirns, die fähig sind, subjektive bewußte Gedanken zu verursachen". Das bedeutet nun aber, daß unbewußte Zustände aufgrund ihres Kausalvermögens einer objektiven Ontologie in der Lage sind, Bewußtsein zu erzeugen. Auch Störungen, die eine mögliche Bewußtwerdung der unbewußten intentionale Zustände verhindern könnten, ändern nichts an der prinzipiellen Möglichkeit, daß Bewußtsein durch die Kausalkräfte eines unbewußten intentionalen Zustandes entstehen kann.
Searle rundet diese Argumentation ab mit der Feststellung:
Es ergibt sich folgendes Bild. In meinem Hirn spielt sich außer neurophysiologischen Vorgängen - manche bewußt, manche unbewußt - nichts ab. Von den unbewußten neurophysiologischen Vorgängen sind einige geistig, andere nicht. (...) Der Unterschied besteht darin, daß die geistigen Vorgänge für Bewußtsein in Frage kommen, weil sie fähig sind, Bewußtseinszustände zu verursachen. (...) Doch was in meinem Hirn ist mein »geistiges Leben«? Genau zweierlei: Bewußtseinszustände und solche neurophysiologischen Zustände und Vorgänge, die - unter geeigneten Umständen - fähig sind, Bewußtseinszustände hervorzubringen (S.185).
2.2.6 Kritik der kognitiven Vernunft
In diesem Teil soll noch auf die grundsätzliche Kritik Searles an der Kognitionswissenschaft eingegangen werden, indem ihre ,,wackligen Grundlagen" kurz erörtert werden. Searle's Kritik geht dabei von einer Art » Credo der Kognitionswisenschaft « aus, daß ,,das Hirn ein Computer und geistige Prozesse computational sind". Im Hinblick auf die kognitiven Prozesse wird angenommen, daß diese prinzipiell unbewußt sind. (S. 223)
,,Für die Kognitionswissenschaft ist weder die Untersuchung des Hirns noch die Untersuchung des Bewußtseins von großem Interesse oder Wert". Sie ist allein an der Untersuchung jener ,,Zwischenebene" interessiert, ,,wo sich tatsächliche kognitive Prozesse abspielen, die dem Bewußtsein unzugänglich sind. Die Mechanismen sind zwar de facto im Hirn implementiert, sie hätten aber auch in unbestimmt vielen anderen Hardware-Systemen implementiert sein können. Hirne gibt es, aber sie sind unwesentlich" (S.222).
Die Hauptfrage, die sich bei diesem Modell der Kognitionswissenschaft stellt, ist diese : ,,In welcher Beziehung genau steht das Modell zur modellierten Wirklichkeit ?" Diese Frage steht aber auch in dem unter A. erarbeiteten Entwurf des Dörner-Modells im Zentrum der Kritik und es ist mir einigermaßen unklar, in welcher Weise dies gelöst wird, nachdem es für meine Begriffe viel zu wenig thematisiert wird. Die Frage nach der genauen Beziehung zwischen Dörners Handlungsregulationsmodell und der damit simulierten Wirklichkeit bleibt unklar. Da hilft auch der Hinweis, daß ein Modell eine nützliche Funktion hat, nicht weiter.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Doch zunächst zur Kritik, die Searle allgemein an den Grundideen der Kognitionswissenschaft übt. Diese wird sich dann jeweils an geeigneter Stelle auch auf das Modell, das Dörner und Mitarbeiter vorgelegt haben, erweitern bzw. anwenden lassen. Drei Grundfragen an die kognitionswissenschaftlichen Annahmen des Computer-Modells sind zentral für die gesamten Ausführungen und diese lauten:
1. Ist das Hirn ein digitaler Computer?
2. Ist der Geist ein Computerprogramm?
3. Lassen sich Hirntätigkeiten auf einem digitalen Computer simulieren?
Die drei Fragen korrespondieren mit drei verschiedenen Auffassungen, die gegenübergestellt werden:
· Die Frage 1 läßt sich in Zusammenhang mit dem bringen, was Searle als ,,Kognitivismus" versteht, nämlich der Reduzierung des Gehirns auf eine formal arbeitende Maschine.
· Frage 2 wurde bereits früher thematisiert und stellt die Frage nach der ,,starken KI- Auffassung" dar, nämlich, daß der Geist lediglich ein Programm ist, welches auf beliebiger Hardware implementiert werden kann und nichts mehr. · Frage 3 hingegen ist die Frage nach der ,,schwachen KI", die für Searle positiv zu beantworten ist. Ein solcher Computer, der den Turing-Test besteht, ist aber dennoch keine ,,intentionale" Maschine, das wäre prinzipiell unmöglich. Die syntaktischen Operationen, die eine Maschine natürlich ausführen kann, erzeugen keine Semantik, denn diese ist ein intrinsisch geistiges Phänomen.
Die Widerlegung der 2. Frage, daß der Geist ein Computerprogramm ist, hat Searle bereits in früheren Arbeiten gegeben. Dabei belegt er seine Argumentation anhand des legendären Beispiels mit dem Chinesiscen Zimmer, in der er ausführt, daß formale Syntax des Programms nicht aus eigener Kraft ausreicht, um geistige Inhalte, wie z.B. Bedeutung zu erzeugen. Eine Version dieses verbreiteten chinesischen Zimmers läßt sich in Searle (1986, S. 30 ff.) nachlesen, hier möchte ich nur auf die Frage und die Begründung für die Antwort kurz eingehen.
Der »Sprung«, den ein formales Computerprogramm in einem Computer (im Sinne einer universellen Turing-Maschine) von der Syntax zur Semantik machen müßte, widerlegt Searle durch die einfache Argumentation, daß sich an der prinzipiellen Problematik, daß Syntax nicht direkt in Semantik transformierbar ist, nichts ändert. Dabei ist es egal, ob der Übersetzer anhand seines Wörterbuches, eines Computers oder eines Roboters (der zudem die Möglichkeit hätte umherzulaufen und aus seiner Umgebung vielerlei Informationen aufzunehmen) vorgeht. Auch diese Interaktionsfähigkeit des Roboters mit seiner Umwelt versetzt den Computer in seinem »Hirn« nicht in die Lage aus der Syntax Semantik zu machen, weil dem System die Intentionalität fehlt, bzw. ,,die Semantik der Syntaktik nicht intrinsisch ist" (S. 236).
Die Frage 3 ist in dem Sinne für Searle unproblematisch, indem die Frage nach der Simulierbarkeit des Gehirns, die er mit Ja beantwortet, nicht umgekehrt wird und daraus der Schluß gezogen wird, der Geist sei damit lediglich ein Computerprogramm, nach der legendären Formel: ,,Der Geist verhält sich zum Hirn, wie das Programm zur Hardware" (S. 225). Solange die formalen Prozesse des Hirns hinreichend genau beschreibbar sind, kann dies auch auf einem Computer simuliert werden. Der Unterschied zu der ersten Frage ist in dieser Hinsicht sehr wesentlich: Die Tatsache, daß Hirnvorgänge simuliert werden können, bedeutet noch lange nicht, daß die Tätigkeit des Hirns in einer ,,Symbolmanipulation" formaler Elemente besteht, und somit muß die Antwort auf die erste Frage: ,,Ist das Hirn ein digitaler Computer?" eindeutig mit Nein beantwortet werden.
Die Begründungen im einzelnen können hier, aufgrund der Ausführungen vorher, kurz zusammengefaßt werden, denn sie ergeben sich teilweise aus der Theorie des Bewußtseins und der prinzipiellen Argumentation, die in dem Beispiel mit dem Chinesischen Zimmer steckt.
1. Die Syntax ist an sich nichts Physisches: Computer als Apparate, die Symbole manipulieren, sind nicht durch ihre physikalischen Effekte definiert, sondern durch syntaktischen Eigenschaften der Zuordnung von Nullen und Einsen. Die ,,Vielfach- Realisierbarkeit" der syntaktischen Eigenschaften erlaubt zudem prinzipiell, aus fast allem einen solchen Computer zu bauen (der Aufwand ist natürlich wesentlich höher als bei der elektronischen Version, aber Ned Block zeigt in seinem Artikel (o.J.), daß sich logische Verknüpfungen und damit binäre Zuordnungen auch mit einem ,,Arrangement" eines Maus- und Katzen-Stall verwirklichen läßt). Diese Tatsache führt noch zu einem weiteren Problem, dem der Definierbarkeit eines Computers überhaupt, da sich aus der Vielfach-Realisierbarkeit ableiten läßt, daß auch die Syntax nicht der Physik intrinsisch ist und eine Zuordnung der Syntax zu den physikalischen Gegebenheiten auch beobachter-relativ ist. Damit wird auch das Argument widerlegt, es handele sich bei den Hirnvorgängen um Manipulationen von Sätzen im Kopf. Denn auch eine syntaktische Struktur ist von einem Benutzer abhängig, der dies als Satz verwendet (vgl. S. 236/237).
2. Die Homunculus-Theorie versucht die Prozesse, die auf höheren Ebenen ablaufen auf jeweils niederere Ebenen zu reduzieren, in der Weise, daß eine höhere Ebene durch eine jeweils tiefere Ebene beschrieben werden kann (und reduziert werden kann), bis zum Schluß die niederste Ebene einer binären Zuordnung auch von einem Computer ausgeführt werden kann. Die höheren Ebenen sind nur ,,als-ob" vorhanden, nur die niedrigste Ebene existiert im physikalischen Sinne. Allerdings argumentiert Searle, daß das System letztlich immer einen Homunculus braucht, um zu wissen, welche Zuordnungen es nun vornehmen soll, und dieser ,,Homunculus" ist der jeweilige Benutzer.
3. Syntax hat keine Kausalkräfte: die Behauptung von seiten der Kognitionswissenschaft, die diesem Kritikpunkt zugrunde liegt, ist die, daß die Mechanismen, mit denen Hirnprozesse Kognition hervorbringen, computational sind, und die Angabe der Programme, die dafür notwendig sind, führen zu den Ursachen für Kognition. Die Einzelheiten des Hirns müssen dazu überhaupt nicht bekannt sein, denn dieses liefert ja nur die ,,Hardware-Implementierung der Kognitionsprogramme" (S. 241).
Das Gegenargument sieht folgendermaßen aus: die Idee, daß es Nullen und Einsen und damit auch ein formales Programm gibt, ist bereits in dem Sinne falsch, der diesem Programme eine intrinsische Eigenschaft zuzuschreiben versucht. Denn diese Eigenschaft hat es nur aus der Sicht eines Betrachters; mithin hat das Programm ohne diesen Benutzer auch über die ,,Existenz und Ontologie des implementierenden Mediums hinaus keine wirkliche Existenz, keine Ontologie. Physikalisch gesehen gibt es so etwas wie eine separate »Programmebene « gar nicht" (S. 242).
Die Verbindung zu der Homunculus-These gibt Searle, indem er sagt: ,,Soweit die Erklärung auf ein Programm Bezug nimmt, braucht sie auch einen Homunculus" (S.249), nämlich als jemand, der die Interpretation dieses formalen Symbolismus leistet und damit der Syntax erst Bedeutung verleiht !
Explizit möchte ich noch einen Einwand der Kognitionswissenschaften und die Erwiderung, die Searle dazu gibt, zitieren, weil sie auch - dem diskursiven Charakter der Argumentation im Buch entsprechend - deutlich macht, wie Searle ein sehr gewichtiges Argument widerlegt.
Einwand: Ja, aber nehmen wir einmal an, wir könnten solche Muster im Hirn entdecken. Die computationale Kognitionswissenschaft braucht nichts weiter als das Vorhandensein solcher intrinsischer Muster.
Erwiderung: Natürlich kann man solche Muster entdecken. Im Hirn gibt es mehr Muster, als man je braucht. Doch selbst wenn wir den Bereich der Muster durch bestimmte Auflagen (z.B. passende Kausalverbindungen und entsprechende kontrafaktische Zusammenhänge) einschränkten, dann wäre durch die Entdeckung der Muster immer noch nicht ganz geklärt, was wir erklären wollen. Wir wollen ja nicht herausfinden, wie ein Homunculus von draußen den Hirnvorgängen eine computationale Interpretation zuordnen könnte. Vielmehr wollen wir erklären, auf welche Weise es zu gewissen konkreten biologischen Phänomenen (wie dem bewußten Verstehen eines Satzes oder dem bewußten visuellen Erleben einer Szene) kommt. Diese Erklärung verlangt ein Verständnis der nackten physischen Vorgänge, die diese Phänomene hervorbringen (S.249).
4. Das Hirn macht keine Informationsverarbeitung: dies stellt nun das zentrale Thema dar, indem es die kognitionswissenschaftliche Vorgehensweise (und damit auch den Ansatz Dörners !) gründlich in Frage stellt. Der Einwand der Kognitionswissenschaft ist hier für Searle, daß gesagt wird, das Hirn sei ein informationsverarbeitendes System. Nun ist zwar auch ein Computer ein System, das Informationen verarbeitet, aber die Informationsverarbeitung ist dem Gehirn intrinsisch, das ,,Hirn dient zur Informationsverarbeitung". Wenn nun aber mittels Computer ,,dieselbe Information computational verarbeitet" wird, dann ,,haben Computermodelle eine völlig andere Rolle als zum Beispiel Computermodelle des Wetters" (S.250). Auf eine Forschungsfrage gebracht, lautet dieser Einwand dann:
,,Sind die computationalen Verfahren, mit denen das Hirn Information verarbeitet, dieselben wie die, mit denen Computer dieselbe Information verarbeiten?"
Die Annahme, daß das Gehirn in derselben Weise Informationen verarbeitet wie ein Computer, nennt Searle ,,einen der schlimmsten Fehler in der Kognitionswissenschaft" (S. 250). Was passiert nun in einem Computer? Eine Person stellt eine für den Computer verwertbare ,,syntaktische Realisierung der Informationen bereit", die dieser dann aufgrund seiner physikalischen Beschaffenheit implementieren kann24. Diese Implementierung kann von außen sowohl syntaktisch wie auch semantisch interpretiert werden, aber - und das ist der fundamentale Unterschied - ,,all das ist im Auge des Betrachters". Die semantische Interpretation steckt ja nicht im System, sondern findet durch einen Betrachter statt.
,,Im Falle des Hirns ist keiner der relevanten neurobiologischen Vorgänge beobachter-relativ (obwohl sich diese Vorgänge natürlich - wie alles in der Welt - von einem beobachter-relativen Standpunkt beschreiben lassen), und die Besonderheit der Neurophysiologie ist von entscheidender Bedeutung" (S. 251).
Schluß
Dieser letzte Absatz führt uns in gewisser Weise wieder zu dem zurück, was am Anfang dieses Abschnittes über die Struktur des Bewußtseins gesagt wurde. Der Unterschied zwischen den computationalen Vorgängen eines Computermodells, einer Simulation, oder der zunehmend komplexer organisierten Modelle künstlicher Intelligenz, ist von neurophysiologischen Vorgängen völlig verschieden: neurophysiologische Vorgänge erzeugen, auf bisher noch nicht genau erforschten Wegen, geistige Phänomene und insbesondere das, was wir hier als zentrales Phänomen charakterisiert hatten: Bewußtsein. Bewußtsein, welches durch neurophysiologische Abläufe entsteht, ist aber immer verbunden mit einem subjektiven Erleben der Wirklichkeit, die in diesem Sinne eben ontologisch subjektiv ist und prinzipiell nicht hinreichend durch objektive wissenschaftliche Beschreibungen erschöpft werden kann. Eine wissenschaftliche Untersuchung und Erklärung dieses Gegenstandes wird sich dieser Tatsache stellen müssen und ihre Methoden an diesen Gegebenheiten ausrichten, um zu einem umfassenderen und angemesseneren Modell der Wirklichkeit zu gelangen. Mitunter könnte dieser Ansatz, das subjektive Erleben einer als ,,Ontologie der ersten Person" verstandenen Bewußtseinstätigkeit einzubeziehen, in der Psychologie zu einem kreativeren Umgang und auch einer differenzierteren Sicht menschlicher Wirklichkeit beitragen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Literaturverzeichnis
Beckermann, A. (1996). Searles Kritik der kognitiven Vernunft [WWW-document]. URL http://ibm.rhrz.uni-bonn.de/~uzs90z/searle.html .
Bieri, P. (1996). Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel? In T. Metzinger (Hrsg.), Bewußtsein - Beiträge der Gegenwartsphilosophie (S. 61-77). Zürich: Schöningh, 3.Aufl.
Block, N. (o.J.). The Mind as the Software of the Brain [WWW-document]. URL http://www.nyu.edu/gsas/dept/philo/faculty/block/papers/msb.html .
Bunge, M. & Ardila, R. (1990). Philosophie der Psychologie. Tübingen: J.C.B. Mohr.
Deppe, S. ( o.J. ). Intentionalität und Bewußtsein in Searles Philosophie des Geistes [WWW-document]. URL http://omnibus.unifreiburg.de /~deppe/texte/pphilosoie / searle.htm.
Dörner, D., Schaub, H., Stäudel, T. & Strohschneider, S. (1988). Ein System zur Handlungs-regulation oder - Die Interaktion von Emotion, Kognition und Motivation . Sprache & Kognition, 4, 217-232.
Dörner, D. (1994). Über die Mechanisierbarkeit der Gefühle. In S. Krämer (Hrsg .), Geist - Gehirn - künstliche Intelligenz (S. 131-161). Berlin: Walter de Gruyter.
Dörner, D. (1998). Emotionen, kognitive Prozesse und der Gebrauch von Wissen In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich C, Serie II Kognition, Band 6 Wissen (S. 301-333). Göttingen: Hogrefe.
Dörner, D., Kreuzig, H.W., Reither, F. & Stäudel, Th. (Hrsg.) (1983 ). Lohausen: Vom Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität. Bern: Huber.
Dörner, D., Hamm, A., Hille, K. (1996). EMOREGUL: Beschreibung eines Programmes zur Simulation der Interaktion von Motivation, Emotion und Kognition bei der Handlungsregulation. Lehrstuhl Psychologie II, Universität Bamberg, Memorandum Nr. 2 (April 1996) (als WWW-Dokument verfügbar über: URL http://www.uni-bamberg.de/~badp1/psi.htm ).
Hebb, D. O. (1946). On the Nature of Fear. Psychological Review, 53, 259-276.
Hille, K. & Bartl, Ch. (1997). Von Dampfmaschinen und künstlichen Seelen mit Temperament: Systemmodelle in der Psychologie und die Möglichkeit ihrer Überprüfung. Lehrstuhl Psychologie II, Universität Bamberg, Memorandum Nr. 24 (Oktober 1997).
Larsen, R.J. & Ketelaar, T. (1991). Personality and Suspectibility to Positive and Negative Emotional States. Journal of Personality and Social Psychology, 61, 132- 140
Metzinger, T. (1994). Schimpansen, Spiegelbilder, Selbstmodelle und Subjekte.
In S. Krämer (Hrsg.), Geist - Gehirn - künstliche Intelligenz. (S. 131-161) Berlin: Walter de Gruyter.
Metzinger, T. (1996). Das Problem des Bewußtseins. In T. Metzinger (Hrsg.), Bewußtsein - Beiträge der Gegenwartsphilosophie. Zürich: Schöningh, 3.Aufl.
Nagel, T. (1992). Der Blick von nirgendwo. Frankfurt a.M.:Suhrkamp.
Penrose, R. (1991). Computerdenken: die Debatte um künstliche Intelligenz, Bewußtsein und die Gesetze der Physik. Heidelberg: Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft (Original: The Emporers New Mind. Oxford University Press, New York, 1989).
PSI-Homepage: [WWW-document]. URL http://www.uni-bamberg.de/~badp1/psi.htm
Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules, Knowledge: Signals, Signs and Symbols and Other Distinctions in Human Performence Models In IEEE - Transactions, Systems, Man, Cybernetics, SMC 13, S.257 -267
Schwemmer, O. (1994). Die symbolische Existenz des Geistes. In S. Krämer (Hrsg.), Geist - Gehirn- künstliche Intelligenz (S. 3-40). Berlin: Walter de Gruyter.
Searle, J. R. (1986). Geist, Hirn und Wissenschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. (Originalausgabe: Minds, Brains and Science. The 1984 Reith Lectures. British Broadcasting Corporation).
Searle, J. R. (1996). Die Wiederentdeckung des Geistes. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag (Originalausgabe: The Rediscovery of the Mind. Massachusetts Institute of Technology, 1992).
Wittgenstein, L. (1997). Philosophische Untersuchungen. In L.Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914-1916. Philosophische Untersuchungen (Werkausgabe in 8 Bänden, S.228-580). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
[...]
1 Südwest 3 (1998). Reihe: Abenteuer der Wissenschaft: So lautet der Titel des in diesem Jahr neu erscheinenden Buches von Dietrich Dörner.
2
3 Wenn ich im Folgenden von ,,Dörner" spreche, sind natürlich seine Mitarbeiter und Mitautoren der Artikel jeweils mitgemeint, ohne daß ich sie jedesmal explizit erwähne.
4 Worte in Großbuchstaben und Umrandungen beziehen sich dabei direkt auf die von Dörner et al. postulierten Konstrukte.
5 Es gibt im Deutschen meines Erachtens keinen sinnvollen Begriff, der das englische ,,computation" oder die Idee eines ,,computational approach" besser wiedergeben könnte, deshalb verwende ich gezwungermaßen diesen ,,häßlichen Neologismus" (H.P.Gavagai, Übersetzer von Searle,1996).
6 T. Metzinger weist in seinem Aufsatz (1994): Schimpansen, Spiegelbilder, Selbstmodelle und Subjekte darauf hin, daß der Moment der ,,Selbsterkenntnis" (im Sinne des Sich-im- Spiegel-Wiedererkennens) als einer grundlegenden Funktion des Bewußtseins erst bei Schimpansen im Vergleich zu Rhesusaffen möglich ist.
7 Von der ,,vergeistigten" Dampfmaschine liegen inzwischen mehrere Versionen vor. Aber nur diese hat noch die Keule zur Selbstverteidigung behalten ...
8 Rasmussen unterscheidet bei der Problemlösung drei Stufen: 1. Automatismen , 2. fähigkeits- bzw. regelgestütztes Verhalten und 3. wissensgestütztes Verhalten, die beim Problemlöseprozeß stufenartig durchlaufen werden können, je nachdem auf welcher Stufe eine Lösung erreicht wird.
9 Die Arbeiten zu PSI werden in dem von der DFG geförderten Autonomie-Projekt (Autonomie: Konstruktion einer Theorie zur Erklärung und Prognose menschlichen autonomen Handelns in komplexen Realitätsbereichen) koordiniert.
10 EMOREGUL kommt von EMOtion und REGULation.
11 WWW-Adresse, siehe Literaturverzeichnis.
12 Dieser Abschnitt bezieht sich auf Hille und Bartl (1997).
13 zitiert nach: Bieri, Peter (1996). Was macht Bewußtsein zu einem Rätsel ?
14 vgl. dazu die Kritik Searles an der Einführung einer solchen ,,Zwischenebene" in Searle, 1996, S. 222.
15 Die Zitate dieses Abschnittes beziehen sich jeweils auf Metzinger (1996), soweit sie nicht anders gekennzeichnet sind.
16 In dieser Hinsicht haben Dörners Arbeiten, auch wenn sie in mancher Weise zu Kritik Anlaß geben, auch sehr innovativen Charakter!
17 Die nicht näher bezeichneten Text- und Seitenangaben dieses Teiles beziehen sich auf Searle (1996).
18 Intrinsisch verwendet Searle im Sinne eines von einem Beobachter unabhängig existierenden Merkmals der Welt (z.B. die Masse eines Objektes), im Gegensatz zu denjenigen Merkmalen, die beobachter-relativ sind, wie z.B. der Verwendung eines Objektes als Badewanne.
19 Dies kann trotz der teilweise doch recht arroganten und selbstgefälligen Art Searles auch als sehr sympathischer Zug in seiner Arbeit gewertet werden, daß er Dinge offen anspricht, die für seine Sichtweise fraglich oder unsicher sind oder von denen er sagt, daß sie ihm ,,Kopfschmerzen" bereiten; in Hinblick auf das Verständnis anderer Autoren sagt er:...,,denn es ist ja keineswegs ausgeschlossen, daß ich sie genauso kraß mißverstehe wie sie mich" (S.10) - vgl. dazu den Beitrag von A. Beckermann, (1996),.s. Literaturverzeichnis.
20 Dazu mehr in seinem vorletzten Buch: The Construction of Social Reality" (1995), dt: Die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit - Zur Ontologie sozialer Tatsachen, 1997; Reinbek: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
21 In neueren sog. konnektionistischen Ansätzen wird allerdings eine ,,parallel-distributive" Informationsverarbeitung postuliert im Anschluß an die Erforschung sog. ,,neuronaler Netzwerke".
22 Intentionalität kann allerdings auch in solch luziden Traumerlebnissen eine Rolle spielen, in denen durch Lernen und Übung manchen Menschen eine zunehmende Kontrolle über das Traumgeschehen gelingt und sie so aus der passiven Zuschauerrolle heraustreten können, vgl. Godwin, M. (1995). Der Traum. München:Knesebeck, S. 6 ff.
23 Diese ,,Fehler" betreffen vornehmlich klassische Definitionen von Bewußtsein, vgl. dazu Deppe (o.J.), S.7.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Anlass dieser Arbeit?
Der Anlass war eine Fernsehsendung, in der Dietrich Dörner seine Idee des "Bauplans für eine Seele" vorstellte, was die Autorin dazu anregte, die Thematik differenzierter zu betrachten.
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel ist, einen Überblick über Dietrich Dörners "PSI-Theorie" oder "Theorie der Handlungsregulation" zu geben und zu zeigen, wie diese Konzepte zur Implementierung von EMOREGUL führten. Außerdem wird die Kritik von John Searle an der Computation von Emotionen beleuchtet.
Was sind die Grundannahmen des Systems zur Handlungsregulation nach Dörner?
Die Grundannahmen betreffen die Gedächtnisstruktur (Tripel-Netzwerk: sensorisch, motorisch, motivatorisch) und das Konzept der Absicht als Bündelung von Elementen aus verschiedenen Netzwerken.
Wie entsteht Emotion im Modell der Handlungsregulation?
Emotion entsteht als Ergebnis der Nicht-Übereinstimmung zwischen dem aktuellen Umgebungsbild und dem im Erwartungshorizont abgelegten Vorrat an möglichen Situationen.
Was ist die Funktion von Emotionen nach Dörner?
Emotionen modulieren psychische Prozesse (Denken, Wahrnehmung, Motivation) und sind mit Verhaltensprädispositionen verbunden.
Was ist EMO und wie funktioniert es?
EMO ist ein Computermodell, das die Annahmen der Handlungsregulationstheorie in prüfbare Hypothesen überführt. Es simuliert ein System mit Bedürfnissen, Motiven, Planungsprozessen und emotionalen Modulationen.
Was sind die Konstellationsparameter in EMO?
Die Konstellationsparameter umfassen Wichtigkeit, Dringlichkeit, Unbestimmtheit, Kompetenzgrad, Furcht/Hoffnung und Bedürfnisdruck.
Was ist EMOREGUL?
EMOREGUL ist ein Simulationsprogramm, das eine noch stärker formalisierte und mathematische Beschreibung von EMO bietet. Es ist Teil der umfassenden PSI-Theorie der Handlungsregulation.
Welche Fragen soll EMOREGUL klären?
EMOREGUL soll klären, wie Menschen Ziele setzen, sich für Ziele entscheiden und zur Erreichung ihrer Ziele vorgehen, in Abhängigkeit von Bedürfnissen, Fähigkeiten und der Umgebung.
Welche Handlungsmöglichkeiten stehen EMOREGUL zur Verfügung?
Dem System stehen drei Möglichkeiten des Handelns zur Verfügung: Explorieren, Planung und Agieren (Tun).
Wie wird die PSI-Theorie wissenschaftstheoretisch begründet?
Die systemtheoretische Beschreibung wird aufgrund der Dynamik, Vernetztheit und Intransparenz psychischer Prozesse favorisiert. Die Umsetzung als Computersimulation ermöglicht die Darstellung und Überprüfung der Abläufe des Systems.
Wie können Computersimulationen überprüft werden?
Überprüfungsmöglichkeiten sind die Prüfung auf interne Plausibilität, externe Kompatibilität, strukturelle Ähnlichkeit zwischen Modell und Realität sowie Übereinstimmung zwischen Modellverhalten und natürlichem Verhalten.
Was ist das Körper-Geist-Problem?
Das Körper-Geist-Problem behandelt die Frage, wie in einem physikalischen Universum die Entstehung von Bewusstsein möglich ist.
Welche Kritik übt Searle am Materialismus?
Searle kritisiert verschiedene materialistische Auffassungen, die geistige Phänomene reduzieren oder eliminieren, und betont die Bedeutung des Bewusstseins und der subjektiven Erfahrung.
Was versteht Searle unter Intentionalität und Bewusstsein?
Intentionalität ist die Gerichtetheit von Geisteszuständen auf Objekte oder Sachverhalte. Bewusstsein ist ein biologisches Merkmal des Gehirns, das durch neurobiologische Vorgänge verursacht wird.
Welche Strukturmerkmale hat das Bewusstsein nach Searle?
Die Strukturmerkmale umfassen endlich viele Modalitäten, Einheit, Intentionalität, Subjektivität, Figur/Hintergrund-Struktur, Aspekt des Vertrauens, Überfließen, Zentrum und Peripherie, Randbedingungen und Stimmung.
Wie definiert Searle das Unbewusste?
Der Begriff des unbewussten Geisteszustands impliziert Bewusstseinszugänglichkeit. Unbewusste Zustände sind mögliche bewusste Gedanken oder Erlebnisse.
Welche Kritik übt Searle an der kognitiven Vernunft?
Searle kritisiert die Annahme, dass das Gehirn ein Computer ist und geistige Prozesse computational sind. Syntax erzeugt keine Semantik, und das Hirn macht keine Informationsverarbeitung im gleichen Sinne wie ein Computer.
- Quote paper
- Samuel Mayer (Author), 1998, Computationale Modelle oder Phänomene des Geistes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95927