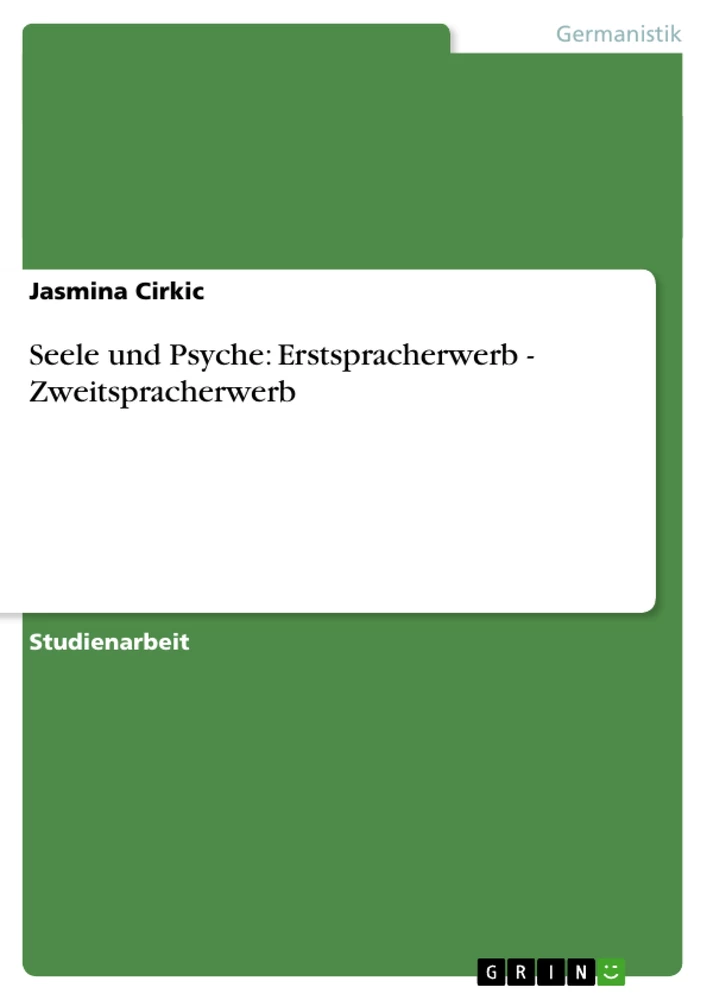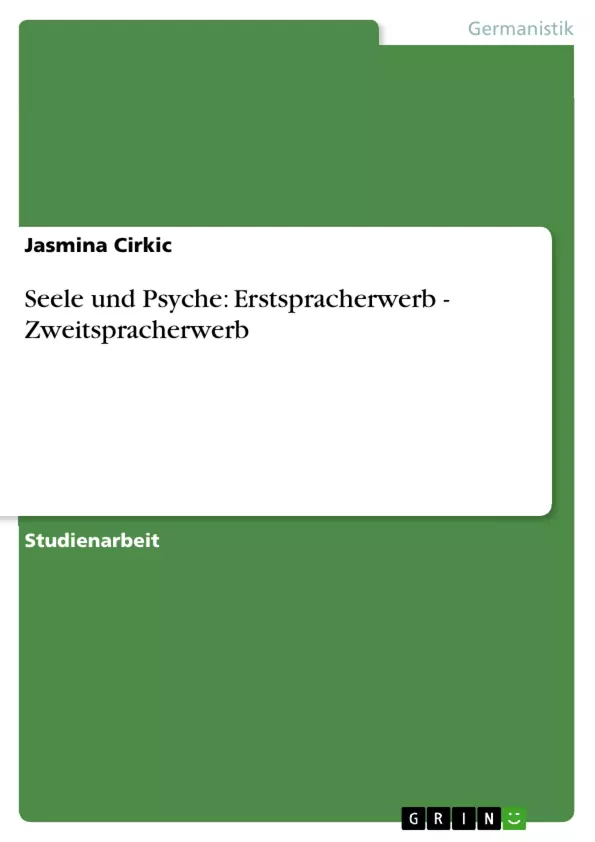Von Geburt an befindet sich ein Kind in einer Gemeinschaft, die hauptsächlich mit dem Mittel Sprache kommuniziert und die sich von Anfang an auch verbal an das Kind richtet. Nicht nur Kindern erschließt sich die Welt durch Sprache. Will es in der Sprachgemeinschaft bestehen, so ist das Kind gezwungen, die Sprache zu erlernen. Wenn Kinder beginnen, sich ihre Welt durch Wörter anzueignen, dann machen auch Erwachsene dabei immer wieder neue Erfahrungen in ihrem eigenen Umgang mit Sprache.
Die Frage, ob Kinder Wortsprache passiv durch Imitation oder aktiv durch das Verstehen ihrer unmittelbaren Umwelt verstehen, ist immer noch aktuell, denn der Spracherwerb kleiner Kinder ist im allgemeinen eine bemerkenswerte Leistung des Menschen. Hierüber gibt es unterschiedliche Theorien und Erklärungsversuche. Spracherwerbstheorien bilden das Fundament für mögliche Erklärungsmuster. Man unterscheidet zwischen den nativistischen und den funktionalen, der interaktionistischen, kognitiven und behavioristischen Ansätzen.
Die folgende Ausarbeitung betrachtet im ersten Teil die wesentlichen Aspekte des kindlichen Spracherwerbs bzw. das Erlernen sprachlicher Strukturen. Darauf folgt eine Darstellung der etablierten Spracherwerbstheorien (Skinner, Chomsky, Piaget), um anschließend dialogische und kommunikative Gesichtspunkte verbaler Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen zu betrachten. Unter Erstspracherwerb versteht man den ungesteuerten Erwerb der Muttersprache des Kindes. Beim Lernen der ersten Sprache lernt das Kind keineswegs nur diese eine Sprache, sondern es lernt eine Menge über Sprache überhaupt.
Im zweiten Teil soll versucht werden, den Zweitspracherwerb verständlich darzustellen. Es gibt den ungesteuerten Zweitspracherwerb, so beispielsweise bei Arbeitsmigranten, die ohne Sprachunterricht die Sprache des Landes lernen, in dem sie leben. Daneben gibt es auch den gesteuerten Zweitspracherwerb oder gesteuerten Fremdsprachenunterricht, womit das Erlernen einer Sprache durch Unterricht gemeint ist. Es kommt auch vor, daß ein Kind mehr als eine Muttersprache gleichzeitig erwirbt. Dann wird von sogenannten zweisprachig (bilingual) aufwachsenden Kindern gesprochen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Spracherwerbstheorien
- Die behavioristische Theorie
- Die nativistische Theorie
- Die kognitive Theorie
- Die interaktionistische Theorie
- Zur Entwicklung der Erstsprache
- Die Hauptphasen der Sprachentwicklung
- Der Aufbau des sprachlichen Systems: Der Zwei- und Drei-Wort-Satz
- Der Ausbau des sprachlichen Systems - die kommunikative Flexibilität
- Zweitspracherwerb
- Fremd- und Zweitsprachenerwerbsforschung
- Das Monitormodell von Stephen Krashen
- Das Modell von Sascha Felix
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Theorien des Spracherwerbs und beleuchtet die Entwicklung der Erst- und Zweitsprache. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Ansätzen zur Erklärung des Sprachlernprozesses und den dazugehörigen Modellen.
- Behavioristische, nativistische, kognitive und interaktionistische Theorien
- Die Phasen der Sprachentwicklung im Erstspracherwerb
- Der Aufbau des sprachlichen Systems im Erstspracherwerb
- Der Zweitspracherwerb und seine Forschungsgebiete
- Modelle des Zweitspracherwerbs (Krashen, Felix)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Spracherwerbs in den Kontext der Kommunikation und des Lernprozesses. Die Arbeit beleuchtet dann die wichtigsten Spracherwerbstheorien, darunter die behavioristische Theorie, die nativistische Theorie, die kognitive Theorie und die interaktionistische Theorie. Im nächsten Abschnitt werden die Hauptphasen der Sprachentwicklung im Erstspracherwerb, der Aufbau des sprachlichen Systems und die Entwicklung der kommunikativen Flexibilität behandelt. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich dem Zweitspracherwerb, untersucht die Fremd- und Zweitsprachenerwerbsforschung und stellt das Monitormodell von Stephen Krashen und das Modell von Sascha Felix vor.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Erstspracherwerb, Zweitspracherwerb, Behaviorismus, Nativismus, Kognition, Interaktionismus, Sprachentwicklung, Sprachsystem, Kommunikative Flexibilität, Monitormodell, Felix-Modell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Erst- und Zweitspracherwerb?
Erstspracherwerb ist der ungesteuerte Erwerb der Muttersprache; Zweitspracherwerb kann ungesteuert (z. B. durch Migration) oder gesteuert (durch Unterricht) erfolgen.
Welche Spracherwerbstheorien gibt es?
Bekannte Ansätze sind der Behaviorismus (Skinner), der Nativismus (Chomsky), die Kognitionstheorie (Piaget) und der Interaktionismus.
Lernen Kinder Sprache nur durch Nachahmung (Imitation)?
Die Arbeit diskutiert, ob Sprache passiv durch Imitation oder aktiv durch das Verstehen der Umwelt und angeborene Strukturen erworben wird.
Was ist das „Monitormodell“ von Stephen Krashen?
Ein Modell des Zweitspracherwerbs, das zwischen unbewusstem Erwerb (Acquisition) und bewusstem Lernen (Learning) unterscheidet.
Was bedeutet Bilingualität bei Kindern?
Bilingualität liegt vor, wenn ein Kind mehr als eine Muttersprache gleichzeitig von Geburt an erwirbt.
- Arbeit zitieren
- Jasmina Cirkic (Autor:in), 2000, Seele und Psyche: Erstspracherwerb - Zweitspracherwerb, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9595