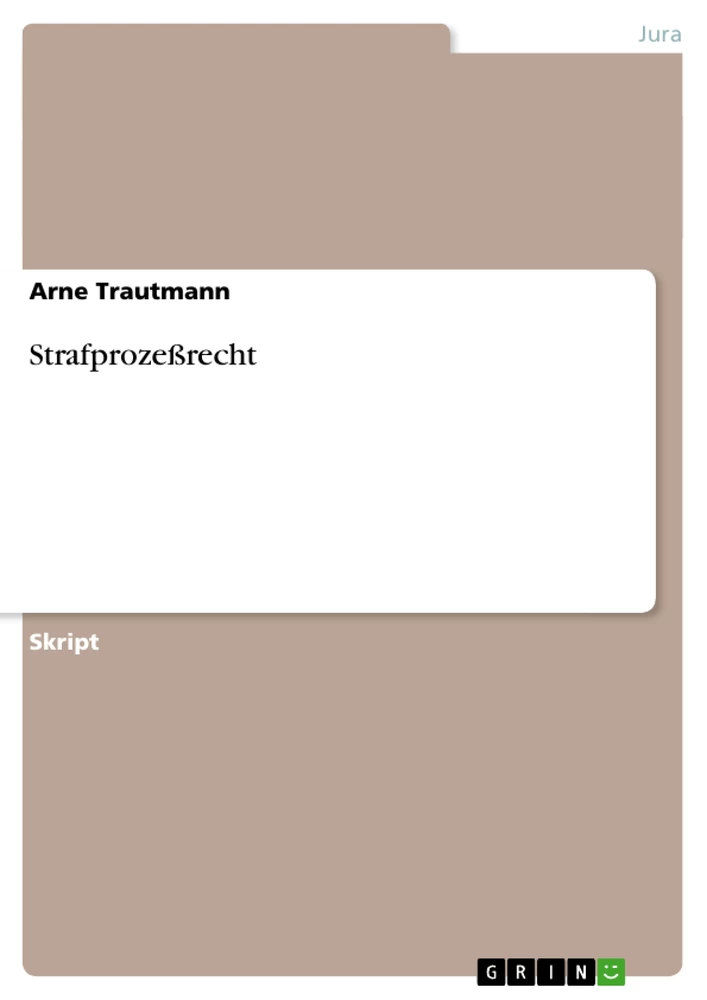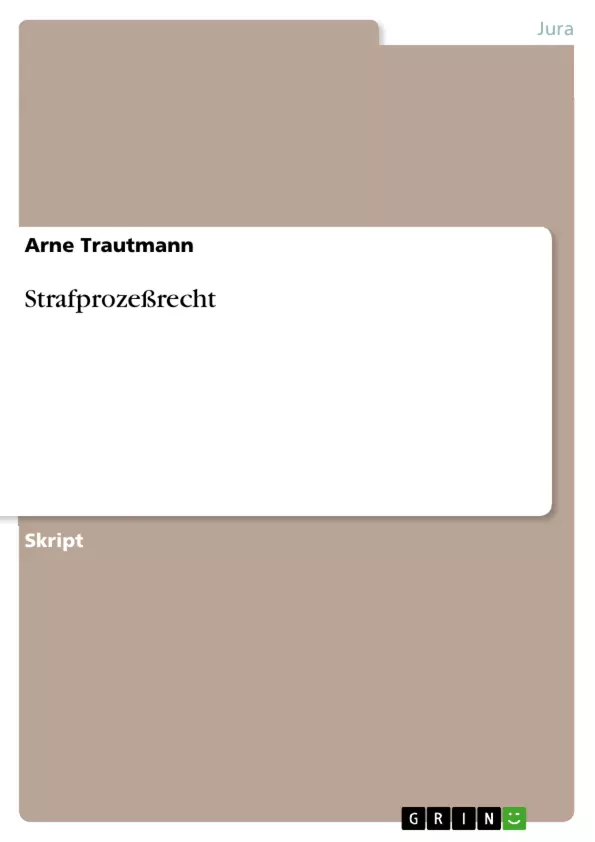Ein verworrenes Dickicht aus Paragraphen, Fristen und Formalien – das deutsche Strafprozessrecht erscheint oft wie ein unüberwindbares Labyrinth. Doch wer sich darin zurechtfinden will, braucht mehr als nur trockene Gesetzestexte. Dieses Buch ist der Schlüssel, um die verborgenen Mechanismen der StPO zu verstehen und prozessuale Fehler aufzudecken, die über Schuld und Unschuld entscheiden können. Es führt Sie ein in die Denkweise der Strafverfolgungsbehörden, von der Einleitung des Ermittlungsverfahrens über das Zwischenverfahren bis hin zur Hauptverhandlung. Lernen Sie die strategische Bedeutung von Akteneinsicht, Beweisanträgen und Revisionsrügen kennen. Erfahren Sie, wie Sie die Rechte des Beschuldigten wahren und Beweisverwertungsverbote geltend machen können. Dieses Werk beleuchtet die zentralen Maximen des Strafprozesses – Offizialprinzip, Akkusationsprinzip, Legalitätsprinzip – und zeigt, wie diese in der Praxis zur Anwendung kommen. Es analysiert die Rolle von Staatsanwaltschaft, Polizei, Gericht und Verteidiger im komplexen Zusammenspiel des Strafverfahrens. Mit prägnanten Erklärungen und anschaulichen Beispielen werden auch schwierige Themen wie die prozessuale Tat, die Anklageschrift, die Beweiswürdigung und die Strafzumessung verständlich aufbereitet. Ob Student, Referendar oder praktizierender Jurist – dieses Buch ist der unverzichtbare Begleiter für alle, die sich im Strafprozessrecht bewegen und erfolgreich sein wollen. Es bietet eine fundierte Grundlage für die tägliche Arbeit und hilft, auch in komplexen Fällen den Überblick zu behalten. Tauchen Sie ein in die Welt des Strafprozessrechts und entdecken Sie die strategischen Werkzeuge, die Ihnen zum Erfolg verhelfen! Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar und meistern Sie die Herausforderungen des Strafprozesses mit Bravour. Lassen Sie sich nicht von der Komplexität einschüchtern, sondern nutzen Sie dieses Buch als Kompass auf Ihrem Weg durch das deutsche Strafprozessrecht. Vertiefen Sie Ihr Wissen über Ermittlungsverfahren, Hauptverhandlung, Rechtsmittel, Revision, Beschuldigtenrechte, Beweisrecht, Strafantrag, Klageerzwingungsverfahren, Nebenklage, Privatklage, Strafbefehl und Urteil. Werden Sie zum Experten im Strafprozessrecht und sichern Sie sich Ihren Vorteil im Gerichtssaal.
Vorweg
Leitsatz I: Wirst du des Lebens nicht mehr froh, stürz` dich in StPO (Betonung auf dem "t") Thomas
Leitsatz II: StPO sucks
unbekannter Dichter
Leitsatz III: Vor StPO hab` ich Schiß
Arne
Stellen sich strafprozessuale Fragen, wird fast immer eine Zweischrittmethode vorgenommen werden müssen:
wo steckt der prozessuale Fehler im Vorgehen welche Folgen zieht dieser Fehler nach sich
Speziell die zweite Frage ist immer ein Eiertanz: Einerseits will man den Strafanspruch des Staates verwirklichen, andererseits aber darf dem Staat dazu nicht jedes Mittel recht sein er hat die Grundrechte zu respektieren. Hier werden dann Gedanken zum Schutzzweck der Norm gemacht, hierher gehört auch die Rechtskreistheorie.
Ablauf des Strafverfahrens
im Überblick
In der ersten Instanz gibt es drei große Abschnitte
I. das Ermittlungsverfahren, §§ 151-177
Es wird untersucht, ob hinreichender Tatverdacht vorliegt, das Ganze endet mit der Abschlußverfügung der StA und damit Klageerhebung oder Einstellung. Es kann eingeleitet werden durch amtliche Wahrnehmung (§§ 160, 163, 165), durch Strafanzeige und Strafantrag.
II. das Zwischenverfahren, §§ 199-212b
Hier überprüft das Gericht nochmals, ob wirklich das Hauptverfahren eröffnet werden kann. Wird dies abgelehnt ist - anders, als im Vorverfahren - die Klage verbraucht, es sei denn, neue Gesichtspunkte tauchen auf. Das Zwischenverfahren spielt in der Praxis so gut wie keine Rolle.
III. Hauptverfahren, §§ 213-295
Naja, ein Urteil wird eben gefällt. Der Gang der Hauptverhandlung ergibt sich recht gut aus dem Gesetz, §§ 243, 244, 258, 260, 268. Die Hauptverhandlung ist geprägt durch die Grundsätze der Öffentlichkeit, Mündlichkeit, Unmittelbarkeit und Einheitlichkeit.
Maximen des Strafverfahrens
Offizialprinzip (= Ausschluß des Faustrechts) Der Staat muß Strafverfolgung und
Strafverfahren übernehmen, vgl. § 152. Durchbrechungen stellen die Antragsdelikte und
Ermächtigungsdelikte dar (im StGB geregelt); eine Ausnahme ist das Privatklageverfahren, §§ 374 ff. (Anfang des 5. Buches).
Akkusationsprinzip, § 151. Wo kein Kläger, da kein Richter. Anklage und Strafverfolgung sollen zwei unterschiedlichen Instanzen obliegen
Legalitätsprinzip, Bei hinreichendem Anfangsverdacht ist zu ermitteln, bei hinreichendem Tatverdacht anzuklagen. Gegensatz ist das Opportunitätsprinzip (OWiG, präventive Polizei). Das Legalitätsprinzip ist die logische Folge aus dem Offizialprinzip: Wenn bloß noch der Staat Straftaten verfolgen darf, dann soll er dazu aber auch verpflichtet sein. Untersuchungsgrundsatz Anders, als in der ZPO ist der SV von Amts wegen in jeder Hinsicht zu erforschen.
Beschleunigungsgebot
freie richterliche Beweiswürdigung, § 261
Mündlichkeit und Unmittelbarkeit, §§ 226, 250, 261; alles, was Eingang in das Urteil finden soll, muß verlesen werden. Eine gewisse Ausnahme bildet das Selbstleseverfahren nach § 249.
Öffentlichkeit, § 169 GVG in dubio pro reo
Wobei immer wieder streitig ist, ob dies auch hinsichtlich von Prozeßvoraussetzungen und
Verfahrensfragen gilt.
Sonstiges, wobei insbesondere das GG zu beachten ist, also i.e. fair trial, gesetzlicher Richter, rechtliches Gehör.
Begriffe
Abschlußverfügung der StA
Die StA ermittelt also vor sich hin. Ggf. kann sie der Polizei Hinweise geben, was noch zu tun ist. Irgendwann aber ist der SV aufgeklärt. Dann verbleiben bloß noch zwei Möglichkeiten:
- Erhebung der Anklage (· Anklageschrift)
- · Einstellung des Verfahrens
Für die Erhebung der Klage bieten sich wieder 5 Möglichkeiten:
- Anklageschrift (§§ 170 I, 200)
- Antrag auf Entscheidung im beschleunigten Verfahren (§§ 417 ff) _ dito im vereinfachten Jugendverfahren (§§ 76-78 JGG) _ dito auf Erlaß eines Strafbefehls (§§ 407 ff.) _ Sicherungsverfahren (§§ 413 ff.)
Bei der Einstellung des Verfahrens sind die Fälle nach § 170 II 2 und den §§ 153 ff. zu unterscheiden.
Ist sie StA soweit, hat sie den Abschluß des Verfahrens in den Akten zu vermerken (§ 169a), das ist die berühmte Abschlußverfügung, prozessuale Bedeutung hat sie für das Recht auf · Akteneinsicht des Verteidigers. Sie sieht einfach so aus:
StA bei dem Landgericht X X, den Datum
AZ
Verf ü gung
in dem Verfahren gegen (gro ß e Personalien)
I. Die Ermittlungen sind abgeschlossen
II. Anklage (Strafbefehlsantrag) nach gesondertem Entwurf
Alles kann bei komplexeren Sachverhalten komplizierter werden, wenn manche Sachen
eingestellt werden, bei anderen die Strafverfolgung nach § 154a beschränkt wird (das ist
keine Einstellung, sondern eine Konzentration der rechtlichen Bewertung auf sinnvolle
Aspekte! - hier erfolgt der berühmte Vermerk. In diesem lassen sich auch sonstige rechtliche Bemerkungen, z.B. auf den ersten Blick einschlägig, irgendwie aber doch herausfallende TBe unterbringen).
I. Bezüglich des Verhaltens (...) wird mit Zustimmung des Gerichtes gem äß § 153 b eingestellt II. Mitteilung von I. formlos an den Beschuldigten
III. Vermerk : Das Verfahren wird hinsichtlich des Verhaltens des Beschuldigten vom (...) gem äß § 154a StPO beschr ä nkt auf den Vorwurf (...). Neben der dafür zu erwartenden mehrj ä hrigen Freiheitsstrafe (f ä llt der Rest nicht ins Gewicht).
Die Anklage erstreckt sich innerhalb der einheitlichen prozessualen Tat auch nicht auf den Vorwurf der r ä uberischen Erpressung mit Todesfolge, da der Angeschuldigte insoweit wirksam vom Versuch zurückgetreten ist.
IV. Im Ü brigen sind die Ermittlungen abgeschlossen
V. Anklage zum (...) nach gesondertem Entwurf
Abtrennung des Verfahrens
Auf solche Ideen kommen Gerichte ab und an:
Bsp: (BGH NJW 98, 840) A und B waren zusammen angeklagt. Das Verfahren gegen B
wurde aber abgetrennt. Über B existieren Krankenunterlagen, die den A belasten. Dies sollen beschlagnahmt werden. Die StA meint, § 97 I Nr. 2 (Beschlagnahmefreiheit) sei nicht mehr einschlägig, es handele sich nicht um Unterlagen über den (im Verfahren) Beschuldigten.
Das ist natürlich Unsinn. Eine den Beschuldigten schützende Verfahrensnorm darf nicht durch den formalen Akt der Verfahrenstrennung umgangen werden.
Genauso gilt das übrigens auch für das Zeugnisverweigerungsrecht von Angehörigen früherer Mitbeschuldigter. Es reicht sogar ein gemeinsames Ermittlungsverfahren aus ( · K/M § 52/11).
Apropos Krankenakten: Grundsätzlich soll die Beschlagnahme von Krankenakten aber von
(beliebigen!) Dritten möglich sein, es ist dann aber eine Abwägung zwischen der Schwere der
Tat des Beschuldigten und den Grundrechten des Betroffen en (informationelle
Selbstbestimmung!) vorzunehmen.
Angeklagter
Grundsätzlich muß der Angeklagte zur Hauptverhandlung erscheinen, § 230. Es gibt aber eine ganze Reihe von Ausnahmen, wann trotzdem - auch ohne ihn - verhandelt werden kann. Da das häufig im Zusammenhang damit zu sehen ist, daß der Angeklagte nicht die Verhandlung sabotieren soll, steht es auch gleich nach den Aussetzungsbestimmungen in §§ 231 ff. Ggf., § 232, kann auch ganz ohne den Angeklagten verhandelt werden - aber nur bei leichter Kriminalität und vorheriger Androhung; ggf. nach § 233 auch bei Antrag des Angeklagten. Im Strafbefehlsverfahren kann sich der Angeklagte gemäß § 411 vom Anwalt vertreten lassen. Im Sicherungsverfahren geht es nach § 415 auch ohne Beschuldigten.
Ist der Angeklagte schon zu Sache vernommen worden, kann sogar noch einfacher (weiter) ohne ihn verhandelt werden, § 231 II, 231 a, b; 247.
Anklageschrift
§§ 200 StPO, Nr. 110-114 RiStBV
Vorsicht: Die StA ist eine ... ja, Behörde. Und jede macht es anders, also sollte man sich mal genau kundig machen, wie es denn im eigenen Land/Freistaat geht. Alle Schemata sind Bullshit.
I. Kopf
absendende StA, AZ, Ort u. Datum, ggf. Haftaufkleber; in Sachsen weiterhin: An das (Gericht)
Dann die Überschrift: "Anklageschrift in der Strafsache gegen" + große Personalien. Ggf. noch den Verteidiger.
II. Anklagesatz
"Die StA legt aufgrund ihrer Ermittlungen dem Angeklagten folgenden Sachverhalt zur Last
1. (...)
2. (...)
3. (...)
Der Angeklagte wird daher beschuldigt ,
durch drei Handlungen (Darlegung des ges. TB) eine fremde bewegliche Sache einem Anderen in der Absicht, sich diese rw. zuzueignen, weggenommen zu haben Strafbar als Diebstahl in drei F ä llen gem. § 242 StGB"
Bei letzterem sind auch Qualifikationen, Antragserfordernisse usw. mitzuzitieren. Bei ges. Regelbeispielen, wird man die entsprechende Bestimmung wohl mitzitieren.
Richtig schwierig wird der abstrakte TB dann, wenn nicht einfach der Gesetzeswortlaut abgeschrieben werden kann. Z.B. weil im § 255 noch Merkmale der §§ 253, 250 vorkommen, weil eine schwere räuberische Erpressung vorliegt. Dann müssen die Merkmale, auf die ja im § 255 bloß verwiesen wird, geschickt in den abstrakten TB eingebaut werden.
Wurde bloß eine Anstiftung oder Beihilfe geleistet, wird die Hauttat nicht komplett genannt, sondern bloß stichwortartig erwähnt:
"... vors ä tzlich einem anderen zu dessen vors ä tzlich begangener rechtswidrigen Haupttat - einem Diebstahl - Beihilfe geleistet zu haben."
III. Das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen
Hier werden die Beteiligten über die Beweissituation aufgeklärt. Es kann hier auch etwas auf die (oben entbehrliche!) Vorgeschichte eingegangen werden. Wenn es für die Strafzumessung bedeutsam erscheint, kann auf Vorstrafen hingewiesen werden. Wenn also ein hier komplizierter Fall vorliegt, sollte man etwa so vorgehen:
1. Person des Angeschuldigten
2. Vorgeschichte der Tat
3. Die Tat
4. Verhalten nach der Tat
5. Einlassung und deren Würdigung
Im wesentlichen Ergebnis können auch prozessuale Probleme untergebracht werden, wenn etwa die StA Protokolle hat und diese verlesen will; die §§, nach denen dies zulässig sein wird, sind dann anzugeben.
Und erst hier steht irgend etwas von Klageerhebung!
"Der Angeschuldigte steht wegen ... unter laufender Bew ä hrung. Er ist zum Tatvorwurf zu
Ziffer 1. gest ä ndig.
Den Tatvorwurf zu Ziffer 2. bestreitet er und gibt an (...). Dies wird aber durch die Aussagen des Zeugen (...) widerlegt werden.
Im Falle 3. beruft sich der Angeklagte auf einen Verbotsirrtum. Dieser Einwand greift aber nicht durch (...).
Zur Aburteilung ist das (Gericht) zust ä ndig.
Ich erhebe daher die ö ffentliche Klage und beantrage:
a) Die Klage zur Hauptverhandlung bei (...) zuzulassen.
b) Die Fortdauer der U-Haft anzuordnen, weil die Haftgründe fortbestehen
c) Die Anberaumung eines Termins zur Hauptverhandlung
d) Dem Angeschuldigten gem äß § 140 I Nr. 1 StPO einen Pflichtverteidiger zu bestellen
Als Beweismittel bezeichne ich:
1. Das Gest ä ndnis des Angeschuldigten
2. Zeugen (...)
3. Urkunden (...)
4. Überführungsstücke (Asservate)
Mit den Akten an den Vorsitzenden des (Gericht)
Akteneinsicht
Der Verteidiger kann das nach § 147 verlangen. Es soll allen Ernstes wahr sein, daß der
Beschuldigte selbst kein Einsichtsrecht hat, sondern ihm eben ggf. ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt werden muß. M.E. kann das nicht richtig sein.
Der Verletzte oder besser dessen RA, kann nach § 406e einsehen. Dritte ggf. nach RiStBV Nr. 185 III bei berechtigtem Interesse. Dazu wird wohl die Geltendmachung von zivilrechtlichen Ansprüchen genügen.
§ 406e wird für die Beschwerdemöglichkeiten der sich jeweils verletzt fühlenden oft entsprechend angewandt, es kann auch § 23 EGGVG einschlägig sein.
Anwesenheit der Beteiligten
in der Hauptverhandlung
Nach § 226 als besonderer Ausprägung des Unmittelbarkeitsgrundsatzes müssen die zur
Urteilsfindungberufenen Personen immer anwesend sein. Will man einem Ausfall vorsorgen, weil z.B. das Verfahren sehr lange dauern wird, muß man nach § 192 GVG Ergänzungsrichter und -schöffen bestimmen.
Der Angeklagte muß nach §§ 230, 231 immer anwesend sein. Ausnahmen (die eigentlich alle Sanktionen sind) finden sich in §§ 231 ff, 247 (bei der Beweisaufnahme).
- Angeklagter
Nach § 226 muß die Staatsanwaltschaft ununterbrochen anwesend sein, nicht jedoch immer derselbe StA. Der Verteidiger ist nur in den Fällen der notwendigen Verteidigung erforderlich, § 140.
Beim Fehlen eines der Beteiligten liegt ein Revisionsgrund nach § 338 Nr. 5 vor. Beschuldigter
Terminologie
Beschuldigter kann man immer heißen. Es geht aber spezieller: Angeschuldigter heißt man, wenn die öffentliche Klage erhoben wurde (also im Zwischenverfahren). Nach Beschluß der Eröffnung des Hauptverfahrens heißt man dann Beklagter.
Wann
Ganz wichtig ist zu wissen, ab wann jemand Beschuldigter ist, denn ein Verstoß gegen z.B. § 136 zieht ein Beweisverwertungsverbot nach sich. Man muß das also zu fassen kriegen.
Willensakt der Strafverfolgungsbehörde, mit dem sie subjektiv zum Ausdruck bringt, daß sie ein Strafverfahren gegen eine bestimmte Person als Beschuldigten betreiben will
hinreichend konkreter Anfangsverdacht
So bekommt man die Fälle der informatorischen Befragung und der Spontangeständnisse in den Griff. Wichtig: Ein Verdächtiger ist auch dann Beschuldigter, wenn die
Ermittlungsbehörde ihm dieses Stellung willkürlich vorenthält, denn schließlich hängen hier
auch Verfahrensrechte dran, bzw. kann das sogar ein materiellrechtlicher Einstieg sein:
Wer Beschuldigter ist, kann nicht Zeuge sein. Dann aber entfällt z.B. eine Straftat nach §§ 153 ff. StGB.
Rechte
Anwesenheit bei richterlichen Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen, § 168 c II. Anspruch auf rechtliches Gehör, 103 GG. Recht auf Verteidigung, Recht die Einlassung zur Sache zu verweigern (nemo tenetur). Lies speziell §§ 136, 163 a.
Pflichten
Er muß zur Vernehmung erscheinen, § 163 III, ggf. kann er vorgeführt werden. Zulässige
Zwangsmaßnahmen, z.B. Untersuchungshaft, muß er über sich ergehen lassen. Nach § 58 II muß er zum Zwecke der Gegenüberstellung ggf. auch Veränderungen an sich vornehmen lassen.
- Angeklagter
Besonderes ö ffentliches Interesse
Zum einen: Auf exakte Terminologie achte, es ist eben ein "besonderes" Interesse, das blo ß e Interesse gibt es bei Privatklagen.
Und aufpassen, nicht bei allen Delikten l äß t sich der fehlende Strafantrag mit einem besonderen ö . Interesse wegbügeln. Also nicht in Fallen tappen.
Beweisantrag
§ 244, die Kommentierung im K/M ist mal brauchbar!
Interessant wird der Beweisantrag in der Revision, wo oft geprüft werden mu ß , ob er richtig behandelt wurde. Wie genau er denn behandelt werden mu ß , das steht in § 244. Aber: der gilt nur für echte Beweisantr ä ge, nicht für blo ß e Beweisermittlungsantr ä ge. Es mu ß also erst mal eine Abgrenzung vorgenommen werden.
Nach § 244 VI bedürfen echte Beweisantr ä ge bei der Ablehnung eines
Gerichtsbeschlusses! Aber: Antr ä ge sind nur bis zum Beginn der Urteilsverkündung zul ä ssig, danach k ö nnen sie vom Vorsitzenden allein zurückgewiesen werden.
Einstellung des Verfahrens
§§ 170 II, 153 ff.
Ganz wichtig: § 170 II ist vorrangig, denn er setzt voraus, da ß eben kein genügender Anla ß
zur Erhebung der Klage vorliegt, sprich also keine (nachweisbare) Straftat vorliegt. §§ 153 ff. dagegen setzen eine Straftat voraus.
Und so k ö nnte eine Einstellungsverfügung aussehen:
I . Das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten (...) wird gem äß § 170 II StPO eingestellt
Gründe:
Dem Beschuldigten liegt zur Last (...) Ein ausreichender Tatnachweis ist jedoch nicht zu
führen (...) Es stehen allein die Angaben des zeugen X (...) Bei dieser Beweislage ist eine
Verurteilung des Beschuldigten nicht mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten . Es kann n ä mlich nicht ausgeschlossen werden, da ß (...)
II . Mitteilung von Ziff. I ohne Gründe an den Beschuldigten
III . Zustellung von Ziffer I mit Gründen an den Anzeigenerstatter (ggf. mit Beschwerdebelehrung , wenn er auch der Verletzte ist, §§ 171 S.2, 172)
Wer was mit oder ohne Gründe bekommt, steht übrigens im Gesetz. man kann also mal reinschauen.
Interessante Sache noch zur Beschwerde nach § 172 I, die übrigens Vorschaltbeschwerde für das Klageerzwingungsverfahren des Abs. II ist. Ist sie nach § 172 I unzulässig (z.B. wegen Fristablaufes), wird sie eben als - immer mögliche - allg. Dienstaufsichtsbeschwerde behandelt.
Und nochwas: Weil es sich eben um eine Vorschaltbeschwerde zum
Klageerzwingungsverfahren handelt, ist sie nur zu geben, wenn es dieses auch geben kann, also (trotz der Vor. des § 171 S.2) dann nicht, wenn die Ausnahmen des § 172 II 3 gegeben sind, also ein Klageerzwingungsverfahren ausscheidet, weil ein Privatklagedelikt vorliegt.
Ermittlungsrichter
Für bestimmte Anordnungen im Ermittlungsverfahren, die besonders tief in die Sphäre des
Beschuldigten eingreifen, gilt der Richtervorbehalt. Allerdings kann er - er ist nicht Herr des
Verfahrens - nur in Ausnahmefällen selbst tätig werden (§§ 165, 167), er prüft nur die
Anträge der StA auf ihre Zulässigkeit. Die Entscheidung ergeht durch Beschluß.
Zuständig ist der Amtsrichter, in dessen Bezirk die Handlung vorzunehmen ist, § 162 I 1. Beachte aber speziellere Zuständigkeiten in §§ 81, 125.
Ach ja, und bei Gefahr im Verzuge, also wenn richterliche Anordnungen nicht mehr
eingeholt werden können, ohne daß der Zweck der Maßnahme gefährdet wird, kann die StA auch alleine.
Das nicht erreichbar sein des Richter kann auch darin bestehen, daß der Sachverhalt zu komplex ist, um am Telefon erklärt zu werden.
§ 98 II wird analog auf alle Fälle der nachträglichen Kontrolle einer solchen Eilhandlung angewandt.
Ganz wichtig ist noch die richterliche Vernehmung, weil die bloßen Angaben gegenüber der Polizei bei der Geltendmachung eines Zeugnisverweigerungsrechtes in der Hauptverhandlung unverwertbar sind, im Gegensatz zur richterlichen, §§ 251, 254. Also ist das eine Form der Beweissicherung. Der Richter darf nicht allein die Richtigkeit der vor der Polizei gemachten Angaben feststellen, er muß schon selbst vernehmen. Kommt dabei aber dasselbe heraus. kann er sehr wohl bezug nehmen.
Fristen
Bei Problemen immer K/M vor § 42 lesen. Und nicht in die Irre leiten lassen lassen durch §
42! In der Kommentierung zu §§ 42, 43 steht es eigentlich: Fällt das (einwöchig) fristsetzende Ereignis auf einen Mittwoch, beginnt Do, 0.00 Uhr die Frist zu laufen und endet am ... Mittwoch, 24.00 Uhr! Das sind dann genau 7 Tage.
Haft
Probleme
Fristen
Für die (unterschiedlichen!) Fristberechnungen in §§ 117 V und 121, 122 am Besten immer den Kommentar konsultieren, wenn man sich s nicht merkt: Bei 117 muß die Haft schon drei Monate gedauert haben, damit geprüft wird, bei Inhaftierung am 1.1. also Prüfung erst am
2.4. Bei 121, 122 geht es genau um 6 Monate, also (besondere) Haftprüfung am 1.7.
Haftbefehl
Sieht aus, wie eine kleine Anklage, natürlich zusätzlich mit Darlegung der Haftgründe.
In dubio pro reo
Umstritten ist, ob dieser Grundsatz auch hinsichtlich von Prozeßvoraussetzungen oder
sonstiger prozessual erheblicher Tatsachen gilt. Insbesondere interessant ist dies für die
Voraussetzungen eines Beweisverwertungsverbotes. Gälte nämlich der Grundsatz, müßte der Angeklagte die Voraussetzungen bloß glaubhaft machen (es gilt ohnehin das Freibeweisverfahren). Die HM differenziert:
- Bei den Prozeßvoraussetzungen soll er gelten,
- nicht aber bei Verfahrensfehlern und rechtlichen Zweifeln.
Und - ganz wichtig: Der Satz sagt nur aus, daß von mehreren, vom Tatrichter auch
angenommenenMöglichkeiten die für den Angeklagten günstigste anzunehmen ist. Er sagt aber gerade nicht, daß von allen überhaupt nur denkbaren Möglichkeiten die Günstigste zu nehmen ist. Er greift auch dann nicht ein, wenn der Richter zwar hätte Zweifel haben können, aber eben nicht hatte.
Nebenklage
§§ 395 ff. Interessant ist § 395 IV 2. Auch nach ergangenem Urteil kann sich der Nebenkläger noch anschließen. Er muß dann ein Rechtsmittel einlegen. Darin liegt auch der Antrag, als Nebenkläger zugelassen zu werden. Das geht - natürlich - nicht mehr, wenn bereits Rechtskraft eingetreten ist.
Aufpassen auch bei § 400. Liegt Tateinheit vor (§ 52 StGB) und ist ein Aspekt der
einheitlichen Tat ein Nebenklagedelikt, sind nach § 400 I Rechttsmittel des Nebenklägers ja möglich. Diese ergreifen dann aber die gesamte Tat unter allen rechtlichen Gesichtpunkten, auch den nicht nebenklagespezifischen! Das ist klar, man wird eine einheitliche Tat nicht zerreißen können.
Ach und ja, Rechtsmitttel des Nebenklägers wirken immer auch zugunsten des Angeklagten, § 401 III 1 iVm. § 301.
Plädoyer
Im Allgemeinen wird in etwa folgendermaßen aufgebaut:
I. Anrede: "Hohes Gericht, Herr Verteidiger ..."
II. Sachverhalt: "Aufgrund des glaubwürdigen Gest ä ndnisses des Angeklagten steht der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt nunmehr fest ..."
III. Beweiswürdigung: "Die Einlassungen des Angeklagten sind weitgehend glaubwürdig. Soweit er angibt ..."
IV. Rechtliche Würdigung: "Damit ist der Angeklagteüberführt, sich des ... schuldig gemacht zu haben. Soweit dies voraussetzt ..."
V. Strafzumessung: "Das Gesetz sieht hierfür einen Strafrahmen von ... bis ... vor. Gegen den Angeklagten spricht ..."
Achtung: Erst hier haben Fragen nach dem Vorliegen von Regelbeispielen etwas zu suchen, denn genau hier sind sie interessant.
VI. Antrag: "Ich beantrage daher, den Angeklagten zu ..." Polizei
a) Stellung
Muß zum einen selbst tätig werden, §§ 158, 163, wenn sie von Straftaten Kenntnis erlangt. Vor allem aber muß sie auf Weisung der StA tätig werden, § 161. Dieses Weisungsrecht gilt unmittelbar aber nur gegenüber den Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft. Wer das ist, bestimmt sich gemäß § 152 II GVG nach Landesrecht. Auch die besonderen Eingriffsbefugnisse der StPO stehen bloß den Hilfsbeamten zur Seite. Aus all dem folgt natürlich nicht, daß die StA als solche der Polizei vorgesetzt wäre.
b) Befugnisse
Interessant sind die §§ 163 ff., wobei § 163 selbst nur Aufgabe ist, also keinen Schluß auf die Befugnisse zuläßt. Wichtig sind auch die mit § 81 b verbundenen Befugnisse, die in Grenzen auch die Veränderung von Haar- und Barttracht sowie die offene Filmung von Gegenüberstellungen erfaßt. Auch bei den sonstigen Befugnissen der StPO hat die Polizei häufig eine Notzuständigkeit.
c) Aussagegenehmigung
Da Polizisten nun einmal Beamte sind, bedürfen sie einer Aussagegenehmigung im Prozeß, §
54 i.V.m. Landesrecht/nach BRRG. Das soll aber gerade nicht für die Hilfsbeamten der StA gelten, da diese ja gerade dazu da sind, an Prozessen mitzuwirken. Denen muß die Aussage im Zweifel ausdrücklich verboten werden.
Protokoll
vor allem § 274
Naja, da steht's halt. Und weil's in der Revision so wichtig ist, steht da auch ein Exkurs · E. Die Bedeutung des Protokolls für die Revisionsrügen
Revision
Zul ä ssigkeit und Begründung
I. Einlegung
1. Statthaftigkeit § 333, 335
Beachte § 335 III. Die Statthaftigkeit kann man (zumindest im Gutachten) immer ansprechen. Das dürfte der richtige Einstieg sein.
2. Berechtigte
Dazu steht in den allg. Vorschriften über Rechtsmittel etwas, § 296. Die StA braucht keine Beschwer für eine Revison bzw. ist durch jeden Rechtsfehler beschwert, da sie zur Objektivität verpflichtet ist ;-).
Berechtiger ist auch der Nebenkläger, (· Nebenklage unbedingt lesen).
3. Beschwer
Die Beschwer muß im Tenor liegen, irgendwelche Feststellungen reichen nicht.
4. zuständiges Gericht
Steht in §§ 121, 135 GVG. Dir Revision ist nach § 341 I aber beim judex a quo einzureichen!
5. Form und Frist
Allgemeines
Die Revision selbst - nicht also die Begründung - kann der Angeklagte auch allein einlegen, er braucht keinen Anwalt. Ganz besonders toll: Man kann Urteile auch erst mal allgemein "anfechten", ohne sich zu entscheiden, ob man Berufung oder Revision will. Denn das wird man ja häufig erst dann wissen, wenn man die Gründe hat.
Geht dann innerhalb der Begründungsfrist keine - oder auch eine ungenügende - Begründung ein, wird die Sache als Berufung behandelt (Im Zweifel für das zulässige Rechtsmittel).
Frist
§ 341 - Eine Woche seit der Verkündung, Berechnung nach § 43. Apropos · Fristen: K/M vor § 42 lesen!
Form
§§ 341, 299. Letzterer ist wichtig, da ja der gefangene Angeklagte sich kaum zu
irgendeiner Geschäftsstelle begeben kann. Die Form ist (a majore ad minus) auch dann
gewahrt, wenn die Revision schon in der HV zu Protokoll erklärt wird. Aber: wenigstens die Urteilsverkündung muß schon abgewartet werden, sonst liegt keine Beschwer vor.
6. wirksame Revisionsbegründung
(siehe unten II.)
Normalerweise allerdings wird ja bei einer Revision immer zumindest die Sachrüge erhoben, womit sie zulässig ist (in der Klausur zumindest). Oft wird daher § 344 nicht in der Zulässigkeit der Revision geprüft, sondern als Unterpunkt bei der Stellungsnahme zu den einzelnen Verfahrensrügen - nämlich bei der Frage, ob gerade diese Rüge überhaupt geprüft wird (= Zulässigkeit der Rüge)
Trotzdem empfiehlt sich immer das Sätzchen
"Die Revisionsbegründung entsprach den Erfordernissen des § 344 StPO."
7. kein Verlust des Revisionsrechtes
Rücknahme und Verzicht
§ 302. Eine bloß eingeschränkte Einlegung läßt nicht unbedingt auf einen Verzicht i.Ü. schließen; es kann also innerhalb der Frist noch erweitert werden.
Beschr ä nkung
naja, geht halt.
8. Zuständigkeit des Revisionsgerichtes
Das ist natürlich keine Zulässigkeitsvoraussetzung, da die revision ja beim judex a quo
eingelegt wird, aber im Gutachten über die Aussichten einer Revision sollte man es doch mal hinschreiben und mit dem Ergebnis verbinden:
"Die eingelegte Revision ist zul ä ssig. Zur Entscheidung berufen ist der BGH, § 135 GVG."
II. Revisionsbegründung
Die Revision bedarf der Begründung, um zulässig zu sein. Klar ist, was die Revision will: eine rechtliche Überprüfung. Aber: Auch die Vorschriften über die Tatsachenfeststellung (deren Verfahren)wollen von den Instanzgerichten beachtet sein. Hat sich hier ein Fehler eingeschlichen, werden die Tatsachenfeststellungen aufgehoben und zurückverwiesen. In der Vorinstanz kann man dann wieder Tatsachen vorbringen.
1. Frist, Form
§ 345 I. für die Frist, Abs. II für die Form. Fehlt es hieran, verwirft bereits das
Ausgangsgerichtdie Revision durch Beschluß, § 346. Wichtig: Beachte § 299 für den
(inhaftierten) Angeklagten und § 390 II für den Privatkläger. Für den Nebenkläger wird § 390 analog angewandt, also Einlegung auch durch Anwaltsschrift. Bei der StA reicht einfache Schriftform mit maschinenschriftlicher Unterschrift, wenn ein Beglaubigungsvermerk drauf ist.
Interessantes Problem: § 274 IV. Bevor das · Protokoll nicht fertig ist, darf das Urteil nicht zugestellt werden und die Frist läuft nicht an. Aber was heißt denn nun Fertigstellung? Sicherlich muß es nicht fertig sein, aber der Richter darf nicht ohne Wissen des Urkundsbeamten Änderungen vornehmen, denn beide müssen ja unterschreiben - und zwar unter demselben Text (· K/M 271/19). Einfacher merkt man es sich vom Telos her: Der Anwalt, welcher nach Fehlern für die Revision forscht, braucht schon das verbindliche Protokoll.
Noch ein Fristproblem, nämlich das des § 345 I 1. Ein Monat nach Ablauf der
Rechtsmitteleinlegungsfrist, wann ist das? Angenommen, die Einlegungsfrist läuft am 15.3. ab. Das tut sie um 24.00 Uhr. D.h., daß die Begründungsfrist am 16.3. um 0.00 Uhr (!) losläuft und am 16.4. um 24.00 endet, nämlich am Tag mit derselben Benennung!
2. Adressat
Judex a quo. Auch hier wieder kommt es bei Einlegung bei einem unzuständigen Gericht auf die rechtzeitige Weiterleitung an.
3. Inhalt der Revisionsbegründung § 344 I
a) Die Revisionsantr ä ge
Die müssen nicht förmlich gestellt werden, es muß aber klar werden, was gewollt ist. Das kann etwa sein:
"... das angefochtene Urteil in vollem Umfange aufzuheben und sie Sache an die Vorinstanz zurückzuverweisen"
"... das angefochtene Urteil hinsichtlich der Entziehung der Fahrerlaubis/des
Strafma ß es/soweit der Angeklagte wegen Diebstahls verurteilt wurde aufzuheben und an die Vorinstanz zurückzuverweisen"
"Das Urteil des ( ) wird bezüglich der dem Angeklagten vorgeworfenen Urkundenf ä lschung vom (...) aufgehoben. Der Angeklagte wird freigesprochen.
Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen tr ä gt insoweit die Staatskasse." ( · HemmerAssKl. 109)
Was geschieht - eigene Entscheidung des Revisionsgerichtes oder Zurückverweisung, steht im § 354. Soweit eine Beschränkung der Revision unzulässig ist, prüft das Gericht eben im rechtlich notwendigen Maße nach.
a) die Begründung der Antr ä ge
Achtung: Das ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung, d.h. unterbleibt die Begründung oder entspricht nicht den Anforderungen, wird die Revision schlicht unzulässig.
Gerügt werden muß die Verletzung von Rechtsnormen. Das ist manchmal gar nicht so
einfach hinzukriegen. Aber auch der Verstoß gegen z.B. Denkgesetze kann ein
Gesetzesverstoß sein, nämlich eine unrichtige Anwendung der Gesetzesnormen, die unter Verstoß gegen Denkgesetze gebraucht wurden.
Vorab kann man das Gericht auf die von Amts wegen zu berücksichtigenden
Verfahrenshindernisse usw. aufmerksam machen. Das darf man dann eben wirklich auch nicht als Rüge formulieren; als Hinweis aber empfiehlt es sich sehr!
Die Sachrüge ist schon zulässig durch den weltberühmten Satz: "Ich rüge die Verletzung materiellen Rechts"
Bei der Verfahrensrüge ist der Verstoß genauer zu bezeichnen, und zwar mit Angabe des zugrundeliegenden Sachverhaltes, ein bloßes Gesetzeszitat reicht nicht aus.
"Der Unterzeichnete hat in der Hauptverhandlung beantragt, den Zeugen X darüber zu vernehmen, da ß ...
Das Gericht hat den Beweisantrag mit der Begründung abgelehnt, da ß das Gegenteil des Antrages bereits durch dieübrige Beweisaufnahme feststehe, mithin nicht zu erwarten sei, da ß der Zeuge die in sein Wissen gestellte Aussage werde t ä tigen k ö nnen, womit seine Einvernahme unbehelflich sei. Damit hat das Gericht gegen § 244 III 2 StPO versto ß en."
Ist (allein) § 337 einschlägig darf man nicht vergessen:
"Auf diesem Fehler beruht das Urteil auch, da ..."
Ein Urteil beruht immer dann auf dem Verstoß, wenn es überhaupt möglich sein könnte, daß der Verstoß Einfluß auf das Urteil gehabt haben könnte. Es reicht also, daß man den Einfluß nicht ausschließen kann!
Auf den Fehlern der 1. Instanz (außer bei Sprungrevision) oder des Ermittlungsverfahrens wird das Urteil der 2. Instanz kaum jemals beruhen, da hier eigene Feststellungen vorgenommen werden.
Solche Fehler gehören also ins Hilfsgutachten.
Ausnahme: Verfahrensvoraussetzungen, z.B. kein Eröffnungsbeschluß. Den braucht es für alle Verfahrensabschnitte.
E. Die Bedeutung des Protokolls für die Revisionsrügen
§§ 271 - 274
Der Nachweis über die Beachtung der wesentlichen Förmlichkeiten (· K/M § 273/7 f.) der Hauptverhandlung kann nur durch das Protokoll geführt werden. Dabei ist die Beweiskraft des Protokolls positiv und negativ.
Aber: Daß das Protokoll schlecht geführt ist, ergibt keine Rüge, sondern die sog. "unzulässige Protokollrüge ". Ob das Protokoll irgendwelche Tatsachen enthält oder nicht, ist (für sich gesehen) völlig Wurscht.
Eine sog. Protokollberichtigung soll gehen, wenn alle Verfahrensbeteiligten sich
übereinstimmend erinnern und ein entsprechender Antrag gestellt wurde (steht nicht im Gesetz, aber bei · K/M 271/21 ff.). Allerdings darf so nicht eine bereits erhobene Revision ausgehebelt werden. Der Revisionsführer hat ein Interesse am Bestand seiner Rüge.
Revision
Die wichtigsten Rügen
Vorweg: Sinnvollerweise trägt man diese zweigeteilt vor, nämlich erst den zugrundeliegenden SV, dann dessen rechtliche Beurteilung, also etwa:
(1) Das Gericht hat den Angeklagten für voll schuldf ä hig gehalten. Aufgrund des
merkwürdigen Verhaltens des Angeklagten (... ausführen) h ä tte das Gericht eine
Geisteskrankheit in Erw ä gung ziehen müssen. Darüber h ä tte Beweis erhoben werden müssen durch Zuziehung eines Sachverst ä ndigen.
Die eigene Sachkunde des Gerichtes reicht hierfür nicht aus (...).
(2) Damit hat das Gericht gegen seine Pflicht aus § 244 II versto ß en. Auf diesem Versto ß beruht das Urteil auch, da nicht auszuschlie ß en ist, da ß die unterlassene Aufkl ä rung zur Feststellung der Schuldunf ä higkeit des Angeklagten und damit zu dessen Freispruch geführt h ä tte.
Klar: Grob sind diese unterteilt in Verstöße gegen das sachliche Recht und Verstöße gegen das Verfahrensrecht. Innerhalb der Verfahrensverstöße ist wieder zu beachten, daß Verfahrenshindernisse oder das Fehlen von Verfahrensvoraussetzungen von Amts wegenzu prüfen sind! Das setzt natürlich aber voraus, daß die Revision erst mal zulässig ist. Ohne dies, wird gar nicht geprüft.
Das heißt also, daß - wenn die Rüge der fehlenden Verfahrensvoraussetzungen die einzige
Rüge ist - diese sehr wohl explizit erhoben werden muß, nämlich, damit überhaupt eine Revisionsbegründung vorliegt, welche das Rechtsmittel erst zulässig macht.
Das heißt aber auch, daß für diese Prüfung etwaige Beschränkungen der Revision unbeachtlich sind. Wird ein Fehler hier entdeckt, wird das Urteil aufgehoben. Peng.
I. Verfahrensvoraussetzungen
- hier, Hauptverfahren - Proze ß voraussetzungen
Klar, die müssen vorliegen, sonst wird eingestellt, §§ 206a, 260 III. Ist die Sache schon entscheidungsreif zum Freispruch, erfolgt nach HM dieser - weil dessen Wirkungen weitergehen. Zu den Details · K/M § 260 Rn. 44 ff.)
Zu den unten genannten Voraussetzungen kommt noch hinzu, daß beim vorangegangenen
Berufungsverfahren die Berufung zulässig gewesen sein muß. Überprüft wird in der Revision ja das Urteil 2. Instanz. Hätte dieses gar nicht ergehen dürfen, wird es aufgehoben, das Urteil
1. Instanz damit wiederhergestellt.
II. Sonstige Verfahrensrügen
1. absolute Revisionsgründe, § 338
a) Unvorschriftsmäßige Besetzung des Gerichtes, § 338 Nr. 1
Zunächst ist der (im Text angegebene) Zusammenhang zu § 222a zu beachten. I.Ü. wird eine (objektiv) willkürliche Fehlbesetzung, die unter keinem Gesichtspunkt mehr vertretbar ist gefordert.
b) Unzuständiges Gericht, § 338 Nr.4
Hat wegen §§ 6, 16 (ohne diese Rüge greift die Revision hier nicht, die Begründung muß dies vortragen!) nicht die übergroße Bedeutung.
c) Vorschriftswidrige Abwesenheit von Beteiligten, § 338 Nr. 5
Das wird insbesondere bei der Abwesenheit eines Pflichtverteidigers oder eines notwendigen Dolmetschers akut.
d) Verstoß gegen die Öffentlichkeit, § 338 Nr. 6
Nur die unzulässige Einschränkung, nicht das Unterbleiben der Ausschließung kann gerügt werden. Die Einschränkung muß dem Gericht auch zurechenbar sein, nicht also etwa, wenn der Hausmeister das Gericht vorzeitig abgeschlossen hatte.
e) Fehlen der Urteilsgründe oder Fristüberschreitung, § 338 Nr. 7
Fertig ist das Urteil erst dann, wenn der Text steht und von allen Berufsrichtern unterzeichnet wurde, § 275.
f) Unzulässige Beschränkung der Verteidigung in einem wesentlichen Punkt durch Gerichtsbeschluß, § 338 Nr. 8
Ganz klar: das bloße (etwa verhandlungsleitende) Maßnahmen des Vorsitzenden nicht ausreichen, muß der schlaue Verteidiger bei suspekten Handlungen einen Beschlußherbeiführen, § 238 II.
Ausnahmsweise kann ein solcher Beschluß auch gerade in der Ablehnung des entsprechenden Antrages erblickt werden.
Die Frage, ob ein wesentlicher Punkt betroffen wurde, entspricht etwa der Frage, ob das Urteil auf der Verletzung beruht bei den relativen Gründen.
Zuletzt muß die Entscheidung unzulässig sein. Das ist nicht etwa jede nachteilige Entscheidung.
2. relative Revisionsgründe, § 337 I
a) §§ 52-58, 252 - Belehrung von Zeugen, Belehrungen, Verweigerungsrechte
Die allg. Belehrung nach § 57 und die Belehrung nach § 55 sollen nach HM für den
Angeklagten nicht revisibel seinen, da sie nicht seine Rechte berührten (Rechtskreistheorie). Deswegen könne ja § 55 auch umgangen werden, indem frühere Aussagen verlesen werden. Anders bei § 53, der auch den Angeklagten schützt. Insoweit stellt ja auch § 252 ein Verlesungs- und Verwertungsverbot auf.
b) Vereidigung, §§ 59-64
Um die Vereidigung trotz Verbotes zu entdecken, muß man vorher schonmal den SV materiell durchdacht haben - sonst dürfte man kaum auf den Verdacht der Beteiligung
kommen.
Beim Unterlassen der Vereidigung ist nicht so wichtig, ob der konkrete Grund, warum sie unterlassen wurde richtig ist, sondern ob im Ergebnis das Unterlassen richtig war - wie sonst sollte das Urteil auf der Unterlassung beruhen?
c) Ablehnung von Beweisanträgen, § 244
Wenn denn ein "richtiger" Beweisantrag vorliegt, dann darf er auch nur aus den in § 244 genannten Gründen abgelehnt werden. Was diese uns genau sagen wollen, liest man am Besten im Kommentar nach.
d) die Aufklärungsrüge, § 244 II
Das Gericht trifft dann eine Aufklärungspflicht, wenn bestimmte, dem Gericht bekannte
Tatsachen es nahelegen, von einem Beweismittel zur Klärung einer Beweistatsache Gebrauch zu machen.
Das muß dann aber auch detailliert gerügt werden, also: Was hätte geklärt werden sollen, welche Beweismittel hätte genutzt werden müssen, inwieweit hätte sich das aufgedrängt (siehe Bsp. oben).
e) Verstoß gegen den Mündlichkeitsgrundsatz, § 261
Man kann ja mal nachschauen, ob wirklich jeder der in der Urteilsbegründung genannten Zeugen vernommen, jede Urkunde verlesen wurde usw.
f) Kein Hinweis auf veränderte rechtliche Gesichtspunkte, § 265
Das ist billig, aber doch schwer zu entdecken, da eben gerade nichts geschieht. Also hilft
nichts, als den Schuldvorwurf der zugelassenen Anklage und des Urteils abzugleichen und bei Divergenz nach einem Hinweis zu suchen. Wird man nicht fündig, hat man des Verstoß.
g) Fehler aus dem Ermittlungsverfahren
Beispiel bei Hemmer war die Telefonüberwachung (Hemmer AssBStr. Fall 5). Hier kann man sich ja streiten, ob bei der Verwertung ein Fehler der Ermittlungsverfahrens oder des Gerichtes selbst zu rügen ist. Richtigerweise wohl des Gerichtes, denn dieses begeht ja erst den (für das Urteil) relevanten Verstoß, indem es verwertet.
Prüfungsmaßstab: Soweit es um Telefonüberwachungen (o.a. Gestaltungen, bei denen
richterliche Anordnungen vorliegen) geht, ist zu beachten, daß die Voraussetzungen der Anordnung revisionsrechtlich überprüft werden müssen, da eine Rechtsschutz gegen die Maßnahme z.Z. ihrer Durchführung kaum zu erlangen sein wird.
Allerdings obliegt dem Tatrichter bei der Anordnung solcher Maßnahmen ein gewisser
Beurteilungsspielraum, der als solcher nicht der Disposition des Revisionsrichters unterliegt. Dieser kann die Entscheidung des Tatrichters somit lediglich auf Ihre Vertretbarkeit prüfen. Dies ergibt sich daraus, daß die Anforderungen an die Anordnungen in den § 98 ff. derartig fein abgestimmt sind (lesen!), daß sich eine völlig objektive Einschätzung ihres Vorliegens gar nicht wird treffen lassen.
III. Die Sachrüge
Hier wird gerügt, daß das Gericht aus dem festgestellten SV falsche rechtliche
Schlußfolgerungen gezogen hat. Das heißt aber gerade, daß mit der Sachrüge nicht (bzw. kaum, es gibt Ausnahmen) die Beweiswürdigung angreifbar ist, es mag aber das Verfahren der Sachverhaltsfeststellung zweifelhaft sein.
Bsp. Wenn also der Angeklagte dummes Zeug plappert und ziemlich verwirrt aussieht, das
Gericht aber zu der Überzeugung kommt, er sei völlig gesund, so kann nichtetwa ein Verstoß gegen § 20 StGB gerügt werden, denn dem festgestellten SV (Angeklagter ist gesund) ist dieser ja gerade nicht einschlägig.
Man käme aber wohl mit der Aufklärungsrüge weiter, das Gericht hätte einen Sachverständigen zuziehen sollen.
a) Unzureichende Sachverhaltsfeststellung
Daß mind. dem § 267 genügt werden muß, ist wohl klar. Die Revisionsgerichte verlangen aber mehr. Das Urteil muß wirklich alle obj. und subj. TBMerkmale enthalten, also eine vollständige Subsumtion des SV zulassen.
b) Unzureichende Ausführungen zur Beweiswürdigung
Nach neuerer RS muß die Beweiswürdigung in nachvollziehbarer und damit prüfbarer Weise dargelegt werden.
c) Versto ß gegen Denk- und Erfahrungsgesetze
Auch bei völlig abwegigen Schlüssen wurde das Gesetz nicht richtig angewendet. Ein Verstoß
gegen Denkgesetze liegt aber nicht schon dann vor, wenn der Richter von mehreren
Möglichkeiten nur einer bestimmten gefolgt ist (übrigens ggf. auch kein Verstoß gegen den in dubio pr reo Grundsatz - der Richter kann ja von dieser einen Möglichkeit voll überzeugt sein, auch wenn mehrere Möglichkeiten existieren).
Allerdings muß er sich zumindest mit den wirklich ganz naheliegenden Alternativen auseinandersetzen, wobei das nicht ins Unendliche getrieben werden muß.
d) Versto ß gegen den · In dubio pro reo-Satz
Wenn z.B. aus den Gründen deutlich wird, daß dem Angeklagten die Beweislast übergebürdet wurde, etwa weil er keine Entlastungszeugen benennen konnte.
e) Fehler bei der Strafzumessung
Wenn vom falschen Strafrahmen ausgegangen wurde oder Strafmilderungsgründe übersehen wurden. Oder wenn Prozeßverhalten des Angeklagten, etwa Leugnen, berücksichtigt wurde. Weiterhin z.B., wenn Tatbestandsmerkmale verwendet werden, um die besondere schwere des Falles zu begründen usw.
Revison
Aufbau der Klausuren
I. Erfolgsaussichten der eingelegten und begründeten Revision
1. Förmlichkeiten
2. Prozeßvoraussetzungen und Verfahrenshindernisse, die von Amts wegen zu berücksichtigen sind
3. Stellungnahme zu den erhobenen prozessualen Rügen
a) Zulässigkeit der Rüge, § 344 II
b) Begründetheit der Rüge
4. bei Sachrüge: Untersuchung des Urteils in sachlicher Hinsicht. Hier neben der materiellen Prüfung auch erörtern, ob das Urteil als solches klar geht (Sachverhaltsfeststellung, Beweiswürdigung usw.)
5. Entscheidungsvorschlag (sollte man schon machen)
6. Hilfsgutachten (v.a. nicht gerügte problematische Punkte - die wollen ja auch erörtert werden)
II. Anfertigung einer Revisionsbegründung
1. Adressat, Eingangszeit
2. Revisionsanträge
3. Begründung der Revisionsanträge
a) Hinweis auf fehlende Verfahrensvoraussetzungen
b) erfolgversprechende Verfahrensrügen
c) Sachrüge
4. Hilfsgutachten
III. Vorbereitung der Revisionsbegründung, dazu Erstattung eines Gutachtens über die mat. und prozessuale Rechtslage
1. Zulässigkeit der Revision
2. Erörterung der Prozeßvoraussetzungen bzw. Verfahrenshindernisse
3. Erörterung der prozessualen Fragen
4. Erörterung materiell-rechtlicher Fragen
5. Zusammenfassung der Verstöße, die zur Aufhebung des Urteils führen
Staatsanwaltschaft
Wegen des Untersuchungsgrundsatzes muß sie den Sachverhalt vollständig, also auch zugunsten des Beschuldigten erforschen, § 160 II. Sie entscheidet, ob Klage erhoben wird.
Eigenständiges Organ der Rechtspflege (damit weder Verwaltung, noch Rechtsprechung, vielmehr eine Art Brücke zwischen Exekutive und Legislative) und Herrin des Vorverfahrens. Die Organisation folgt der Gerichtsorganisation, §§ 141 ff GVG. Die armen Staatsanwälte sind weisungsgebunden, § 146 GVG. Dieses Weisungsrecht findet seine Grenzen im Legalitätsprinzip. Weisungen, die dagegen verstoßen (etwa, bestimmte Straftaten von Parteifreunden nicht zu verfolgen) muß (und darf!) nicht Folge geleistet werden.
Ganz schwieriges Thema ist die Ablehnung wegen Befangenheit, das ist nämlich nicht geregelt. Man kann es beim Dienstvorgesetzten versuchen, § 145 GVG. Jedenfalls aber wäre die Mitwirkung eine befangenen Staatsanwaltes ein Revisionsgrund nach § 337.
Die Ermittlungen der StA sind keine Justizverwaltungsakte und damit auch nicht nach § 23 EGGVG angreifbar, denn sie bereiten nur die Abschlußverfügung vor. Die Kontrolle erfolgt dann bei der Anklageerhebung.
Interessant ist auch, ob die StA bei ihrer Anklage an die gefestigte höchstrichterliche RS gebunden ist (z.B. Strafbarkeit wegen unterlassener Selbstmordhinderung nach § 323c.) Der BGH meint, daß das Legalitätsprinzip und die Einheitlichkeit der Rechtsanwendung eine Bindung erfordern.
Das kann aber eigentlich nicht richtig sein, denn für die Erhebung oder Nichterhebung der Anklage sind die Gerichte nicht zuständig. Also sollen sie auch nicht mittelbar durch eine Bindung der Anklagebehörde bestimmen können, was angeklagt wird.
Störungen der Hauptverhandlung Hier hat der Vorsitzende die Sitzungspolizei, § 176 GVG. Was genau er tun kann und darf, ergibt sich aus §§ 177, 178 GVG.
Bei Straftaten in der Sitzung, ist gemäß § 183 GVG vorzugehen, also ein Vermerk ins Protokoll zu geben, später die zuständigen Stellen zu informieren.
Strafanzeige
Die Anzeige kann überall aufgegeben werden, § 158. Eine aufgegebene Strafanzeige kann auch als Strafantrag gelten, wenn sich aus ihr der unzweideutige Wille des Verletzten ergibt, daß er die Tat auch unter dem Gesichtspunkt des Antragsdeliktes verfolgt wissen will.
Strafbefehl
§§ 407 ff. (bei den Sonderformen des Verfahrens) Gegen den Strafbefehl kann Einspruch eingelegt werden. Soweit dies geschehen ist, gilt das Verbot der RIP nicht, § 411 IV. Wird also mündlich verhandelt, ergeht ein ganz normales Urteil, der Strafbefehl wird im Tenor nicht erwähnt (nicht also z.B. aufrechterhalten o.ä.).
Ein Sonderproblem ist, daß der SB einem Sachurteil gleichsteht, § 410 III, aber bloß ein summarisches Verfahren ist, so daß die Tat auch leicht schwerer als im SB angenommen sein kann. Dafür gibt § 373a eine besondere Wideraufnahmevorschrift zuungunsten des Verurteilten, wenn sich nun ein Verbrechen ergäbe.
Tat
prozessuale
Kommentierungen: K/M, § 264/1 ff.
Was?
Der durch die Anklage dem Gericht unterbreitete geschichtliche Vorgang, soweit er nach der Lebensauffassung eine Einheit bildet. Das ist dann der Fall, wenn zwischen den einzelnen Verhaltensweisen des Angeschuldigten eine innere Verknüpfung von der Qualität besteht, daß eine getrennte Aburteilung in verschiedenen Verfahren einen einheitlichen Lebenssachverhalt unnatürlich aufspalten würde (vgl. Rn. 3).
Im Verhältnis zum materiellen Strafrecht ist der Begriff selbständig. Liegt Tateinheit vor, ist immer auch eine prozessuale Tat gegeben, bei Tatmehrheit müssen aber nicht auch mehrere prozessuale Taten vorliegen. Insb. wird dann eine Tat anzunehmen sein, wenn frühre Fortsetzungszusammenhang gegeben gewesen wäre.
Bedeutung
Klar, Rechtshängigkeit. Insbesondere auch dann, wenn bloß Teile der Tat angeklagt werden! Der Rest kann dann eben nicht woanders noch angeklagt werden.
Bloß hinsichtlich der Tat darf das Gericht ermitteln (Akkusationsprinzip), die rechtliche Bewertung aber anders sehen. Nach § 170 kann nur hinsichtlich der ganzen Tat eingestellt werden.
Und natürlich wichtig für den Strafklageverbrauch (ne bis in idem, Art. 103 GG).
Probleme ergeben sich immer bei der Wahlfeststellung und Postpendenzfeststellung, ganz klassisch bei Diebstahl und Hehlerei. Im Fall wird dann wohl eine Tat als Diebstahl angeklagt sein. In der Verhandlung stellt sich dann z.B. heraus, daß entweder ein Diebstahl am 18.1. oder eine Hehlerei am 20.1. vorlag. Die Frage ist dann, ob wirklich ohne weiteres wahlweise verurteilt werden kann.
Dann müßten beide Alternativen als von der Anklage umfaßt angesehen werden können. Das ist aber hier (zeitlicher und örtlicher Zusammenhang) stark zu bezweifeln.
Urteil
Allgemeines
I. Arten
Es gibt grundsätzlich - ganz ähnlich wie im Zivilrecht - Sachurteile (§ 267) und Prozeßurteile (§ 260 III). Bei den Sachurteilen wiederum kommen Verurteilung, Freispruch und Anordnung von Maßregeln in Frage.
II. Fristen
Für die Ausfertigung der Urteils gibt es natürlich eine Frist im § 275 I. Ein Verstoß dagegen stellt einen unbedingten Revisionsgrund dar, § 338 Nr. 7.
III. förmliche Zustellung
Ist eigentlich nur nötig, wenn ohne den Angeklagten verhandelt wurde (steht dann jeweils in der Vorschrift), in der Praxis wird es aber immer gemacht. Die Zustellung selbst richtet sich dann nach den allg. Vorschriften in §§ 36 ff.
Urteil
Aufbau
I. Rubrum
Immer nachschauen in der RiStBV, Nr. 114, 110
AG X
AZ XY
Im Namen des Volkes!
Urteil
in der Strafsache gegen
(große Personalien)
wegen Unterschlagung u.a.
hat das AG - Strafrichter - X in der ö ffentlichen Verhandlung vom 23.2.1999, an der teilgenommen haben
(...)
für Recht erkannt: (...)
angewandte Vorschriften: (..)
II. Tenor
1. Allgemein
Ganz wichtig: Nach der BGH RS (und nicht dem bayerischen Modell) ist der Tenor möglichst schlank zu halten. Der Tenor untergliedert sich in den
- Schuldspruch
- Rechtsfolgenausspruch _ Nebenfolgenausspruch
Die Punkte 1 und 2 kann man in einfachen Fällen auch zusammenziehen.
a) Der Angeklagte ist schuldig des Diebstahls
b) Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten verurteilt
c) Die Vollstreckung der erkannten Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt
d) Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen
Hier müßte dann außerhalb des Urteils, aber zugleich mit dem Urteil noch ein Bewährungsbeschluß nach § 268a ergehen:
Beschluß
Die Dauer der Bewährungszeit beträgt drei Jahre.
2. bei U-Haft
Es gibt erst mal keine Besonderheiten, insb. ist die Anrechnung der U-Haft auf die
Freiheitsstrafe nicht zu tenorieren, denn dies ergibt sich schon aus § 51 I StGB. Zu bedenken ist allein, daß zusammen mit dem Urteil ein Beschluß zu verkünden ist, § 268b:
"Haftfortdauer wird angeordnet" oder
"Der Haftbefehl des (...) wird aufgehoben" oder "...außer Vollzug gesetzt", § 116
3. Entzug der Fahrerlaubnis / Fahrverbot
Beides ist zu trennen, denn während das eine Maßregel ist (§ 69 StGB) ist das andere eine Nebenstrafe (§ 44 StGB).
Im ersten Fall würde der Tenor lauten:
c) Dem Angeklagten wird die Erlaubnis zum Führen von KFZ entzogen, sein Führerschein wird eingezogen. Vor Ablauf von 12 Monaten darf ihm die Verwaltung keine neue Fahrerlaubnis erteilen
Im Zweiten Fall hieße das schlicht:
c) Dem Angeklagten wird für die Dauer von 2 Monaten verboten, im Straßenverkehr Kraftfahrzeuge jeder Art zu führen.
4. Nebenklägerbeteiligung
Im Rubrum ist er zu berücksichtigen. Wird der Angeklagte verurteilt wegen eines Deliktes, das den Nebenkläger betrifft, so ist auszusprechen, daß er auch dessen Kosten zu tragen hat.
5. Tateinheit
a) Der Angeklagte ist schuldig eines Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung
Achtung! Wäre hier der Betrug nicht gegeben, wäre nicht etwa ein Teilfreispruch erfolgt,
denn es handelt sich gerade nur um die rechtliche Betrachtung einer Tat. Allerdings wäre das in den Urteilsgründen zu erwähnen.
Sind mehrere Alternativen z.B. des § 250 erfüllt, ist dies kein Fall des § 52, es wäre also nur wegen schweren Raubes zu verurteilen.
6. Tatmehrheit
Hier einfach ein "und" einsetzen, wenn es ungleichartige Tatmehrheit ist, bei gleichartiger einfach "in X Fällen" schreiben:
a) "Der Angeklagte ist schuldig eines Hausfriedensbruches und eines Diebstahls" oder "Der Angeklagte ist schuldig eines Betruges in fünf Fällen"
b) "Er wird deshalb zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt"
Beim Wegfall eines Deliktes muß - auch wenn nur eine prozessuale Tat vorliegt - im Übrigen freigesprochen werden. Anders aber bei der StA - da erfolgt im Rahmen einer prozessualen Tat keine Teileinstellung.
Der Unterschied wird damit gerechtfertigt, daß sich der Schuldspruch nach materiellem Recht, nicht Verfahrensrecht richtet.
7. Mittäterschaft
Erscheint im Tenor nicht, es wird normal tenoriert:
"Die Angeklagte A und B sind schuldig des Diebstahls. Es werden daher verurteilt:
Der Angeklagte A zu ...
Der Angeklagte B zu ...
Die Angeklagten haben die Kosten des Verfahrens zu tragen"
8. Urteil bei Wahlfeststellung
Bei gleichartiger Wahlfeststellung (z.B. es ist eine Falschaussage, unklar ist, welche der beiden Aussagen falsch war, eine muß es aber sein) ergeben sich keine Besonderheiten. Bei ungleichartiger Wahlfeststellung (es ist entweder ein Diebstahl oder eine Unterschlagung) ist umstritten, ob man nur wegen des milderen Deliktes verurteilt oder wirklich beide Alternativen in den Tenor aufnimmt.
8. Strafbefehl
Es ergeht nach Einspruch ein normales Urteil, der SB wird nicht erwähnt.
9. Ordnungswidrigkeit
Im Prinzip keine Besonderheiten. Die Ordnung swidrigkeit also solche wird nicht erwähnt, auch hier ist nach § 260 IV die rechtliche Bezeichnung der Tat (z.B. vorsätzliches Überholen bei unklarer Verkehrslage) zu benutzen.
10. Zusammentreffen von Straftat und Ordnungswidrigkeit
Nur auf die Terminologie achten, ansonsten die allg. Grundsätze anwenden, strukturell ist ja das OWiG-Recht sowieso Strafrecht (Übertretungen!)
"Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Schädigung eines anderen Verkehrsteilnehmers und unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu einer Geldbuße von 80 DM und einer Geldstrafe von (...) verurteilt.
Beachte aber § 21 I OWiG, bei Tateinheit - eine Handlung ist eine Straftat und eine OWiG wird nur die Straftat verfolgt. Oben aber liegt Tatmehrheit, jedoch eine prozessuale Tat vor.
III. Urteilsgründe
Das Strafurteil ist - anders, als das Zivilurteil - nicht in Tatbestand und Entscheidungsgründe gegliedert, es hat bloß Gründe.
1. Person des Angeklagten
Schweigt das Urteil zu den persönlichen Verhältnissen, ist dies ein sachrechtlicher Mangel, §
46 II StGB; er führt zur Aufhebung des Urteils.
Hier hinein gehören auch die Vorstrafen. Hemmer allerdings meint, man solle bloß die einschlägigen Vorstrafen aufzählen, nicht aber schematisch alle. So aber die Praxis.
2. Sachverhalt
a) Wichtig ist, daß wirklich alle TB-Merkmale in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt sind. Dabei dürfen nicht die technischen Umschreibungen verwendet werden. Wichtig ist auch, daß Zeit, Ort und Schaden immer möglichst genau ausgeführt werden.
b) Insb. ist eben auch die subj. Seite zu achten; so reicht es bei einem Stich in den Oberkörper
eben nicht aus, Vorsatz bezüglich des Stiches anzunehmen, vielmehr gehört noch ein Satz dazu wie "... um den A zu t ö ten".
Schwierig wird das schon bei Fahrlässigkeitstaten. Hier ist zu bedenken, daß die
Sorgfaltspflichtverletzung, deren Kausalität für den Erfolg und die Vorhersehbarkeit
darzulegen sind, im Prinzip also das ganz normale Prüfungsschema abgerattert werden muß. Auch recht schwierig sind hier etwa die Fälle der Mittäterschaft. Hier ist dann genau darzulegen, was der einzelne Täter getan hat, und daß sich sein Vorsatz auf die ganze Tat bezieht. Auch die weltberühmte Floskel "... in bewußtem und gewollten Zusammenwirken ..." darf nie fehlen.
c) Nach den subj. Merkmalen kommen gemäß § 267 II die besonderen Umstände, wie der Rücktritt oder Privilegierungen/Qualifizierungen. Nicht aber Strafzumessungsregeln, wie § 243. Für diese ist § 267 III 2 zuständig.
Zu den besonderen Umständen i.S. des § 267 II gehören natürlich auch solche Sachen wie etwa § 21, also ist zum Alkoholkonsum des Täters immer ein Wort zu verlieren.
d) Zumindest Hubert meint, im Sachverhalt müßten auch die Punkte Beachtung finden, die für die Strafzumessung von Bedeutung sind. Also z.B. das Bemühen des Täters, den Schaden wiedergutzumachen etc.
e) in der Klausur ist meist der Sachverhalt aus der Anklageschrift abzupinseln, aber es darf eben nicht vergessen werden, was sich in der Hauptverhandlung noch ereignet hat.
3. Beweiswürdigung
Auch hier unterteilen, die Feststellungen zu den pers. Verhältnissen und den Tathergang trennen.
"Die Feststellungen zum Lebenslauf sowie zu den pers ö nlichen und familiären Verhältnissen des Angeklagten beruhen auf dessen Einlassungen sowie auf den Aussagen der Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, Fau X.
Die Beweiswürdigung zum Sachverhalt beginnt i.A. mit dem Sta ndartsätzchen:
Der Sachverhalt zum Hergang der Taten steht fest aufgrund der Einlassungen des
Angeklagte, soweit diesen gefolgt werden konnte, in Verbindung mit den Angaben der Zeugen sowie den in der Hauptverhandlung verlesenen Urkunden."
Die eigentliche Beweiswürdigung folgt dann diesem Aufbau, also erst der Angeklagte, dann die Zeugen, zum Schluß die Urkunden. Bei den Urkunden kann immer im Nebensatz noch erwähnt werden, warum deren Verlesung zulässig war, §§ 251 ff.
In der Beweiswürdigung ist dann auch Raum, sich mit der Zulässigkeit der Beweiserhebung und -verwertung zu befassen.
4. rechtliche Würdigung, Vorschriften
a) Hier wird empfohlen, mit einer nochmaligen Anführung des Schuldspruches zu beginnen ("die Angeklagten waren daher wegen Diebstahls ...").
Es ist jetzt auch die Art der Ausführung anzugeben, ebenso die Konkurrenzen. Sodann wird eben subsumiert.
Richtigerweise wird man, wenn hinsichtlich einer Tat (! Wichtig, da sonst ja Teilfreispruch) mehrere, letztlich nicht einschlägige Tatbestände in Betracht kommen, diese im Urteil hinterher noch ablehnen dürfen.
4a. prozessuale Ausführungen, wenn erforderlich
a) z.B. Umfang der Anklage oder eine bestehenden Rechtskraft - was wieder am
prozessualen Tatbegriff nach § 264 hängt, Strafanträge usw. Letztlich ist das wohl fast so
etwas wie die Zulässigkeit im Zivilurteil, bloß eben, daß es wirklich bloß im Notfall gebracht wird.
b) vor allem aber sind hier ggf. Probleme des prozessualen Tatbegriffes und der
Nachtragsanklagezu erörtern. Denn: abgeurteilt werden kann nur, was auch angeklagt ist. Was das aber ist, muß in schwierigen Fällen erörtert werden, insb. hier natürlich, was denn nichtverurteilt wurde.
- Tatbegriff, prozessualer
5. Strafzumessung
" ... für notwendig, aber auch ausreichend"
p>a) Üblicherweise beginnt man auch hier mit der Aufzeigung des Strafrahmens. Danach
schaut man, ob Strafänderungsgründe vorliegen. Diese sind auch dann zu erörtern, wenn sie nicht vorlagen, aber ihre Berücksichtigung beantragt war, § 261 III 2. Die Beantragung kann dabei auch konkludent erfolgen, wenn z.B. eine Strafe beantragt wird, die nur bei Annahme einer Milderung überhaupt zulässig ist.
Bei schweren Fällen ist zu unterscheiden. Bei einem Regelbeispiel reicht das Aufzeigen von dessen Voraussetzungen; bei einem sonstigen schweren Fall muß mehr Begründungsaufwand betrieben werden.
Beachte beim Zusammentreffen von Milderungsgründen § 50
b) Nun erfolgt das Aufzeigen der Strafart.
c) nun erfolgt noch die Ausfüllung des Strafrahmens. Zu den dabei zu berücksichtigenden Kriterien sagt uns § 46 StGB etwas. Man fängt mit den günstigen Umstände an.
Gemäß § 46 III dürfen Umstände, die schon den TB begründen nicht zulasten des Täters
berücksichtigt werden. Das gilt auch für Umstände, die ein Regelbeispiel begründen. Nicht gelten soll es aber für Umstände, die einen minder/besonders schweren Fall begründen, soweit § 50 nicht entgegensteht. Das heißt also, daß ein und derselbe Umstand hier sowohl zur Findung, als auch zur Ausfüllung eines Strafrahmens genutzt werden darf.
d) Bei Gesamtstrafenbildung wirklich ganz systematisch vorgehen, also erst jede einzelne Strafe herausarbeiten und dann sich der Gesamtstrafe zuwenden. § 55 StGB nicht übersehen! Beachte, daß im Tenor die Gesamtstrafe auftaucht:
"Der Angeklagte wird zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt"
In den Gründen muß dann eben jede einzeln ausgeführt werden. Wird nach § 55 auf eine
Gesamtstrafe erkannt, muß im Tenor mit aufgeführt werden, welches Urteil denn einbezogen wird. Das ist klar, ansonsten könnte (bei nur einer Tat im neuen Urteil) evtl. nicht recht klarwerden, warum denn gerade eine Gesamtstrafe ausgesprochen wird.
"Er wird unter Einbeziehung der Strafe aus dem Urteil des AG (...) vom (...) AZ (...) zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von ..."
Eine damals gebildete Gesamtstrafe muß aufgelöst werden, es wird eine komplett neue Strafe gebildet.
e) Die Strafaussetzung zur Bewährung ist ein Teil der Strafzumessung, und muß so im Urteil auch erscheinen.
f) auch mit Maßregeln muß man sich beschäftigen, hier insb. mit dem Entzug der Fahrerlaubnis.
g) Zuletzt verliert man noch ein Wort zur Kostenentscheidung. 5a. Ausführungen zum Freispruch / teilweiser Einstellung
a) Freispruch
aa) Nach § 267 V 1 muß das Urteil erkennen lasse, warum eingestellt wird. Es müssen alle in Betracht kommenden TB angesprochen werden.
Achtung: Kann die Tat, wegen der der (nicht ins Gewicht fallende) Rest gemäß § 154a eingestellt wurde nicht nachgewiesen werden, sind die eingestellten Sachen jetzt wieder vorzukramen, denn § 154a bewirkt keinerlei Strafklageverbrauch.
Beim Freispruch empfiehlt sich folgender Aufbau:
- Schilderung der dem Angekl. zur Last gelegten Tat _ Darstellung des festgestellten Sachverhaltes
- Darlegung, warum sich das Gericht nicht von der Schuld des Angeklagten überzeugen konnte
- Kosten (trägt die Staatskasse)
Nicht vergessen sollte man, daß auch bei einem Freispruch Maßregeln zulässig sind.
Bei Teilfreispruch ist erst hier auf diesen einzugehen. Hier ist dann alles zu bringen, insb.
auch Beweiswürdigung und rechtliche Würdigung hinsichtlich des freigesprochenen Deliktes. Genauso läuft es im Fall des § 260 III, der teilweisen Einstellung.
b) Einstellung
"Das Verfahren wird eingestellt. Die Staatskasse trägt die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Ausgaben des Angeklagten."
Bei Tatmehrheit kann natürlich auch bloß teilweise eingestellt werden.
6. Kostenentscheidung
VI. Unterschrift
Nach § 275 II 1, 3 unterschreiben die Schöffen nicht.
Gar nicht so einfach ist der Aufbau bei mehreren abgeurteilten Taten. Der Übersicht halber sollte man dann wirklich in Taten gliedern und die Punkte II., III. und IV. pro Tat abhandeln.
Verdacht
Die auf Tatsachen - nicht reine Vermutung - begründete Möglichkeit, daß eine Straftat
vorliegt und (soweit nicht Ermittlung gegen Unbekannt), der Verdächtige an der Tat beteiligt sein kann.
Der Verdacht muß sich, damit die StA tätig wird, auf eine verfolgbare Tat richten.
- Hinreichender Tatverdacht, wenn eine Aburteilung wahrscheinlich ist.
- Dringender Tatverdacht, die große Wahrscheinlichkeit, daß der Beschuldigte Teilnehmer einer bestimmten, verfolgbaren Straftat ist.
Verdeckter Ermittler
§ 110 b
Ein ganz interessantes Problem in (· Hemmer AssBStr 6/19 ff.) war, wer eigentlich für die
Erteilung der Sperrerklärung nach §§ 110 b III i.V.m. 96 zuständig ist: Denn hat der
Unzuständige gehandelt, hat das Gericht wohl gegen seine Amtsermittlungspflicht aus § 244 verstoßen, wenn es nicht weitere Anstrengungen unternahm, den VE heranzuziehen.
Letztlich ist das Innen-, nicht das Justizministerium zuständig. Dies folgt zum einen schon
daraus, daß der VE Polizeibeamter ist, die letztliche Entscheidung über seinen Einsatz obliegt der Polizei, die StA kann nur zustimmen (§ 110 b!). Zudem dient der VE meist sowohl
repressiven, als auch präventiven Zwecken, und spätestens da fällt die Justiz raus. Das
Justizministerium könnte auch nur schwer die Gefährdung des VE durch eine Vernehmung einschätzen, die wissen ja gar nicht - der Einsatz liegt ja in der Hand der Polizei. Das Ganze gilt entsprechend für Informanten/V-Leute usw.
Verteidiger
Allgemeines
Selbständiges, dem Gericht und der StA gleichgestelltes Organ der Rechtspflege, nicht bloßer Vertreter des Beschuldigten, sondern unabhängig. Er hat aber ausschließlich die Interessen seines Mandanten zu wahren.
Wann
Der Beschuldigte kann sich in jeder Lage des Verfahrens eines Wahlverteidigersbedienen, § 137.
Wichtig ist die Bestellung eines Pflichtverteidigers in den Fällen des § 140 ff. Insbesondere interessant ist hier § 140 I Nr. 5, wenn sich der Beschuldigten schon 3 Monate in Haft befindet.
Ebenfalls Revisionsreife liegt vor, wenn die Anklageschrift falsch war, und dem
Beschuldigten nun statt eines Vergehens ein Verbrechen zur Last gelegt wird, § 140 I Nr. 2 (Revisionsgrund nach § 338 - Nichtanwesenheit einer ges. vorgeschriebenen Person).
Rechte
Ganz wichtig ist das Kontaktrecht des § 148. Dieses zieht u.U. auch Beschlagnahmeverbote, z.B. von Mandantenpost nach sich. Der Verteidiger hat zudem ein Anwesenheitsrecht bei jeder Vernehmung durch Richter u. StA, §§ 163a, 168c. Siehe auch · Akteneinsicht.
Ausschluß
Nach § 138a.
Verwertungsverbot
Nur mal eine kurze Phrase (AssB Fall 3):
"Eine fehlerhafte Beweiserhebung l ö st nicht zwangsläufig ein Beweisverwertungsverbot aus.
Vielmehr richtet sich dies nach einer umfassenden Abwägung, bei der das Gewicht des
Verstoßes sowie seine Bedeutung für die rechtlich geschützte Sphäre des Betroffenen ebenso ins Gewicht fallen wie die Erwägung, daßdie Wahrheit nicht um jeden Preis erforscht werden darf.
Ein Verwertungsverbot liegt somit dann nahe, wenn die verletzte Bestimmung gerade bestimmt ist, die verfahrensrechtliche Stellung des Beschuldigten im Strafverfahren zu sichern.
Ganz interessant und m.E. schwer zu merken (und im Kommentar nicht einfach zu finden) ist die Konstellation §§ 250/252. Da kann man nämlich zu Verwechslungen kommen:
§ 250 statuiert nicht etwa den Vorrang des tatnächsten Beweismittels, sondern betrifft eben bloß das Verhältnis Urkunden/Zeugenbeweis. Er hat also keinerlei Sperrwirkung.
Bsp: Der Angeklagte hatte bei der Polizei ein Geständnis abgelegt. In der HV sagt er nichts. Hier darf man den Polizeibeamten vernehmen. Eine dem § 252 entsprechende Vorschrift fehlt gerade für den Angeklagten. Das dürfte eine Kehrseite seines Rechtes, sich schweigend zu verteidigen sein.
Eselsbrü> "Alles was Sie sagen, kann gegen Sie verwendet werden"
§ 252 dagegen verbietet jede Art der Verwertung (außer nach einer
richterlichenVernehmung!). Denn der Schutzzweck der §§ 52, 252 muß eben gesichert
werden. Auch das leuchtet ein wenig ein: Der Zeuge ist ja nicht der Böse und darf auch nur in Ausnahmefällen schweigen. Und diese sind dann schützenswert.
Apropos: § 252 gilt nicht für § 55 - klar, § 252 spricht vom Zeugnis-, nicht vom Aussageverweigerungsrecht.
Wiedereintritt
in die mündliche Verhandlung
Wann: in der bloßen Entgegennahme eines Beweisantrages nach Beginn der Verkündung des Urteils ist wohl keine Widereintritt zu sehen, es wäre sonst dem Mißbrauch Tür und Tor geöffnet.
Was: Im Falle des Wiedereintrittes wird oft darüber gestritten, ob eine nochmalige
Urteilsberatung notwendig ist. Außerdem müssen ja die Prozeßbeteiligten ihre Plädoyers halten und der Angeklagte das letzte (!) Wort haben.
Der Ablauf des Strafverfahrens
Kommentierungen: · K/M Einl. Rn. 58 ff.
A. Vorverfahren
I. Einleitung des Vorverfahrens
Aufgrund von Strafanzeige oder Strafantrag, § 158 I. Der Strafantrag aus § 158 I hat nichts mit dem aus §§ 77 StGB, 158 II (!) StPO geminsam, er ist vielmehr der Wunsch des Antragstellers nach Stafverfolgung. In der Folge muß nach § 171 beschieden werden. Bei Verdacht auf Straftat auf anderem Wege gilt § 160, auch hier sind Ermittlungen aufzunehmen. Für die Polizei gilt hier § 163.
Bei den Antragsdelikten wird die StA eigentlich erst tätig, wenn ein wirksamer Strafantrag vorliegt. Allerdings soll wohl erst mal losermittelt werden können, wenn ein Antrag noch gestellt werden kann, evtl. fordert man noch, daß die Gefahr des Verlustes von Beweismitteln besteht.
Zusätzlich muß nach § 152 II natürlich immer ein Anfangsverdacht vorliegen, das Vorliegen einer verfolgbaren (!) Straftat muß möglich sein.
II. Durchführung der Ermittlungen
1. Vernehmung des Beschuldigten
Geregelt in den §§ 133-136a, auf die auch wegen der Vernehmung durch die StA verwiesen wird.
2. Andere
Da gibt es noch einige. Bei den meisten sollte es genügen, die Vorschriften nachzuschlagen und im Kommentar zu blättern. Interessant sind vielleicht noch die Folgen eines Verstoßes gegen § 81a, Entnahme einer Blutprobe von z.B. einer Krankenschwester. Der Verstoß als solcher zieht kein Verwertungsverbot nach sich, denn geschützt werden soll allein die Gesundheit des Beschuldigten, nicht der Beweiswert des Blutes. Andererseits aber schränkt §
81a das Grundrecht aus Art. 2 I ein, so daß, wenn z.B. über die Arzteigenschaft des
Betroffenen bewußt getäuscht wird, ein Verstoß gegen den fair-trial Grundsatz vorliegt.
Ganz interessant ist wohl noch die Abgrenzung zwischen § 81a und § 102 - Ersterer umfaßt die Suche im Körperinneren, die Durchsuchung dagegen auf und unter der Kleidung und in den natürlichen Körperhöhlen erfaßt § 102.
3. Rechtsmittel
Bei richterlichen Anordnungen normalerweise die Beschwerde nach § 304. Ordnet die StA oder die Polizei die Maßnahmen an, muß Rechtsschutz nach § 98 II 2 (direkt oder analog) gewährt werden.
Bei schon erledigten Maßnahmen soll auch § 98 II 2 (doppelt analog) angewandt werden. Hier wird dann - ganz wie im VW-Recht - ein berechtigtes Interesse an der nachträglichen Feststellung gefordert, was in Diskriminierungswirkung oder Wiederholungsgefahr liegen kann.
III. Untersuchungshaft
Aufpassen muß man halt bei § 212 III, der ja eigentlich die U-Haft auch dann zuläßt, wenn die Strafverfolgung gar nicht gefährdet ist. Dieser ist verfassungskonform auszulegen, so daß schon ein Haftgrund dazukommen muß, wobei aber nicht so hohe Anforderungen gestellt werden. Bei besonders schweren Straftaten mag schon die Aussicht auf die besonders schwere Strafe als Schluß auf Fluchtgefahr reichen.
Immer jedenfalls ist das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu beachten.
Als Rechtsschutz steht dem Betroffenen die Haftprüfung nach § 117 zur Verfügung. Nach 6 Monaten findet von Amts wegen eine Haftprüfung durch das OLG statt.
IV. Einstweilige Unterbringung, § 126a
Die ist das Gegenstück zur U-Haft bei Beschuldigten, bei denen wegen eines Defektes eine Verurteilung nicht zu erwarten ist. Ein Haftbefehl nach § 112 scheidet dann aus (kein dringender Tatverdacht!). Es kommt aber eine Maßregel in Betracht, § 126a dient deren Sicherung.
V. Vorläufige Festnahme, § 127
Lesen, Rechtsschutz nach § 128.
VI. Abschluß des Vorverfahrens
Da gibt es nur zwei Abschlüsse: Entweder wird Klage erhoben oder eingestellt.
1. Einstellung nach § 170 II
Diese ist logisch vor §§ 153 ff. vorrangig, da bei § 170 II schon gar kein durchsetzbarer
Strafanspruch des Staates besteht. Es kann dabei ein Prozeßhindernis vorliegen oder der
Tatverdacht ist eben nicht hinreichend genug. Es kann auch sein, daß der ermittelte
Sachverhalt keinen Straftatbestand erfüllt. Fraglich ist dabei, ob die StA an die
höchstrichterliche RS gebunden ist. Hier gilt alsi Ausfluß des Legalitätsprinzipes: in dubio pro actio, im Zweifel klagen. Ansonsten hätte ja auch der BGH nie Gelegenheit, seine Meinung zu ändern ...
2. Einstellung aus Opportunitätsgründen
Naja, die stehen halt in §§ 153 ff. bzw. noch in § 37 BtMG und Art. 4 KronzG.
3. Klageerzwingungsverfahren, §§ 172 ff.
Die Klage erzwingen kann man nur bei Einstellung nach § 170, nicht §§ 153 ff!
B. Zwischenverfahren
§§ 199-212b
I. Allgemeines
Einleitung durch die StA, die Klage erhebt. Zu den inhaltlichen Anforderungen an die Schrift lies §§ 199, 200; Nr. 110 RiStBV. Der Beschuldigte ist jetzt der Angeschuldigte. Herr des Verfahrens wird das Gericht. Mit der Klage wird der Untersuchungsgegenstand festgelegt. Sinn des Zwischenverfahrens ist, daß das zuständige Gericht prüft, ob die Verdachtsgründe die Durchführung eines Hauptverfahrens rechtfertigen.
II. Zuständigkeiten
Klar, die sachliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem GVG. Beachte beim AG die
nochmalige Zweiteilung in Sachen für den Strafrichter (bis zwei Jahre) und Sachen für das Schöffengericht (bis 4 Jahre).
Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach der StPO.
III. Entscheidungen des Gerichtes
§§ 204 ff. Die Eröffnung des Hauptverfahrens kann abgelehnt werden, z.B. weil die
Prozeßvoraussetzungen nicht gegeben sind oder eine Verurteilung unwahrscheinlich scheint. Die StA hat eine Beschwerdemöglichkeit nach § 210.
Nach §§ 153 ff, 205 kann das Verfahren (vorläufig) eingestellt werden.
Vor allem kann aber nach §§ 203, 207 auch ein Eröffnungsbeschluß ergehen, wenn
hinreichender Verdacht vorliegt, also eine Verurteilung als wahrscheinlich erscheint.
Nach § 207 II kann die Abklage auch geändert zugelassen werden. Aber: Dabei darf nicht das Akkusationsprinzip ausgehebelt werden, also nicht etwa Anklage einer völlig neuen Tat oder eines anderen Beschuldigten.
Ab Eröffnung ist die konkrete prozessuale · Tat rechtshängig, so daß ein Verfahrenshindernis für weitere Prozesse besteht.
Hauptverfahren
I. Prozeßvoraussetzungen
Sie sind in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen. Fehlen sie, ist nach § 228 zu
unterbrechenoder nach § 205 analog vorläufig einzustellen wenn bloß vorübergehendes
Fehlen vorliegt, ansonsten nach §§ 206 a (durch Beschluß - außerhalb der HV) oder 260 III (dann durch Prozeßurteil innerhalb der HV) einzustellen.
II. Im Einzelnen
1. Gerichtsbezogene Prozeßvoraussetzungen
a) Deutsche Gerichtsbarkeit
§§ 18-20 GVG
b) Rechtsweg
13 GVG
c) Zuständigkeit
Ebenfalls GVG, §§ 269, 270, wenn sich die Zuständigkeit während des Prozesses ändert. Lies die §§ 209, 225, 269 f. zur Frage, was das Gericht tun kann, um fehlende Zuständigkeiten zu bereinigen.
Ganz wichtiges Problem der Zuständigkeit (und interessant für die Revision!): Auch die im Instanzenzug nachfolgenden Gerichte dürfen keine Strafe verhängen, welche die Rechtsfolgenkompetenz der ersten Instanz übersteigt (· K/M § 24 GVG/9)
2. Täterbezogene Prozeßvoraussetzungen
a) keine Immunität
Zum Beispiel aus dem GG
b) Strafmündigkeit
Keine Kinder unter 14 Jahren, § 19 StGB
c) Verhandlungsfähigkeit
Hier kommt es letztlich auf die natürliche Verstandes- und Einsichtsfähigkeit an, genau Def. K/M Einl/97.
d) Kleinigkeiten, aber wichtige
Der Angeklagte muß leben; es darf keine Strafverfolgungsverjährung eingetreten sein, §§ 78 ff. StGB; keine anderweitige Rechtshängigkeit, § 203 - ne bis in idem
3. Tatbezogene Prozeßvoraussetzungen
a) Strafantrag, beh ö rdliche Ermächtigung, ö ffentliches Interesse
Bei manchen Delikten muß eben ein Strafantrag gestellt werden. Das kann z.T. durch die
Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses (nicht verwechseln mit dem öffentlichen Interesse bei den Privatklagedelikten) ersetzt werden. Dieses hat die Staatsanwaltschaft offenbar bejaht, wenn die StA bei einem relativen Antragsdelikt trotz Fehlen des Antrages Anklage erhebt.
Die Voraussetzungen für den Strafantrag finden sich in §§ 77 ff StGB.
b) wirksamer Er ö ffnungsbeschluß
Dieser ist Prozeßvoraussetzung, wir erinnern uns, er schlißt das Zwischenverfahren ab, in dem das Gericht eine Kontrolle der StA vornimmt. Umstritten ist, ob man den fehlendenEröffnungsbeschluß nachholen kann.
Lit: nein, denn dies ist eine rechtstaatliche Sicherung
BGH: ja, denn Belange des Beschuldigten werden nicht berührt, die Kontrolle der StA kann auch jetzt noch effektiv erfolgen
Beim bloß fehlerhaften Beschluß kommt es darauf an, wie schwer der Mangel wiegt.
c) wirksame Anklage
Nach § 200. Eine wirksame Anklage ist auch die Nachtragsanklage nach § 266.
d) keine Amnestie, keine Verjährung
Die Verjährung nicht vergessen! Soweit der Sachverhalt länger als 3 Jahre (=kürzeste
Verjährungsfrist) zurückliegt, immer daran denken. Erst recht, wenn sich aus dem Sachverhalt irgendwelche Umstände ergeben, welche nach § 78c StGB eine Unterbrechung der Verjährung herbeiführen würden.
e) keine entgegenstehende Rechtskraft, ne bis in idem
Die Sache darf nicht schon Gegenstand eines anderen Verfahrens gewesen sein, sie muß "unberührt" sein.
4. keine Verwirkung des staatlichen Strafanspruches
Hier ist z.B. die Tätigkeit des agent provocateur zu diskutieren. Umstritten ist, ob bei Tatprovokation durch diesen der Staat seinen Strafanspruch verwirkt.
Lit: wenn bisher unbescholtene (!) Menschen erst verführt werden, ist der Anspruch verwirkt, Argumente aus § 136a (Beeinflussung) und venire contra factum proprium BGH: die rechtsstaatswidrige (!!) Provokation ist bloß ein Milderungsgrund. Der staatliche Strafanspruch darf nicht in der Disposition des Lockspitzels stehen
Weiterhin kann man hierunter die Fälle überlanger Verfahrensdauer oder völkerrechtswidriger Entführung fassen.
II. Vorbereitung der Hauptverhandlung, §§ 213 ff.
einfach mal Durchlesen, es geht da vor allem um terminliche Sachen, Ladungen usw. III. Ablauf der Hauptverhandlung, Allg., §§ 243 ff.
Auch hier kann man sich alles erst einmal durchlesen, es steht fast alles im Gesetz. Grundsätzlich:
- Aufruf der Sache, Präsenzfeststellung
- Vernahme zur Person
- Verlesung des Anklagesatzes
- Vernehmung zur Sache
- Beweisaufnahme
- Plädoyers und letztes Wort
- Beratung und Abstimmung des Gerichtes
- Urteilsverkündung und Rechtsmittelbelehrung
Bei der Vernehmung zur Person, § 243 II ist zu beachten, daß diese noch allein der Feststellung der Identität des Angeklagten dient. Jede weitere Frage zu persönlichen Verhältnissen gehört zur Vernehmung zur Sache.
Ob Fehler im Ablauf des Verfahrens die Revision begründen, ist immer nicht so einfach zu beantworten. Eine Gesetzesverletzung stellen sie schon dar, da die Reihenfolge vorgegeben ist. Aber beruht das Urteil darauf?
Bei der Beweisaufnahme lassen sich ganz leicht Probleme des Ermittlungsverfahrens (rechtmäßige Beweisgewinnung) einbauen. Hier wird also häufig ein Klausureinstieg zu finden sein.
Ablauf der Hauptverhandlung
I. Aufruf der Sache, § 243 I 1
Damit beginnt die Verhandlung und auch die Anwesenheitspflicht der Beteiligten.
II. Feststellung der Präsenz, § 243 I 2
- Anwesenheit der Beteiligten
Ist z.B. der Angeklagte trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen, prüft der Richter zunächst, ob auch ohne ihn verhandelt werden kann (§§ 230 ff.) und führt ggf. einen entsprechenden Beschluß herbei.
Geht das nicht, kann er Vorführung oder Haft veranlassen.
Beschluß
1. Die Hauptverhandlung wird ausgesetzt
2. Neuer Termin zur Hauptverhandlung wird bestimmt auf ...
3. Zu diesem Termin soll der Angeklagte durch die Polizei vorgeführt werden
Vorführungsbefehl (an die Polizei)
Der (...) ist dem AG (...) zur Hauptverhandlung am (...), Sitzungssaal 20 vorzuführen.
Er ist angeklagt, am 5. März in die Gaststätte Blauer Bock in Stedlingshausen eingebrochen zu sein und dort einen Zigarettenautomaten aufgebrochen; Bargeld und Zigaretten entwendet zu haben, strafbar als Diebstahl nach §§ 242, 243 StGB.
Die Vorführung wurde angeordnet, da der Angeklagte zur Hauptverhandlung am (...) trotz ordnungsgem äß er Ladung nicht erschienen ist.
Für nicht erschienen Zeugen gilt § 51, ihm sind zwangsweise die entstandenen Kosten aufzuerlegen, dazu ein Ordnungsgeld, ersatzweise Ordnungshaft.
III. Mitteilung der Besetzung, § 222a
Das ist allerdings nur für den ersten Rechtszug vor dem LG oder OLG wichtig.
IV. Ausschluß und Ablehnung von Richter, StA und Verteidigern IV. Richter
1. Ausschluß und Ablehnung, §§ 22 ff.
Da wären die gesetzlichen Ausschlußgründe der §§ 22, 23. Selbst betroffen von der Straftat ist übrigens nicht der Gesellschafter einer JP, der BGB verwendet einen unmittelbaren Betroffenenbegriff. Aber natürlich kann ein solcher Gesellschafter zumindest befangen i.S. des § 24 sein.
In § 22 Nr. 4 ist der Begriff der "Sache" weit auszulegen, das kann auch eine Vorfrage
gewesen sein, aber es soll hat jeder Eindruck der Parteilichkeit vermieden werden. Das beißt sich zwar mit der BGH-Ansicht zu Nr.1, aber wir sind ja auch in der StPO, wo Logik nichts zu suchen hat.
Ob Befangenheit vorliegt, bestimmt sich aus der Sicht des Angeklagten, aus naheliegenden Gründen aus der eines verobjektivierten, es müßte also ein objektiver Beobachter in der Rolle des Angeklagten berechtigte Zweifel an der Unvoreingenommenheit haben dürfen. Umstritten ist, ob die von § 23 nicht umfaßten Fälle der Mitwirkung in einem früheren Verfahren von § 24 umfaßt werden. Der BGH hat hier allerdings unendliches Vertrauen in den Charakter der Richter und die Unabhängigkeit der Justiz.
IV. Verhandlungsleitung durch den Vorsitzenden, § 238
Die frühere - und im Gesetz wohl eigentlich vorgesehene - Unterscheidung zwischen Sachund Verhandlungsleitung trifft man heute nicht mehr. Das hat zur Konsequenz, daß der Zwischenrechtsbehelf des § 238 II für alle Maßnahmen des Vorsitzenden gilt, obwohl ausdrücklich nur von der -Verhandlungsleitung die Rede ist.
Die Beschwerde ist ausgeschlossen, § 305, es kann aber die Revision Erfolg haben. Sie ist aber verwirkt, wenn nicht die Möglichkeit des § 238 II genutzt wurde.
Zu den Fragerechten liest man §§ 240 ff und denkt an die Vorschriften über unzulässige Fragen in den §§ 68 ff. (Für Zeugen). Nach § 257 haben alle Beteiligten ein Erklärungsrecht. Nach § 265 trifft den Vorsitzenden eine Hinweispflichtbei der Veränderung eines rechtlichen Gesichtspunktes.
§ 228 ff. zur Aussetzung und Unterbrechung. Beachte die feinen terminologischen
Unterschiede (lesen!).
Zu bedenken ist noch, daß einige (schwerwiegende) Entscheidungen nicht durch den Vorsitzenden getroffen werden können, sondern einen Gerichtsbeschluß erfordern. (Ablehnung von Beweiserhebungen, Ausschluß der Öffentlichkeit, Aussetzung und Unterbrechung usw.)
VI. Öffentlichkeit
Naja, der Ausschluß ist eben nur nach §§ 171a GVG möglich. Nach § 48 I JGG ist die
Öffentlichkeit immer ausgeschlossen. Einzelne Personen können nach §§ 175, 177 GVG ausgeschlossen werden.
VII. Mündlichkeit
Nur was in der mündlichen Verhandlung vorgebracht wurde darf zum Gegenstand des Urteil gemacht werden. Daraus läßt sich ableiten, daß die Schöffen keine Kenntnis von den Verfahrensakten haben dürfen, denn diese sind nicht Gegenstand der mündlichen Verhandlung. Den Berufsrichtern traut man zu, sich vom Akteninhalt nicht beeinflussen zu lassen.
VIII. Beweisaufnahme
1. Streng- und Freibeweis
Diese Unterscheidung gibt es auch hier. Das Freibeweisverfahren dient dabei der Klärung prozessualer Fragen, wie z.B. der Voraussetzungen von Beweisverwertungs- oder Vereidigungsverboten.
Darüber hinaus aber auch hinsichtlich von Tatsachen, die für andere gerichtliche Entscheidungen als Urteile (also vor allem Beschlüsse) relevant sind.
- in dubio pro reo zur Frage, ob bei den Voraussetzungen eines Beweisverwertungsverbotes dieser Grundsatz gilt (nämlich nein).
2. Allg. Grundsätze der Beweisaufnahme
Offenkundige (also entweder allgemeinkundige oder gerichtskundige) Tatsachen müssen nicht beweisen werden.
Unterschieden wird zwischen Haupttatsachen, Indiztatsachen (solche, die den Schluß auf eine Haupttatsache zulassen) und Hilfstatsachen (z.B. zur Glaubwürdigkeit eines Zeugen).
3. Grundlagen der Beweisaufnahme
a) Zunächst erfolgt die Beweisaufnahme nach § 244 II von Amts wegen.
Darüberhinaus besteht aber ein Recht der Verfahrensbeteiligten auf die Stellung von
Beweisanträgen. Das Gericht ist zu deren Bescheidung verpflichtet, §§ 244 III-VI, 245 f.
Nach § 246 darf ein Beweisantrag nicht mit der Begründung abgelehnt werden, er sei zu spät gestellt. Beweisanträge können bis zum Beginn der Urteilsbegründung gestellt werden.
b) Beweisantrag ist das ernsthafte Verlangen, eines Prozeßbeteiligten, daß über eine bestimmte Tatsachenbehauptung durch ein bestimmtes, nach der StPO zulässiges Beweismittel Beweis erhoben wird.
- K/M § 244/18
Hinsichtlich des bestimmtes Beweismittels soll ausreichen, daß ein Zeuge ohne ladungsfähige Anschrift benannt wird - jedenfalls, wenn diese vom Gericht ermittelt werden kann.
Beachte, daß es für die Aufnahme präsenter Beweismittel nach § 245 I gerade keines
Beweisantrages bedarf. Anders aber, wenn nach Abs. II die Beweismittel vom StA oder dem Angeklagten vorgeladen wurden. Hier braucht man wieder einen Antrag mit allen Erfordernissen.
c) Beweisermittlungsantrag ist das einfache Begehren des Antragstellers an das Gericht, in bestimmter Weise ermittelnd tätig zu werden, der eben nicht obige Kriterien erfüllt Da eben gerade kein Beweisantrag vorliegt, ist das Gericht auch nicht an die Ablehnungsgründe gebunden, die sich aus §§ 244 III ff. ergeben, vielmehr gilt § 244 II Es bedarf auch keines Beschlusses.
d) Nach § 244 VI bedarf die Ablehnung eines Beweismittels eines Gerichtsbeschlusses. Die Ablehnung muß auf einen der Gründe der §§ 244 III ff. gestützt werden. § 245 behandelt
dabei die Ablehnung präsenter Beweismittel, während § 244 sich den nicht präsenten
Beweismitteln, also denen, die erst herbeigeschafft werden müssen, zuwendet.
Einzelheiten sind dem Kommentar zu entnehmen. Allerdings steht dort nicht viel zur Prozeßverschleppung. Diese hat drei Voraussetzungen
aus der Beweisaufnahme kann nach Überzeugung des Gerichtes nichts sachdienliches erbracht werden das Verfahren würde erheblich verzögert werden der Antragsteller bezweckt allein dies
4. Arten der Beweismittel
a) Zeugen, §§ 48 ff. · K/M vor § 48
aa) Zeuge kann nicht sein, wer durch eine andere Verfahrensrolle als Zeuge ausgeschlossen ist. Umstritten ist nun aber, welche Rollen genau sich nicht mit der Zeugenrolle vertragen. Insb. ist es beim Beschuldigten und Mitbeschuldigten an sich der Fall, aber strittig, wenn die Verfahren getrennt oder abgetrennt werlaufen. Nach der RS ist auf eine rein formale Betrachtungsweise abzustellen. Handelt es sich um getrennte Verfahren, kann er Zeuge sein.
Zeuge können i.Ü. auch der Verteidiger, der Richter (dann aber Ausschluß vom Verfahren nach § 22 Nr. 5) und der StA sein. Letzterer kann dann auch weiter an der Sitzung teilnehmen. Zwar muß er dann im Plädoyer seine eigene Aussage würdigen ...
Auch hierübrigens gute Kommentierung im K/M vor § 48
bb) Für die Ladung § 48, normalerweise formlos, außer in bestimmten Fällen, die weit übers Gesetz verstreut sind.
cc) der Zeuge hat Pflichten, und zwar drei: Er muß kommen, reden und schwören. Das steht in den §§ 48 ff.
dd) Bei der Zeugenvernehmung sind sie zu belehren, §§ 57f., dann erst zur Person, sodann zur Sache zu vernehmen. Jeder Zeuge darf einen Rechtsbeistand zuziehen (folgt aus dem fair- trial-Prinzip)
ee) Es können Zeugnisverweigerungsrechte bestehen. Dazu sollte man sich einmal § 52
durchlesen. Problematisch ist auch hier immer der Grenzfall:
Die V ist die Verlobte des Verdächtigen T. Gegenüber einem in ihrer Umgebung agierenden V-Mann tätigt sie spontan den T belastende Ä ußerungen. Im Prozeßberuft sie sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Kann nun eine Aussage des V-Mannes veerwertet werden?
Dem k ö nnte § 252 entgegenstehen, der auf alle m ö glichen Fälle angewandt wird. So darf nicht das Zeugnisverweigungsrecht einer Person durch eine nichtrichterliche Vernehmung umgangen werden.
Hier aber handelte es sich gar nicht um eine Vernehmung. Die Aussage war spontan und ohne Wissen, daßder V Vertrauensmann der Polizei war. Trotzdem m üß te § 252 dann eingreifen, wenn der V-Mann extra eingesetzt wurde, um Aussagen der V zu bekommen, da dann eine Umgehung des § 52 vorlag. Ob eine solche Situation vorliegt, mußim Einzelfall beurteilt werden.
Dem liegt der Gedanke zugrunde, daßder Berechtigte nun dann vor sich selbst geschützt werden muß, wenn gezielt geschützte Positionen ausgehebelt werden sollen.
Das Zeugnisverweigerungsrecht kann auch erlöschen.
A und B sind angeklagt. A stirbt, gegen B geht das Verfahren weiter. As Witwe soll
vernommen werden. Sie hat kein Verweigerungsrecht mehr, vorher hätte auch gegenüber B eines bestanden, da gegen A und B gemeinsam ermittelt wurde.
Die in §§ 53, 53a genannten bedürfen keiner Belehrung, da sie idR. über ihren Beruf Bescheid wissen. Wird gegen §§ 53, 54 verstoßen, sind die Aussagen uneingeschränkt verwertbar.
ff) Weiterhin gibt es noch ein Auskunftverweigerungsrecht nach § 55, wenn die
Beantwortung einzelner Fragen den Zeugen in die Gefahr der Strafverfolgung bringt.
Auch bei einem Verstoß hiergegen ist aber die Aussage verwertbar - denn nicht der Schutz des Angeklagten ist bezweckt (Rechtskreistheorie).
b) Sachverständige, §§ 72 ff.
aa) Abzugrenzen ist der Sachverständige vom Zeugen und sachverständigen Zeugen.
Letztere sind nicht vom Gericht beauftragt und auch nicht auswechselbar. Wichtig ist die Abgrenzung, weil beim Zeugen ja bestimmte Förmlichkeiten einzuhalten sind (Belehrung, Vereidigung usw.), die ggf. die Revision begründen können.
bb) Wie der Richter kann auch der Sachverständige abgelehnt werden, § 74.
c) Urkunden, §§ 249 ff.
Wichtig ist vor allem der Unterschied zu anderen Urkundebegriffen. I.S. der StPO ist Urkunde jedes verlesbare Schriftstück.
Interessant sind noch die Fälle, in denen die Einführung einer Urkunde in die Verhandlung
unzulässig ist, etwa bei der Verlesung eines intimen Tagebuches (wobei hier eines Abwägung erfolgen muß).
d) Augenschein, §§ 86 ff. Alles mögliche.
5. Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme
Zum einen muß die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht erfolgen, zum anderen gilt eben der Vorrang des originären Beweismittels, dessen Ausprägung § 250 ist. Aber Achtung: § 250 verbietet z.B. nicht die Vernehmung eines Zeugen vom Hörensagen.
Die ganzen Ausnahmen dazu finden sich dann in den ff. §§. Beachte, daß der weite § 251 I nur für die richterlichen Protokolle, der engere § 251 II für die sonstigen Protokolle gilt. Umstritten ist § 252, unklar nämlich ist, ob sich auch ein allgemeines Beweisverwertungsverbot, z.B. durch Vernehmung der Verhörsperson herleiten läßt.
Der Sohn S des Angeschuldigten hatte im Vorverfahren ausgesagt, beruft sich in der Hauptverhandlung aber auf sein Aussageverweigerungsrecht.
Das Protokoll der Einvernahme darf wegen § 252 nicht verlesen werden.
Man könnte aber den verhörenden Polizisten als Zeugen vom Hörensagen hören.
§ 205 und der Unmitelbarkeitsgrundsatz stehen dem nicht entgegen, es gibt kein "Recht auf
das tatnächste Beweismittel".
Anders ist es mit § 252. Teile der Lit. wollen hier ein umfassendes Verwertungsverbot
herleiten. Die RS will unter bestimmten Voraussetzungen, die im Kommentar stehen, die Aussage dann verwerten, wenn die Aussage im Vorverfahren bei einer richterlichen Vernehmung gemacht wurde.
Lies auch sonst mal die §§ 250 ff. Der allgemeine Vorhalt aus alten Protokolle ist nach der RS zulässig.
6. Sonderprobleme bei Ermittlungsgehilfen
Informanten und V-Leute werden einfach als Zeugen behandelt. Schwierigen ist es bei
verdeckten Ermittlern, § 110. Deren Identität soll oft geheimgehalten werden.
Hier gilt dann §§ 110 b III 3 i.V.m. § 96. Nach HM soll (allein!) § 96 auch auf Informanten und V-Leute analog Anwendung finden. Das betraf jetzt die Entscheidung der Behörde. Der Vorsitzende entscheidet dann nach § 68. Der Zeuge wird dann unerreichbar sein i.s.d. § 244 III. Nach § 223 kann der Zeuge evtl. kommisarisch vernommen werden und das Protokoll nach § 251 verlesen. Dann müssen aber wieder Verteidiger und Angeklagter anwesend sein. Also kann man zur Not den Zeugen auch ganz sperren. Nach § 251 dürfen dann Beweissurrogate benutzt werden.
7. Beweiserhebungs- und -vewertungsverbot
a) Grundlegendes
Auch im Rahmen der Untersuchungspflicht sind Grundrechte der Verfahrensbeteiligten zu beachten. Man unterscheidet Beweiserhebungsverbote (keine Untersuchung entgegen § 81, keine verbotenen Vernehmungsmethoden nach § 136a usw.) sowie
Beweisverwertungsverbote(Was mache ich nun mit dem doch erlangten Beweis? Der Verstoß gegen ein Beweisverwertungsverbot wird regelmäßig die Revision begründen).
b) Gesetzliche Beweisverwertungsverbote
Da gibt es ein paar, §§ 81 c III, 100 b V, 100 d II, 100 e, 136a III. Insb. letzterer ist
interessant. Die Aufzählung der verbotenen Methoden ist nicht erschöpfend, auch z.B. ein Lügendetektor fällt darunter, denn
Entscheidend ist, ob ein Mittel auf die freie Willensentschließung des Beschuldigten einwirkt
Interessant ist auch Drohung oder Täuschung. Jedenfalls nämlich ist die kriminalistische List zulässig.
Äußerungen, die von nicht beauftragten (!) Privatpersonen erlangt wurden, sind verwertbar, es sei denn, es liege ein besonders krasser Verstoß gegen die Menschenrechte vor; § 136a gilt eben nicht für Private.
c) nicht gesetzlich geregelten Beweisverwertungsverbote
Nicht jeder Verstoß gegen gesetzliche Regelungen führt zwangsläufig zu einem
Verwertungsverbot. Ggf. aber können sogar ordnungsgemäß erlangte Beweise unverwertbar sein.
Manche wollen das vom Schutzzweck der Norm abhängig machen, manche wollen
zwischen dem Strafverfolgungsinteresse des Staates und den Grundrechten des Verletzten abwägen. Der BGH verfolgt - zumindest, was Belehrungspflichten angeht - die Rechtskreistheorie, untersucht also, wessen Schutz die verletzte Norm bezweckte.
aa) Fehlen der Zeugenbelehrung nach § 52 bei Angehörigen
Beweisverwertungsverbot vom Schutzzweck her - Erhalt des Familienfriedens. Nicht aber, wenn der Zeuge auch so ausgesagt hätte oder seine Rechte kannte.
bb) Aussage von nach §§ 53, 53a Verweigeungsberechtigten
ohne fehlende Befreiung natürlich. RS: Zwar ist dann § 203 StGB einschlägig, aber das ist sein Bier.
cc) Aussage mit fehlender Genehmigung, § 54
Es kann verwertet werden. § 54 will Geheimnisse schützen. Ist es dann aber erst mal offenbart, kann man es dann auch verwerten, es gibt nichts mehr geheimzuhalten.
dd) Fehlen der Belehrung nach § 55 II - Selbstbelastung des Z.
Verwertung (+), die Vorschrift betrifft nicht den Rechtskreis des Angeklagten.
ee) Fehlen der Beschuldigtenbelehrung nach § 136 I 2
War lange Zeit umstritten, der BGH sah § 136 als bloße Ordnungsvorschrift. Das ist aber Quark, es ist ein fundamentales Recht des Beschuldigten, sich nicht selbst zu belasten. Es gibt wieder Ausnahmen, die bei · K/M § 136/20 stehen, z.B. der Beschuldigten hat nicht
z.Z. des § 257 gerügt usw.
Wird die Belehrung absichtlich unterlassen, ist dies wohl Täuschung i.S. des § 136a, wonach ein ges. Verwertungsverbot besteht.
ff) Fehlen der Belehrung nach § 243 IV 1
Auch dies ist ein fundamentales Recht des Angeklagten. Verbot (+)
gg) Verwehrung der Verteidigerbefragung, §§ 136, 137 Verbot (+), faires Strafverfahren
hh) Beweisverwertungsverbot aus § 252
Nur eingeschränktes Verbot, die Vernehmung der Verhörsperson selbst soll dann zulässig
sein, wenn diese der Ermittlungsrichter war. § 252 wird nicht analog auf § 55 angewandt, da dieser gerade von einem Auskunftsverweigerungsrecht spricht, § 252 aber von einem Zeugnisverweigerungsrecht.
ii) Verstoßgegen Beschlagnahmeverbote, § 97 I Verbot (+), sonst wäre das wenig effektiv
kk) Telefonüberwachung, §§ 100 a ff.
Fehlte es schon an den materiellen Voraussetzungen (Katalogstraftat usw.) verbot (+), fehlte es bloß an formellen (Schriftform usw.) wohl (-)
ll) Verst öß e bei körp. Untersuchungen, § 81a
Unterscheiden, ob versehentlich oder bewußt verstoßen wurde. Bei versehentlichen Verstößen Verbot (-), denn es soll vor gesundheitlichen Schäden geschützt werden, das aber läßt sich durch Beweisverwertungsverbote nachträglich nicht mehr erreichen. Bei bewußtem Verstoß liegt aber kein faires Verfahren mehr vor, (+)
mm) Verletzung der Intimsphäre
Bei vielen denkbaren Verletzungen existiert eine Regelung in den §§ 100c, d. Gar nicht ganz einfach ist immer zu entscheiden, ob ein Verstoß immer ein Verwertungsverbot nach sich zieht, jedenfalls aber bei einem bewußten Verstoß.
Interessant sind die Tagebuchaufzeichnungen. Es erfolgt eine Abwägung des
Persönlichkeitsrechtes des Verfassers gegen den staatlichen Strafverfolgungsanspruch. Also Stufenprüfung:
- Völlig verwertbar sind Aufzeichnungen, in denen bloß äußere Abläufe beschrieben werden
- "normale Intimsphäre", Abwägung
- Absolut geschützter Kernbereich. Hier keine Abwägung und keine Verwertung
d) Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten
Umstritten ist, ob es so etwas wie die "fruit of the poisenous tree"-Doktrin auch im dt. Strafprozeß gibt. Roxin sagt ja, der BGH nein, denn ein Vertoß solle nicht die gesamte Verhandlung lahmlegen, zudem diene in den USA die Doktrin der Disziplinierung der Polizei, was in Dtl. das Beamtenrecht mache.
8. Schluß der Beweisaufnahme
Vorsitzdende fragt nach Anträgen. Auch später aber sind noch welche möglich, es gibt keine Präklusion
9. Grundsatz "in dubio pro reo"
Nach § 261 entscheidet das Gericht nach freier Beweiswürdigung. Das Maß an Sicherheit muß nach der Lebenserfahrung so ausreichend sein, daß vernünftige Zweifel nicht mehr aufkommen.
Bestehen Zweifel, gilt in dubio pro reo. Aber: Dies gilt nur bei Zweifeln, die der Richter
gehabt hat, nicht bei solchen, die er aus Angeklagtensicht haben sollte. Ohne Anhaltspunkte muß der Richter nicht von der für den Angeklagten günstigsten Konstellation ausgehen. Problematisch ist der in dubio Grundsatz bei Prozeßvoraussetzungen und sonstigen verfahrensrechtlich erheblichen Tatsachen.
Hier gibt es umfangreiche Kasuistik, also im Kommentar nachschauen. Jedefalls aber gilt der Grundsatz nicht bei sonstigen Verfahrensfehlern (siehe oben)
10. auch Wichtiges
Und nicht vergessen, auch die Verlesund etwaiger Strafanträge, der BZR-Auszüge und
anderer Urteile ist ein Teil der Beweisaufnahme; natürlich darf man auch nie irgendwelche verkehrstechnischen Gutachten oder BAK-Protokolle vergessen. Diese dürfen nach § 256 verlesen werden.
X. Schlußvorträge
1. Der StA
Er plädiert hat, zum Aufbau unten
2. Besondere Verfahrensarten
Im Privatklageverfahren hält der Privatkläger bzw. dessen Vertreter den Schlußvortrag, im Nebenklageverfahren tut er das nach dem StA.
3. der Verteidiger
Er kann, muß aber keinen Schlußvortrag halten
4. Schlußwort des Angeklagten
Nach § 258 III hat er das letzte Wort, nach § 67 I JGG auch die Eltern. XI. Protokoll über die Hauptverhandlung, §§ 271 ff.
Ganz wichtig wegen § 274, das Protokoll ist das einzige Beweismittel hinsichtlich des Verlaufes der Verhandlung. Es hat sowohl positive (was drinsteht, ist passiert), als auch negative (was nicht drinsteht, war nicht) Beweiskraft.
Hat das Protokoll aber offensichtliche Lücken, so soll es insoweit keine negative Beweiskraft entfallen.
XII. Urteil
1. Beratung
Nach § 263 ist eine Mehrheit von 2/3 für die für den Angeklagten nachteilige Entscheidung über die Schuldfrage und die Folgen der Tat erforderlich. Ansonsten reicht nach § 195 GVG eine einfache Mehrheit.
2. Inhalt des Urteils (ganz grob)
a) Oben kommt das Rubrum mit der Wendung "im Namen des Volkes", dann die ganzen Personalien
b) Dann der Tenor, § 260, nach § 464 II auch mit Entscheidungen über die Kosten usw.
c) die Urteilsgründe, die wiederum 6 Elemente enthalten: Alle subsumtionserheblichen Tatsachen, die Beweisgründe, die verwandten Vorschriften, die Gründe für die Strafzumessung, die Begründung der Kostenentscheidung.
3. Verkündung
Nach § 268 II 1 in der mündl. Verhandlung.
4. Wirkungen, Rechtskraft
Es gibt wieder die formelle und materielle Rechtskraft. Für die materielle Rechtskraft ist wieder der strafprozessuale Tatbegriff maßgebend. Wirkungen:
- Strafklageverbrauch (ne bis in idem) wegen dieser Tat. Probleme wirft das immer bei fortgesetzten Taten und Dauerstraftaten.
Da es nun materiell keine fortgesetzten Taten mehr gibt, ist wohl davon auszugehen, daß auch prozessual solche Begehungsweisen keine einheitliche prozessuale Tat mehr darstellen. _ Vollstreckungswirkung, das kann nun getan werden
- Es kann auch Teilrechtskraft geben, wenn ein Urteil nur z.T., z.B. zur Strafhöhe, mit Rechtsmitteln angegriffen wird
Auch fehlerhafte Urteile entfalten Rechtskraft, nicht aber nichtige, also solche mit besonders schweren Fehlern.
Besondere Verfahrensarten
I Strafbefehlsverfahren, §§ 407-.412
Statt nach § 170 Klage zu erheben, kann sich die StA auch entschließen, Antrag auf Strafbefehl zu stellen. Die Voraussetzungen stehen im § 407.
Dem Antrag kann stattgegeben werden, wenn der Angeklagte hinreichend verdächtig ist. Da es sich um ein summarisches Verfahren handelt, muß das Gericht eben nicht von der Schuld des Täters überzeugt sein.
Rechtsbehelf ist der Einspruch. Wird er eingelegt übernimmt der Strafbefehl die Wirkung des Eröffnungsbeschlusses, § 411 I 2. Interessant ist wohl noch, was geschieht, wenn
Einspruch eingelegt wird, der Angeklagte aber nicht erscheint, §§ 411, 412. Dann nämlich
wird wohl (genauer kundig machen) eine Urteil erlassen, gegen das Widereinsetzung in den vorherigen Stand ebenso möglich ist, wie Berufung und Revision.
Da aber der Widereinsetzungsantrag die Rechtsmittelfristen nicht hemmt, muß der kluge Anwalt beides einlegen (Anwaltsklausur!)
II. beschleunigtes Verfahren; §§ 417 ff.
Durchlesen. Hauptsächlich entfällt das Zwischenverfahren, es gibt auch einige sonstige Änderungen am StPO-Verfahren.
III. Privatklage, §§ 374 - 394
Hier übernimmt im Prinzip eine Privatperson die Rolle des StA. Zusätzlich zu den
allgemeinen Prozeßvoraussetzungen müssen die Voraussetzungen des §§ 374 ff. gegeben sein.
Es muß also zunächst ein Privatklagedelikt gegeben sein, § 374. Hier erhebt nach § 376 sie StA nur bei öffentlichem Interesse Anklage, dann, wenn der Rechtsfrieden über den lebeskreis des Verletzen hinaus gestört wurde, Nr. 86 RistBV.
Meist sind das Abntragsdelikte. Der Strafantrag soll aber in der Erhebung der Klage gesehen werden können.
Nach § 380 wird bei manchen Delikten als Klage- nicht aber Prozeßvoraussetzung ein Sühneversuchgefordert.
IV. Nebenklage, §§ 395 - 402
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Leitsatz I?
Leitsatz I lautet: Wirst du des Lebens nicht mehr froh, stürz` dich in StPO (Betonung auf dem "t") Thomas
Was ist der Leitsatz II?
Leitsatz II lautet: StPO sucks unbekannter Dichter
Was ist der Leitsatz III?
Leitsatz III lautet: Vor StPO hab` ich Schiß Arne
Wie läuft das Strafverfahren im Überblick ab?
In der ersten Instanz gibt es drei große Abschnitte: das Ermittlungsverfahren (§§ 151-177), das Zwischenverfahren (§§ 199-212b) und das Hauptverfahren (§§ 213-295).
Welche Maximen prägen das Strafverfahren?
Das Strafverfahren wird durch das Offizialprinzip, das Akkusationsprinzip, das Legalitätsprinzip, den Untersuchungsgrundsatz, das Beschleunigungsgebot, die freie richterliche Beweiswürdigung (§ 261), Mündlichkeit und Unmittelbarkeit (§§ 226, 250, 261), Öffentlichkeit (§ 169 GVG) und in dubio pro reo geprägt.
Was ist die Abschlußverfügung der StA?
Die Abschlußverfügung der StA ist der Vermerk in den Akten, der die Akteneinsicht des Verteidigers ermöglicht. Die StA muss am Ende des Ermittlungsverfahrens entscheiden, ob Anklage erhoben wird oder das Verfahren eingestellt wird. Wenn eingestellt wird muss die StA dies vermerken.
Was ist die prozessuale Bedeutung der Abschlußverfügung?
Sie ist die Grundlage für das Recht auf Akteneinsicht des Verteidigers.
Was bedeutet Abtrennung des Verfahrens?
Die Abtrennung des Verfahrens bedeutet, dass das Verfahren gegen einen oder mehrere Angeklagte von dem Verfahren gegen andere Angeklagte getrennt wird.
Was sind die Konsequenzen des Erscheinens oder Nichterscheinens des Angeklagten zur Hauptverhandlung?
Grundsätzlich muss der Angeklagte zur Hauptverhandlung erscheinen (§ 230). Es gibt aber Ausnahmen, in denen auch ohne ihn verhandelt werden kann (§§ 231 ff., 247).
Welche Punkte sollte eine Anklageschrift umfassen?
Die Anklageschrift umfasst den Kopf (absendende StA, AZ, Ort u. Datum, ggf. Haftaufkleber), den Anklagesatz (Darlegung des Sachverhalts und der Beschuldigung) und das wesentliche Ergebnis der Ermittlungen (Beweissituation, Vorgeschichte der Tat, etc.).
Welche Rechte hat der Verteidiger bezüglich Akteneinsicht?
Der Verteidiger kann nach § 147 Akteneinsicht verlangen.
Wer muss in der Hauptverhandlung anwesend sein?
Nach § 226 müssen die zur Urteilsfindung berufenen Personen immer anwesend sein. Die Staatsanwaltschaft muss ununterbrochen anwesend sein, nicht jedoch immer derselbe StA. Der Verteidiger ist nur in den Fällen der notwendigen Verteidigung erforderlich (§ 140).
Wie definiert man den Begriff des Beschuldigten?
Beschuldigter ist, wer durch einen Willensakt der Strafverfolgungsbehörde oder durch hinreichend konkreten Anfangsverdacht subjektiv zum Ausdruck bringt, daß sie ein Strafverfahren gegen eine bestimmte Person als Beschuldigten betreiben will.
Welche Rechte und Pflichten hat ein Beschuldigter?
Er hat das Recht auf Anwesenheit bei richterlichen Vernehmungen von Zeugen und Sachverständigen (§ 168 c II), Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 GG), Recht auf Verteidigung und das Recht, die Einlassung zur Sache zu verweigern (nemo tenetur). Er muss zur Vernehmung erscheinen (§ 163 III) und zulässige Zwangsmaßnahmen erdulden.
Was versteht man unter "besonderes öffentliches Interesse"?
Es ist ein "besonderes" Interesse, das bloße Interesse gibt es bei Privatklagen.
Was ist ein Beweisantrag und wie wird er behandelt?
Ein Beweisantrag (siehe § 244) erfordert bei Ablehnung einen Gerichtsbeschluss. Anträge sind bis zum Beginn der Urteilsverkündung zulässig.
Was ist bei der Einstellung des Verfahrens nach §§ 170 II, 153 ff. zu beachten?
§ 170 II ist vorrangig, da er voraussetzt, dass kein genügender Anlass zur Erhebung der Klage vorliegt. §§ 153 ff. setzen dagegen eine Straftat voraus.
Was ist ein Ermittlungsrichter?
Für bestimmte Anordnungen im Ermittlungsverfahren, die besonders tief in die Sphäre des Beschuldigten eingreifen, gilt der Richtervorbehalt.
Welche Fristen sind im Strafprozess zu beachten?
Bei Problemen mit Fristen immer K/M vor § 42 lesen.
Was ist ein Haftbefehl?
Sieht aus, wie eine kleine Anklage, natürlich zusätzlich mit Darlegung der Haftgründe.
Was bedeutet "In dubio pro reo" und wie wird es angewendet?
Es sagt nur aus, dass von mehreren, vom Tatrichter auch angenommenen Möglichkeiten die für den Angeklagten günstigste anzunehmen ist. Er greift auch dann nicht ein, wenn der Richter zwar hätte Zweifel haben können, aber eben nicht hatte.
Welche Besonderheiten gelten bei der Nebenklage?
§§ 395 ff. Auch nach ergangenem Urteil kann sich der Nebenkläger noch anschließen. Er muss dann ein Rechtsmittel einlegen. Rechtsmitttel des Nebenklägers wirken immer auch zugunsten des Angeklagten, § 401 III 1 iVm. § 301.
Wie ist ein Plädoyer im Allgemeinen aufgebaut?
Ein Plädoyer ist im Allgemeinen wie folgt aufgebaut: Anrede, Sachverhalt, Beweiswürdigung, rechtliche Würdigung, Strafzumessung, Antrag.
Welche Stellung und Befugnisse hat die Polizei?
Die Polizei muss selbst tätig werden (§§ 158, 163) und auf Weisung der StA (§ 161). Sie hat Befugnisse nach §§ 163 ff. und Notzuständigkeiten.
Was ist die Bedeutung des Protokolls für Revisionsrügen?
Der Nachweis über die Beachtung der wesentlichen Förmlichkeiten der Hauptverhandlung kann nur durch das Protokoll geführt werden.
Welche Voraussetzungen müssen für die Zulässigkeit und Begründung der Revision erfüllt sein?
Statthaftigkeit (§ 333, 335), Berechtigte, Beschwer, zuständiges Gericht, Form und Frist, wirksame Revisionsbegründung, kein Verlust des Revisionsrechtes.
Wie sieht die Revisionsbegründung aus?
§ 345 I. für die Frist, Abs. II für die Form. Fehlt es hieran, verwirft bereits das Ausgangsgerichtdie Revision durch Beschluß, § 346. Wichtig: Beachte § 299 für den (inhaftierten) Angeklagten und § 390 II für den Privatkläger. Für den Nebenkläger wird § 390 analog angewandt, also Einlegung auch durch Anwaltsschrift. Bei der StA reicht einfache Schriftform mit maschinenschriftlicher Unterschrift, wenn ein Beglaubigungsvermerk drauf ist.
Welche typischen Revisionsrügen gibt es?
Verfahrensvoraussetzungen, absolute Revisionsgründe (§ 338), relative Revisionsgründe (§ 337 I) und Sachrüge.
Wie ist der Aufbau von Klausuren zur Revision?
Erfolgsaussichten der eingelegten und begründeten Revision, Anfertigung einer Revisionsbegründung, Vorbereitung der Revisionsbegründung.
Welche Rolle spielt die Staatsanwaltschaft im Strafverfahren?
Sie muss den Sachverhalt vollständig, also auch zugunsten des Beschuldigten erforschen (§ 160 II) und entscheidet, ob Klage erhoben wird.
Welche prozessualen Tatbegriffe sind relevant?
Der durch die Anklage dem Gericht unterbreitete geschichtliche Vorgang, soweit er nach der Lebensauffassung eine Einheit bildet.
Welche Arten von Urteilen gibt es und wie sind sie aufgebaut?
Es gibt Sachurteile (§ 267) und Prozeßurteile (§ 260 III). Der Aufbau umfasst Rubrum, Tenor und Urteilsgründe.
Was ist unter Verdacht, hinreichendem Tatverdacht und dringendem Tatverdacht zu verstehen?
Die auf Tatsachen - nicht reine Vermutung - begründete Möglichkeit, daß eine Straftat vorliegt und (soweit nicht Ermittlung gegen Unbekannt), der Verdächtige an der Tat beteiligt sein kann. Hinreichender Tatverdacht, wenn eine Aburteilung wahrscheinlich ist. Dringender Tatverdacht, die große Wahrscheinlichkeit, daß der Beschuldigte Teilnehmer einer bestimmten, verfolgbaren Straftat ist.
Wer ist ein Verdeckter Ermittler und was ist bei dessen Einsatz zu beachten?
Ein ganz interessantes Problem in (· Hemmer AssBStr 6/19 ff.) war, wer eigentlich für die Erteilung der Sperrerklärung nach §§ 110 b III i.V.m. 96 zuständig ist: Denn hat der Unzuständige gehandelt, hat das Gericht wohl gegen seine Amtsermittlungspflicht aus § 244 verstoßen, wenn es nicht weitere Anstrengungen unternahm, den VE heranzuziehen. Letztlich ist das Innen-, nicht das Justizministerium zuständig. Dies folgt zum einen schon daraus, daß der VE Polizeibeamter ist, die letztliche Entscheidung über seinen Einsatz obliegt der Polizei, die StA kann nur zustimmen (§ 110 b!). Zudem dient der VE meist sowohl repressiven, als auch präventiven Zwecken, und spätestens da fällt die Justiz raus. Das Justizministerium könnte auch nur schwer die Gefährdung des VE durch eine Vernehmung einschätzen, die wissen ja gar nicht - der Einsatz liegt ja in der Hand der Polizei. Das Ganze gilt entsprechend für Informanten/V-Leute usw.
Welche Rechte hat ein Verteidiger?
Ganz wichtig ist das Kontaktrecht des § 148. Dieses zieht u.U. auch Beschlagnahmeverbote, z.B. von Mandantenpost nach sich. Der Verteidiger hat zudem ein Anwesenheitsrecht bei jeder Vernehmung durch Richter u. StA, §§ 163a, 168c. Siehe auch · Akteneinsicht.
Wann liegt ein Beweisverwertungsverbot vor?
Eine fehlerhafte Beweiserhebung l ö st nicht zwangsläufig ein Beweisverwertungsverbot aus. Vielmehr richtet sich dies nach einer umfassenden Abwägung, bei der das Gewicht des Verstoßes sowie seine Bedeutung für die rechtlich geschützte Sphäre des Betroffenen ebenso ins Gewicht fallen wie die Erwägung, daßdie Wahrheit nicht um jeden Preis erforscht werden darf.
Was sind die einzelnen Schritte im Ablauf des Strafverfahrens?
Das Strafverfahren gliedert sich in Vorverfahren, Zwischenverfahren und Hauptverfahren.
Was passiert nach Abschluß des Vorverfahrens?
Nach Abschluß des Vorverfahrens gibt es nur zwei Abschlüsse: Entweder wird Klage erhoben oder eingestellt.
Wie ist der Ablauf der Hauptverhandlung?
Aufruf der Sache, Präsenzfeststellung, Vernahme zur Person, Verlesung des Anklagesatzes, Vernehmung zur Sache, Beweisaufnahme, Plädoyers und letztes Wort, Beratung und Abstimmung des Gerichtes, Urteilsverkündung und Rechtsmittelbelehrung.
Was gilt es bei der Beweisaufnahme zu beachten?
Offenkundige Tatsachen müssen nicht bewiesen werden. Es wird zwischen Haupttatsachen, Indiztatsachen und Hilfstatsachen unterschieden. Das Gericht hat eine Aufklärungspflicht (§ 244 II).
Welche Arten von Beweismittel gibt es?
Zeugen, Sachverständige, Urkunden und Augenschein.
Was versteht man unter Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme?
Zum einen muss die Beweisaufnahme vor dem erkennenden Gericht erfolgen, zum anderen gilt eben der Vorrang des originären Beweismittels, dessen Ausprägung § 250 ist. Aber Achtung: § 250 verbietet z.B. nicht die Vernehmung eines Zeugen vom Hörensagen.
Was sind Sonderprobleme bei Ermittlungsgehilfen?
Informanten und V-Leute werden einfach als Zeugen behandelt. Schwierigen ist es bei verdeckten Ermittlern, § 110. Deren Identität soll oft geheimgehalten werden.
Was ist das Strafbefehlsverfahren und wie funktioniert es?
Statt nach § 170 Klage zu erheben, kann sich die StA auch entschließen, Antrag auf Strafbefehl zu stellen. Die Voraussetzungen stehen im § 407.
Was ist das beschleunigte Verfahren?
Durchlesen. Hauptsächlich entfällt das Zwischenverfahren, es gibt auch einige sonstige Änderungen am StPO-Verfahren.
Was ist die Privatklage?
Hier übernimmt im Prinzip eine Privatperson die Rolle des StA. Zusätzlich zu den allgemeinen Prozeßvoraussetzungen müssen die Voraussetzungen des §§ 374 ff. gegeben sein.
Was ist die Nebenklage?
Hier schließt sich der Verletzte der Klage bloß an. Die Klage ist akzessorisch.
- Citation du texte
- Arne Trautmann (Auteur), 1999, Strafprozeßrecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/95995