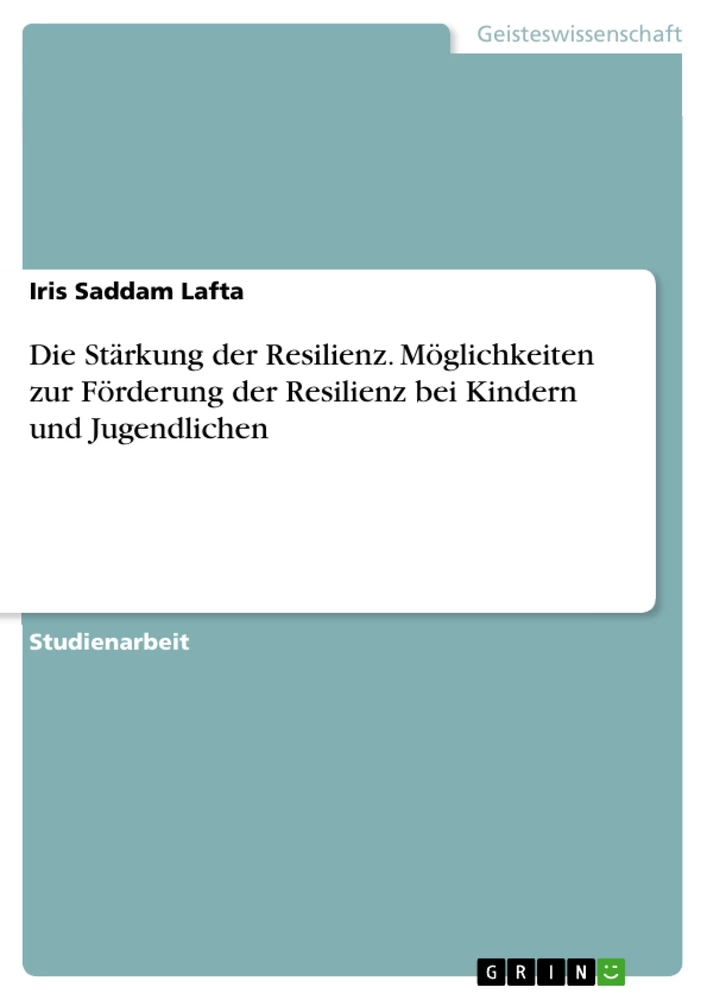In dieser Arbeit sollen verschiedene Faktoren der Stärkung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen dargestellt werden. Dabei wird sich hierbei auf ein Alter zwischen sechs und 17 Jahren begrenzt. Neben der Begrifflichkeit sollen Fragen des wissenschaftlichen Aspektes sowie verschieden Konzepte von Resilienz beleuchtet werden. Die Rolle der Sozialen Arbeit wird im letzten Teil beschrieben.
Viele Kinder und Jugendliche sind mit einer Vielzahl an belastenden Situationen, wie Armut, Arbeitslosigkeit von einem oder beider Elternteile, verschiedener Formen von Gewalt, Traumata oder schwere Konfliktsituationen der Eltern bis hin zur Trennung oder Scheidung, ausgesetzt. Gleichzeitig stehen einige Kinder auch mit den Prozessen der eigenen Entwicklung und schulischen Leistungen im Konflikt.
In der Arbeit im Offenen Ganztag einer Grundschule wurde mit der Zeit festgestellt, dass es Kinder gibt, die positiv mit Rückschlägen, Stress oder Konflikten umgehen können und ebenfalls auch diejenigen, die großen Unterstützungsbedarf haben, eben diese Situationen zu meistern. Das Konzept der Resilienz beschäftigt sich mit dem Umgang von Stresssituation. Und hat sich in den letzten 50-60 Jahren weiter in der Wissenschaft etabliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Resilienz - Eine begriffliche Annährung...
- 2. Historische Entwicklung von Resilienz..
- 3. Risiko- und Schutzfaktoren der Resilienz....
- 3.1. Risikofaktorenkonzept....
- 3.2. Schutzfaktorenkonzept.......
- 3.2.1. Bindung als protektiver Faktor........
- 3.2.2. Wirkungsweise Schutzfaktoren.....
- 4. Resilienzmodelle……………………………….
- 4.1. Das Modell der Kompensation...
- 4.2. Das Modell der Herausforderung..\li>
- 4.3. Das Modell der Interaktion............
- 4.4. Das Modell der Kumulation….......
- 5. Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz...
- 5.1. Präventionsprogramm „FAST“.
- 6. Soziale Arbeit und Resilienz….........
- 7. Fazit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Stärkung von Resilienz bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren. Sie beleuchtet verschiedene Faktoren, die die Resilienz fördern können, und untersucht die wissenschaftlichen Aspekte und Konzepte von Resilienz. Darüber hinaus werden einzelne Methoden vorgestellt, um die gewonnenen Erkenntnisse in die praktische Arbeit zu integrieren. Die Rolle der Sozialen Arbeit in Bezug auf Resilienz wird im letzten Teil der Arbeit beleuchtet.
- Begriffliche Annäherung und historische Entwicklung von Resilienz
- Risiko- und Schutzfaktoren für die Resilienz von Kindern und Jugendlichen
- Verschiedene Resilienzmodelle und ihre Anwendung
- Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz in der Praxis
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der Förderung von Resilienz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen ein und stellt den Kontext der Arbeit dar. Kapitel 1 behandelt die begriffliche Annäherung und die historische Entwicklung des Resilienzkonzepts. Dabei werden verschiedene Definitionen und Ansätze aus der Psychologie, Sozialwissenschaften und Medizin vorgestellt.
Kapitel 2 befasst sich mit den Risiko- und Schutzfaktoren von Resilienz. Hier werden die Risikofaktoren, die die Entwicklung von Resilienz erschweren, sowie die Schutzfaktoren, die eine positive Entwicklung fördern, näher beleuchtet.
Kapitel 3 präsentiert verschiedene Resilienzmodelle, die verschiedene Ansätze zur Erklärung und Förderung von Resilienz aufzeigen. Es werden die Modelle der Kompensation, der Herausforderung, der Interaktion und der Kumulation vorgestellt.
Kapitel 4 geht auf Maßnahmen zur Stärkung von Resilienz ein, wobei das Präventionsprogramm "FAST" als Beispiel für eine konkrete Interventionsmöglichkeit vorgestellt wird.
Kapitel 5 beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in Bezug auf die Förderung von Resilienz und beschreibt die Bedeutung des professionellen Handelns in diesem Kontext.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Kinder, Jugendliche, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Bindung, Prävention, Intervention, Soziale Arbeit, Salutogenese, Kohärenzfaktoren, Entwicklungspsychologie.
- Quote paper
- Iris Saddam Lafta (Author), 2017, Die Stärkung der Resilienz. Möglichkeiten zur Förderung der Resilienz bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/960244