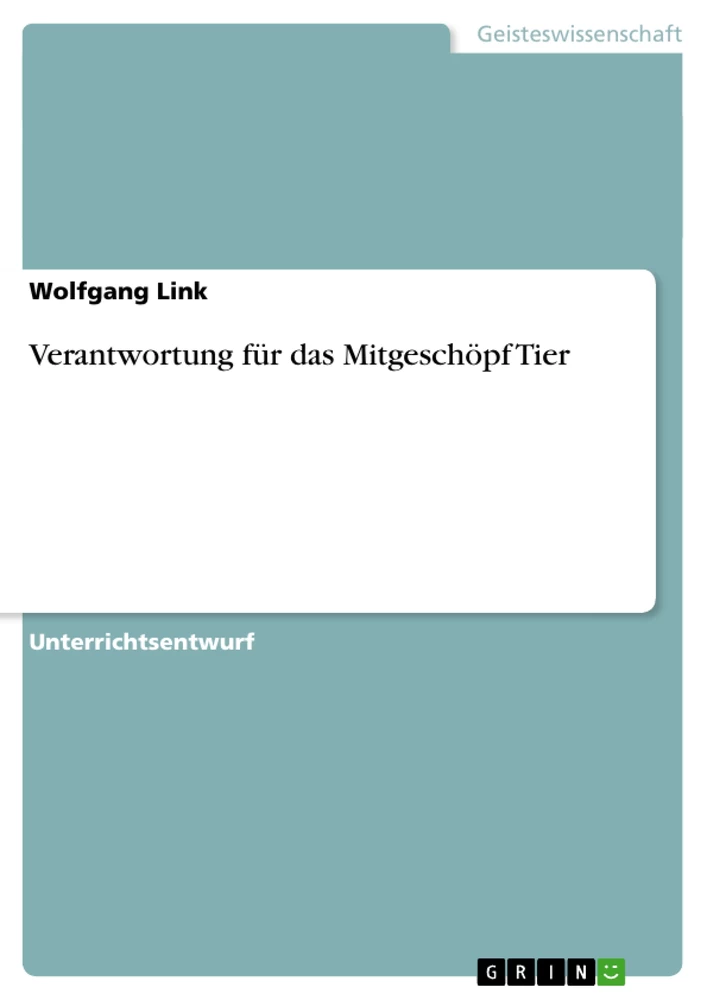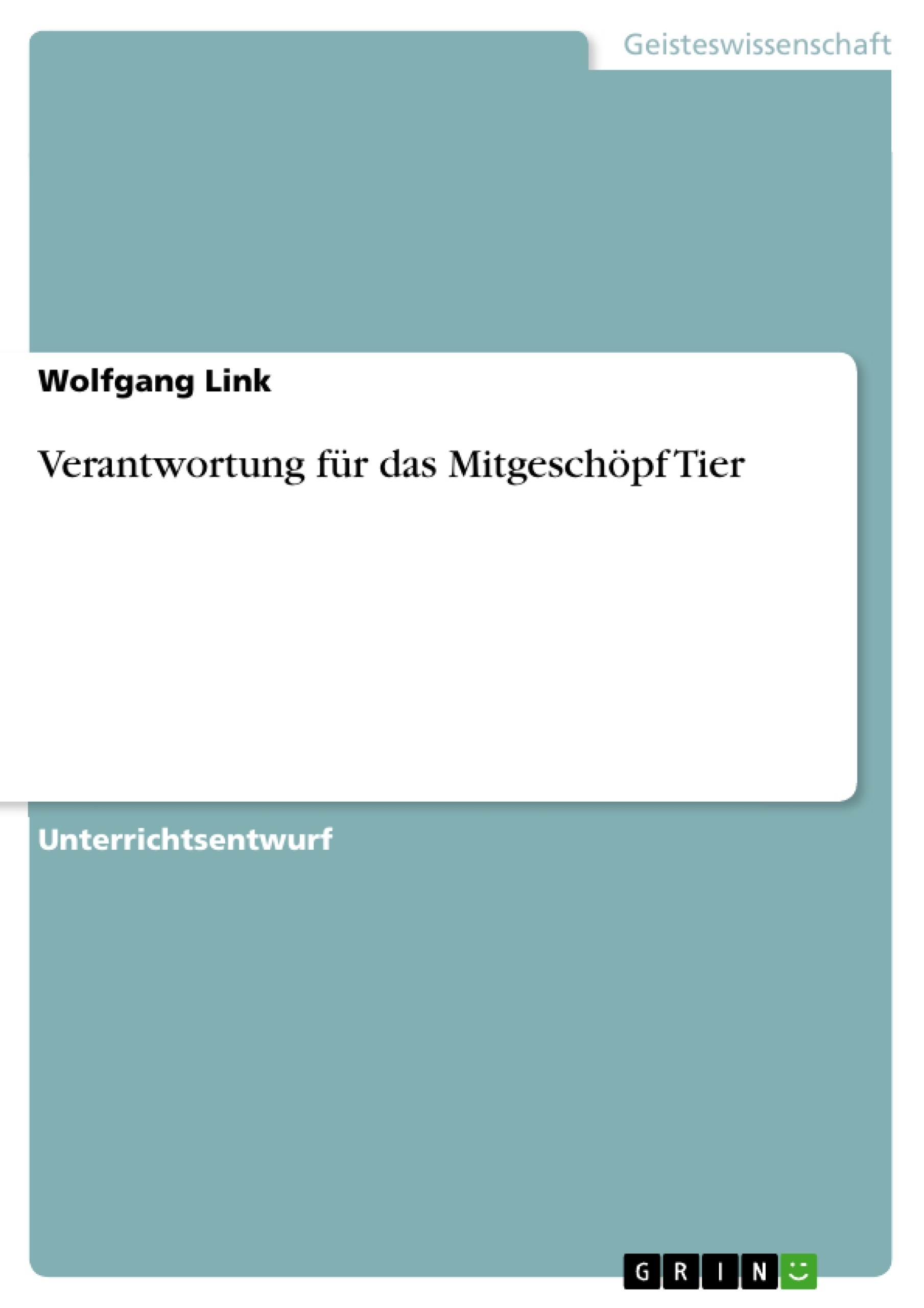Stell dir vor, du stehst vor dem Kühlregal, greifst nach einem Stück Fleisch und plötzlich tauchen Bilder auf: gequälte Augen, enge Ställe, ein Leben voller Entbehrungen. Dieses Buch ist keine Anklage, sondern ein Weckruf. Es öffnet die Augen für die ethischen Fragen, die sich hinter unserem Konsumverhalten verbergen, und fordert uns heraus, unsere Verantwortung gegenüber den Mitgeschöpfen zu erkennen. Anhand biblischer Texte, philosophischer Überlegungen und erschütternder Einblicke in die Realität der Massentierhaltung wird ein umfassendes Bild gezeichnet, das zum Nachdenken und Handeln anregt. Die Unterrichtseinheit "Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier" nimmt dich mit auf eine Reise der Erkenntnis, beginnend mit den eigenen Einstellungen zum Tier, über die Auseinandersetzung mit biblischen Texten bis hin zur kritischen Betrachtung der Nutztierhaltung und Schlachtung. Es werden methodische Anregungen für den Unterricht gegeben, die dazu dienen, Schülerinnen und Schüler für die Problematik zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Tieren zu bewegen. Dabei geht es nicht um einfache Antworten oder Schuldzuweisungen, sondern um die Entwicklung eines differenzierten Verständnisses für die komplexen Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier und Umwelt. Es ist ein Plädoyer für eine neue Ethik, die den Wert jedes Lebewesens anerkennt und uns auffordert, unseren Platz in der Schöpfung neu zu definieren. Entdecke die überraschenden Verbindungen zwischen Glauben, Konsum und der Würde des Tieres. Lass dich inspirieren, deine eigene Position zu überdenken und aktiv zu einer lebenswerteren Zukunft für alle beizutragen. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Tierschutz, Ethik und Nachhaltigkeit interessieren und einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten wollen. Es ist ein Aufruf zur Gewissensbildung und Gewissensschärfung im Blick auf die Verantwortung, die wir Gott gegenüber für seine Schöpfung tragen. Schlüsselwörter: Tierschutz, Ethik, Massentierhaltung, Schöpfungsverantwortung, Religionsunterricht, Umweltethik, Bibel, Nachhaltigkeit, Konsumverhalten, Mitgeschöpflichkeit, Tierethik, Unterrichtsmaterialien, Gewissensbildung, Tierwohl, Verantwortung.
Gliederung
1. Einführung in die Thematik
2. Bemerkungen zur Situation der Altersstufe
3. Sachanalyse
4. Didaktische Analyse
5. Methodische Anmerkungen zum Unterrichtsverlauf
6. Reflexion der Unterrichtseinheit
Vortrag an der PH Kiel am 23.6.1993
1. Einführung in die Thematik FOLIE 0
In den letzten Wochen wurden - auch an der PH Kiel - verschiedene Aktivitäten durchgeführt, um auf die Problematik eines umfassenden Umwelt- und Tierschutzes aufmerksam zu machen. In Rendsburg zeigte man in einer Ausstellung in der Stadtbücherei die Not, das Leiden der Mitgeschöpfe, die gequält, mißbraucht, massenhaft gehalten, am Fließband getötet, sinnlos in ganz Europa hin- und hertransportiert werden, um Subventionen zu erzielen. Abgeschlachtete Wale, systematische Ausrottung wildlebender Tiere - alle diese schrecklichen Tatsachen wurden und werden in den Medien gezeigt, um wachzurütteln und anzuklagen. Die Resonanz auf solche Berichte in Form von Leserbriefen, Telefonanrufen oder Unterschriftenaktionen in Jugendzeitschriften zeigt echtes Mitgefühl, Trauer oder Wut der Menschen.
Aber führt die Berichterstattung wirklich zu vorübergehender oder sogar dauerhafter Verhaltensänderung?
Teutsch schreibt in einem Arbeitsheft der EZW zum Thema "Umwelt-Mitwelt- Schöpfung":
"Es ist schwer, etwas über Fragen des Umweltschutzes zu sagen und zu schreiben, ohne nicht in die Nähe von Resignation, Verbitterung, Aggression oder gar Zynismus zu geraten ..."1
Dabei wird gerade auch in letzter Zeit darüber diskutiert, ob und wie Bewahrung der Schöpfung in unserer Verfassung, dem Grundgesetz, verankert werden kann und soll.
Aber, so jedenfalls fragen die Schüler, gibt es in unserer von Gewalttaten
geprägten Gesellschaft nicht wichtigere Fragen, als gerade den Umwelt und Tierschutz? Ist es nicht wichtiger, über Abbau von Rassenhaß, Ausländerfeindlichkeit oder Rechts-radikalismus zu sprechen? Sollte man sich nicht viel stärker der Friedenserziehung zuwenden? Sicherlich ist das alles sehr wichtig und notwendig, zumal die Unterrichtszeit, die zur Verfügung steht, nie reicht, um alle angesprochenen Themenkreise intensiv zu behandeln. Dem muß man aber entgegenhalten, daß alle Lebewesen unserer Erde nicht nur eine Schicksalgemeinschaft sind, sondern eine Einheit. Jedes ist auf das andere angewiesen. Mit dem Beginn der Schöpfung wurde auch die Einheit aller Lebewesen geschafffen. Tiere als Mitglieder dieser Lebenseinheit müssen ausdrücklich als Mitgeschöpfe gesehen werden. So ist die Erziehung zum verantwortlichen Umgang mit den Mitgeschöpfen auch immer ein Stück Friedenserziehung. Gleichzeitig wird die Verantwortung für die Natur ein neuer Bereich der Ethik. Dieser Bereich stellt an uns Menschen neue und auch ungewohnte Anforderungen. Gilt es doch den Schülern und uns allen klarzumachen, daß "...die Natur nicht für uns Menschen geschützt werden soll, sondern in besonderer Weise vor ihm."2
Wie schwer dieses Ziel zu erreichen ist - und vielleicht ist es auch ein utopisches - zeigt ein Zitat zum Tierschutzbericht 1993 der Bundesregierung aus der "Woche im Bundestag":
"Grundsätzlich nehme man das Engagement der vielen Bürger in Sachen Tierschutz sehr ernst. Bei allen Maßnahmen gehe es darum, den ethisch begründeten Zielset- zungen des Tierschutzes auf der einen und den ebenfalls begründeten Ansprüchen der Menschen auf der anderen Seite abzuwägen und einen vertretbaren Ausgleich zu finden."3
In der vorliegenden Unterrichtseinheit geht es nicht darum, eine Gratwanderung zwischen diesen Standpunkten zu leisten, sondern es soll ein Plädoyer gehalten werden für die Verantwortung gegenüber nichtmenschlichen Lebewesen, weil ihnen ein eigener Wert in unserer Schöpfung zugestanden wird.
Um auszuschließen, daß wir selbst dem Trugschluß einer schnellen Verhaltensänderung durch den Unterricht erliegen, stellen wir fest, daß die Behandlung des Themas im Unterricht nur begrenzt sein kann.
Gerade im Religions- und Ethikunterricht, der zumeist zweistündig erteilt wird, ist es nicht möglich, einen Wertewandel durchzusetzen. Doch Initiativen anzuregen, zu eigenem Nachdenken anzuleiten und vielleicht sogar eine Übernahme von Verantwortung anzustreben ist möglich und für die Zukunft sogar unerläßlich. Gerade im Religionsunterricht ist der Zusammenhang von Glaube und ethischem Han- deln zu verdeutlichen.
Man kann wohl sagen, daß es um Gewissensbildung und Gewissensschärfung im Blick auf die Gott gegenüber geschuldete Verantwortung geht.
Als Frau Bauhoff mich fragte, ob ich einen Praxisbericht zum Thema Tierschutzethik geben könnte, wußte ich noch nicht, wie stiefmütterlich dieses Thema in den Religionsbüchern für die Klassen 9/10 behandelt wird. Auch wenn viele Stellen - vom Tierschutzbund bis zur Landeskirche - das Thema für wichtig halten, so ist es doch verwunderlich, daß in den meisten Unterrichtswerken und-modellen das Thema "Tierschutz" keine Erwähnung findet. Die Autoren tragen alle noch der Forderung auch ökologischer Fragestellungen im Religionsbuch Rechnung, aber auf die ethischen Probleme der Massentierhaltung, der Tierversuche oder der Ausrottung wildlebender Tierarten wird höchstens am Rande eingegangen. Selbst in dem gerade erst erschienenen Religionsbuch "Baupläne Religion" wird darauf nicht eingegangen.
2. Bemerkungen zur Altersstufe
Die Schüler/innen befinden sich am Ende der ersten pubertären Phase und verlassen die vorher anzutreffende Introversion, sie vollziehen eine Neuorientierung zur Umwelt, die sich an der Bereitschaft zum Engagement, zur Teilhabe an gesellschaftlichen und mitmenschlichen Problemen zeigt.
In den Schülerselbstverwaltungsorganen z.B. oder in der Readaktion der Schülerzeitung kann man diese gesteigerte Leistungsbereitschaft ablesen. Es darf angenommen werden, daß in ihnen eine soziale Grundhaltung überhand gewinnt, die sich auch Fragen der Umwelt und der ethischen Bewertung eigenen Handelns nicht verschließt. Die emotionale Aufgeschlossenheit gegenüber Projekten, spontane Aktionen zur "Weltverbesserung" sind vorhanden.
Es ist also durchaus nicht so, daß die Jugendlichen in der allseits beklagten Passivität verharren, sondern sie wollen motiviert werden, um selbst zu neuen Ufern aufzubrechen. Allerdings dürfen wir Erzieher selbst nicht nur das Leistungs- und Konsumdenken fördern.
Andererseits ist der Umgang mit ethischen Fragestellungen doch noch sehr schwierig. Wir erlebten das in unserer Schule beim Thema "Sterbehilfe". Die Schüler/innen entscheiden sehr schnell und sind sich oft der Tragweite ihrer momentanen Argumentation gar nicht bewußt. Eine größere Anzahl weiß oft nicht, wo sie die Kriterien zur Bewertung der Phänomene hernehmen soll. Ein traditionell von den christlichen Kirchen vermitteltes Wertesystem ist nicht mehr selbstverständlich. Manchmal ist es sogar so, daß die schroffe Abneigung gegen den herkömmlichen Wertekatalog der Eltern und Erzieher diese schockiert. Aber wir sollten diese Herausforderung annehmen und überzeugend Stellung beziehen. Durch Gelassenheit und, wie mein Mentor einmal sagte, "wohlwollende Bestimmtheit" überzeugen wir als Gesprächspartner.
3. Sachanalyse
3.1. Bewahrung der Schöpfung
Es würde den Rahmen dieses Berichtes sprengen, wenn wir alle Aspekte der Umweltund Schöpfungsproblematik darstellen wollten. Das ist in der Vorlesungsreihe ja auch schon geschehen.
Ich möchte kurz auf die Schöpfungsverantwortung, das Mensch-Tierverhältnis, die Massentierhaltung und den Tierschutz eingehen.
Schöpfung ist die von Gott geliebte Welt, der Gott das Leben geschenkt hat und immer wieder schenkt und das von Anfang an.
Schöpfung, so meine ich mit Jürgen Kluge, will dreifach verstanden und wahrgenommen werden:
"1. Schöpfung im Anfang mit der Schöpfungsabsicht Gottes, Lebensraum für den Menschen zu ermöglichen und zu erhalten. Aus dem Chaos wird Kosmos; er wird geschaffen zum Wohle der Menschen (Gen. 1,31).
2. Die Schöpfung geht weiter, obwohl sie der Riß der Gewalt durchzieht (Gen 6,12) und sie unter der Gewalt leidet.
3. Die Schöpfung hat Zukunft, denn Gott befreit die Schöpfung von der Gewalt. Dieser Befreiungsprozeß beginnt mit dem Kreuz Jesu Christi"4
Der Mensch ist bebauend und bewahrend in diesen Prozeß einbezogen. Er hat nicht nur den Auftrag, sich die Erde untertan zu machen (Gen. 1,28), sondern auch den von Gen. 2,15. Wir kommen damit zum Mensch - Tierverhältnis aus biblischer Sicht.
3.2. Das Verhältnis von Mensch und Tier aus biblischer Sicht
Der Mensch soll über die Tiere herrschen und ihnen Namen geben, so lesen wir es immer wieder und haben es auch so im Unterricht gelernt.
Teutsch bemerkt dazu:
"Das Tier bleibt nicht anonyme Sache, sondern tritt aus dieser Anonymität her- aus, hier ist wohl eine Analogie zum Verhältnis von Gott zum Menschen gegeben."5
Hier wird der besondere Fürsorge- und Schutzauftrag herausgestellt und es wird deutlich, daß das Tier als Mitgeschöpf und nicht als Sache zu sehen ist. Deutlich wird die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier auch an der Arche-Noah Geschichte und in der Einbeziehung der Tiere in die Sabbat-Ruhe (Ex 20,10).
Der Mensch ist nicht Endzweck der Schöpfung, sondern wie es Teutsch formuliert "Gottes Wohnen und Offenbarwerden in der Schöpfung".6
Thielicke kommt zu dem Ergebnis, daß der Mensch sich nicht gegen die anvertraute Schöpfung wenden darf. Nur in der Liebe zum Geschöpf wird er Gottes Auftrag gerecht.
Zunächst wird das auch in den biblischen Texten deutlich. Das Tier wird Gehilfe und Schutzbefohlener des Menschen, beiden wird pflanzliche Nahrung zugewiesen (Gen 1, 29ff).
Doch der Friede in der Schöpfung ist paradiesischer Zustand, und in einer Vision beschreibt der Prophet Jesaja (Jes. 11,6ff) auch wieder ein solches Endziel: Ein Säugling spielt vor der Höhle der Natter, Wolf und Schaf leben in Frieden und aus dem Löwen wird ein friedliches Weidetier.
Auf der anderen Seite ist aber auch Fleischnahrung zugelassen. Das läßt sich aus der biblischen Überlieferung nicht wegdiskutieren, und in der menschlichen Entwicklungsgeschichte folgt auf den Sammler eben der Jäger, der sich der Werkzeuge und Waffen bedient, um Tiere zu jagen und zu töten.
Die Gewaltherrschaft des Menschen über das Tier beginnt mit dem Sündenfall und nach der Sintflut.
Im Gegensatz zu Teutsch sieht Peter Singer zwar einen gewissen Grad von Freundlichkeit gegenüber den Tieren, aber er sagt:
"... doch es gibt nichts, das die Gesamtansicht herausfordert, die in der Schöpfungsgeschichte niedergelegt wurde, daß nämlich der Mensch die Krone der Schöpfung sei und alle anderen Kreaturen in seine Hand gegeben seien und er göttliche Erlaubnis habe, sie zu töten und zu essen."7
Im NT ist die Einheit von Mensch und Tier im Leiden erkennbar. Das Erlösungsgeschehen gilt für die gesamte Kreatur (Röm. 8,19). In Christus verschmelzen die Vision des Propheten Jesaja und die Erwartung des Reiches Gottes. Die Vision von einer neuen und gerechten Schöpfung bleibt als Hoffnung auf das kommende Gottesreich bestehen.
Immer mehr Menschen fragen aber heute nach dem Handeln. Der Gedanke an das leidende Tier z.B. in Massenhaltung, Ausrottung und Tierversuchen erscheint immer mehr Menschen als Unrecht.
Konkret muß das Tier in das christliche Liebes- und Gerechtigkeitsgebot einbezogen werden, damit das Reich Gottes schon heute hineinstrahlen kann in unsere Welt.
"So gewiß der Mensch dem Tier überlegen ist, so gewiß hat er nicht das Recht, seine Überlegenheit einseitig für sich auszunutzen. Im Ganzen der Natur stehend, schuldet er, der in seiner Welt für sich Gerechtigkeit erwartet, solche auch dem Tier ..."8
3.3. Kirche und Tierschutz
Bis ins 19. Jahrhundert war der Tierschutz kein Thema für die Kirche. Erst im Pietismus fand eine Hinwendung zum Tier statt. 1837 gründete Pfarrer Albert Knapp den ersten deutschen Tierverein. Bis in die siebziger Jahre unseres Jahrhunderts bleibt jedoch der Tierschutz nur ein unbedeutender, wenig beachteter Teil der Umweltaktivitäten der Kirchen. Allerdings darf man in diesem Zusammenhang Fritz Blanke nicht vergessen, der schon im Jahre 1959 die Formel von der Mitgeschöpflichkeit der Tiere prägte.
1980 dann wurde in der Schrift "Zukunft der Schöpfung - Zukunft der Menschheit" von der Deutschen Bischofskonferenz vom Dualismus Descartes9 Abschied genommen. In der Evangelischen Kirche wurde erst 1984 mit der Denkschrift "Landwirtschaft im Spannungsfeld" festgestellt:
"Wenn die Kirche die Barmherzigkeit verkündet, gilt diese dann nicht auch den uns anvertrauten Tieren? ... Es ist kein Zufall, das wir heute Stimmen wie von Franz v. Assissi oder Albert Schweitzer hören: Ich bin das Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will."10
Die Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit von Kirche und Theologie gegenüber den Mitgeschöpfen hat damit wohl ein Ende.
Konsensfähig ist heute, Tieren weitgehend ihr Eigenleben zu belassen und so gering wie nur irgend möglich zu nutzen. Das gilt auch für den Fleischbedarf.
Nur um des menschlichen Notbedarfs wegen sollten Tiere verfolgt, geschädigt oder getötet werden.
Neben der Betrachtung der biblischen Aspekte wird in der Unterrichtseinheit besonders auf zwei Schwerpunkte der Tierschutzproblematik eingegangen. Die Schüler/innen kommen alle aus dem ländlichen Raum und kennen die Massentierhaltung. Ein Aufgreifen dieser Thematik bietet sich an. Daneben soll als Konsequenz dieser Haltung auch die Schlachtung der Tiere behandelt werden, da einige Schüler/innen von sich aus nach den Vorgängen und Abläufen der Schlachtung im Schlachthof fragten.
3.4. Die Massentierhaltung
Die Massentierhaltung orientiert sich an einer bis zur Perfektion gesteigerten Nutzung von Tieren durch den Menschen; sie kann als gefühllose Ausbeutung verstanden werden. Um Lohnkosten und Aufwand zu sparen, werden die Tiere auf allerengstem Raum zusammengepfercht und zur Eier-, Fleisch- und Milchproduktion herangezogen. Die Tiere werden behandelt wie Maschinen, die billiges Futter in teures Fleisch oder andere Produkte umwandeln. Oft wird dafür der Begriff "Veredelung" verwendet. Den Tieren wird nur die geringste oder keine Lebensqualität bewilligt. Außer Nahrungsaufnahme, Koten und körpereigenem Produzieren wird ihnen fast alles vorenthalten. Sie können sich nicht artgemäß bewegen und leben oft in einer Welt aus Eisen und Beton. Mitgeschöpfe werden zu Tiermaschinen umgestaltet.
3.5. Die Tötung der Tiere
Nur den Pflanzen ist es möglich, sich selbst zu ernähren, zu erhalten, ohne biologische Stoffe anderer beanspruchen zu müssen. Tiere und Menschen sind darauf angewiesen, Mitgeschöpfe oder Teile von diesen zu verzehren. Der Mensch ist auch bei Bekleidung und anderer Ausstattung auf Tiere oder Pflanzen angewiesen.
Wir müssen davon ausgehen, wenn wir Realisten bleiben wollen, daß viele Menschen nicht auf den Verzehr von Tieren verzichten wollen oder können. Deshalb muß sich der Tierschutz auch mit der letzten Konsequenz der Tierhaltung und dem Tierfang befassen, der Tötung.
Der unausweichliche Tod muß möglichst rasch und schmerzlos eintreten. Psychische und physische Qualen vor der Tötung sind zu vermeiden; bereits der Transport der Schlachttiere ist ein Teil des Tötungsvorgangs und er hat in schonender Weise zu erfolgen.
Das Schlachten der Tiere ist bestimmten Vorschriften unterworfen, auf die nicht näher eingegangen werden soll, da eine genaue Analyse der Schlachtvorgänge nicht beabsichtigt ist.
Die Diskrepanz zwischen dem geforderten Einhalten der Vorschriften und dem Ablauf von Transport und Schlachtung wird an den Filmausschnitten des ZDFFernsehens deutlich.11
Viele Schlachthöfe und Viehhändler lassen es an der Sorgfaltspflicht mangeln, die einer Verantwortung für das Mitgeschöpf entsprechen würde.
4. Didaktische Analyse
Die Unterrichtseinheit "Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier" ist im Lehrplan für Realschulen dem Abschnitt 1 "Der Mensch auf der Suche nach Sinn" zuzuordnen. Unter dem Teilaspekt 1.3. "Die Aufgaben des Menschen in der Welt" wird auf die Themen "... machet sie euch untertan - Freibrief für Ausbeutung?" auch der Umweltschutz als Aufgabe der Christen definiert.12
Ebenfalls fließen Elemente aus dem Fragehorizont 3: Bekennen und Handeln ein. Dazu gehört vor allem der Abschnitt "Bedrohte Schöpfung ..., Glauben - Zeichen der Hoffnung"13
Ein besonderer Hinweis auf den Umgang mit den uns anvertrauten Tieren fehlt.
Die Beschäftigung mit der Frage nach der Verantwortung des Menschen für das Tier ist für viele Bereiche des Religionsunterrichts förderlich, da im Hinblick auf die ethischen Fragestellungen viele Inhalte angesprochen werden.
Die Aufgabe des RU besteht darin, den Schüler/innen dazu zu verhelfen, eine Sinngebung für das eigene Leben zu finden, Orientierungshilfen zu bieten und damit letztlich zur Entfaltung der Persönlichkeit beizutragen.
In der Orientierungsstufe wird die Einstellung zum Haustier thematisiert und die Verantwortung für den Umgang mit Hund, Katze, Kanarienvogel oä. besprochen. Im Unterricht der Klassenstufe 7 wurde ein Projekt "Lebenselement Wasser - seine ökologische und religiöse Bedeutung" durchgeführt. Daneben wurde im Deutsch- und Biologieunterricht fächerübergreifend eine Zeitung zum Thema "Anders leben - aber wie?" erstellt, in der es um die Themen:
Gewässerschutz
Regenwald
Ökologische Lebenskreisläufe und Tierversuche
ging.
Die Schüler/innen sollen bei all diesen Vorhaben erfahren, daß der Glaube an Gott kein Abstraktum, sondern auf die Wirklichkeit der Welt bezogen ist.
So muß auch in dieser Unterrichtseinheit ein Bezug zwischen biblischen Aussagen, existentieller, individueller und schließlich sozialer Anliegen der Schüler/innen hergestellt werden.
Die Problematik der Mitverantwortung für den Umgang mit dem Tier schließt das Nutztier mit ein. In dieser Alterstufe scheint es mir auch berechtigt zu sein, auf die in der Sachanalyse aufgezeigten Fragen einzugehen.
Im Biologieunterricht der 9.und 10. Klasse werden die Themen Tierzüchtung, Genmanipulation oder praktische Präparationsversuche an Tierorganen durchgeführt, ohne daß unbedingt auf die ethischen Fragestellungen eingegangen wird.
Dabei ist es wichtig, den Jugendlichen ethische Orientierungshilfen zu geben, die sie zu engagiertem und standpunktfestem Handeln befähigen, sie sensibel zu machen für eine Ganzschau der Schöpfungsverantwortung.
Die Schüler/innen sollen dabei neben dem kognitiv-rationalen Wissen auch ihre Gefühle und Empfindungen bei der Behandlung der Unterrichtseinheit einbringen können und Erfahrungen künstlerisch/gestaltend verarbeiten.
Die Schüler/innen erfahren die Zerstörung der Umwelt und die Entfremdung von der Umwelt eher emotional. Verantwortung für ein Mitgeschöpf, dessen Einzelschicksal selten oder gar nicht verfolgt wird, muß gelernt werden. Der Unterricht thematisiert die Einstellungen zum Tier, um die Anonymität zu verdeutlichen und in der Beobachtung konkreter Einzelschicksale aufzuheben. Wer denkt schon bei den Wurstauslagen und appetitlichen Fleischstücken beim Metzger an das Leiden und Sterben der Tiere?
Es ist notwendig, das Eingebundensein des Menschen in die Kreatur zu verdeutlichen, damit eine Lebens- und Leidenseinheit in der gefallenen Schöpfung zu mehr Solidarität mit den scheinbar schwächeren und hilflosen Mitgeschöpfen führt.
Es muß im Unterricht jedoch auch aufgezeigt werden, daß eine solche positive, von höchster Verantwortung für die Mitgeschöpfe gekennzeichnete Haltung sich nur schwer verwirklichen läßt und daß sie aus der Tiefe des christlichen Glaubens und Verstehens kommen muß.
Der Glaube kann sich nur bewähren an der begründeten Hoffnung auf eine Vollendung der Schöpfung, allen menschlichen Bestrebungen haftet immer das Schuldigsein bzw. -werden an.
Die Aufnahme von Themen aus dem Bereich des Tierschutzes in der Schule muß verstärkt werden, damit verantwortliches Verhalten gegenüber der Schöpfung als allgemeines Bildungsziel angestrebt wird.
Zum Abschluß dieses Teils möchte ich noch Gerhard Liedke zitieren:
"Der christlichen Auslegung ist ganz selten bewußt geworden, daß die nachsintflutliche Fleischernährung des Menschen und das damit verbundene Töten von Tieren von der Bibel als Aspekt einer Gewalt gesehen wird, die nicht mit dem ursprünglichen Schöpfungsplan Gottes übereinstimmt."14
5. Methodische Anmerkungen zum Unterrichtsverlauf FOLIE 1
Aufbau der Unterrichtseinheit
1./2. Std. Unsere Einstellungen zum Mitgeschöpf Tier
3./4. Std. Texte aus der Bibel
5./6. Std. Stationen eines Schweines
Haltung - Transport - Schlachtung (Filmausschnitte und Diskussion)
7./8. Std. Formen unseres Protestes
Appellatives Gestalten von Plakaten
Lernvorausetzungen
Anfang April bat ich die Schüler/innen, Meldungen und Berichte von Tiermißhandlungen, Tierversuchen oder Massentierhaltungen zu sammeln. Da der Unterricht im Wahlpflichtbereich klassenübergreifend stattfindet, war es nicht möglich, die Ergebnisse an einer Stellwand oä. zu sammeln. Das bietet sich im Kernunterricht an, da ich eine Einstimmung auf das Thema für wichtig halte. Unmittelbar vor dem Beginn der Unterrichtseinheit haben sich die Schüler/innen selbst das Material in ihren Heftern zusammengestellt. Daraus ergaben sich schon einige Fragen nach den Unterrichtsinhalten. Gleichzeitig konnte die Lehrkraft erkennen, in welchem Maße sich die Schüler/innen für die Unterrichtseinheit en- gagieren wollten.
Skizzierung der Lerneinheiten FOLIEN 1 A,B
1. Lerneinheit: Unsere Einstellung zum Mitgeschöpf Tier
Der Einstieg erfolgt über das mitgebrachte Material und Folien, die gequälte und mißhandelte Tiere zeigen. Das Material selbst regt zum spontanen Gespräch an. Die Schüler/innen artikulieren ihre Betroffenheit und beschreiben die Machtlosigkeit der dargestellten Tiere gegenüber dem Menschen. Nach einer kurzen inhaltlichen Klärung des Dargestellten erfolgt die Problematisierung.
Anhand einer Folienfolge ( FOLIE 2), die verschiedene Situationen im Umgang mit den Tieren darstellt, wurden die Schüler gebeten, die verschiedenen Einstellungen zu nennen.
An den genannten und im weiteren Gespräch entwickelten Einstellungen, die an der Tafel festgehalten wurden, wurde deutlich, daß die Schüler/innen gut in der Lage waren, das eigene Verhalten zu reflektieren.
Dier Erarbeitung brachte drei grundsätzliche Positionen zum Ausdruck. (FOLIE 3) Den Haustieren steht man im allgemeinen sehr positiv gegenüber und hat eine sehr emotionale Beziehung zu ihnen. Das wird verdeutlicht an der Funktion des Haustieres als Schmusetier, Kindersatz oder Gefährte des Menschen. Die Schüler/innen sprachen in diesem Zusammmenhang schon von den Tieren als "Vertrauensperson", billigten ihm also eine Persönlichkeit zu.
Die Nutztiere sieht man eher sachlich-neutral. In dieser Aufzählung ist bemerkenswert, daß eine anonyme Beziehung angegeben wird, die es erschwert, sich den Nutztieren emotional zu nähern. Die vorherige Beschäftigung mit dem Thema spiegelte sich schon in den Antworten wider.
Über das Stichwort "Anonymität" wird länger zu reden sein. Die Be- ziehungslosigkeit zwischen dem Nutztier im Stall des Landwirts und dem Kotelett auf dem Teller wurde von den Schüler/innen erkannt und beschrieben.
Die Wildtiere nun werden wieder positiv emotional bewertet. Es war den Schüleräußerungen zu entnehmen, daß hier noch eine ursprüngliche Beziehung, wenn auch verkümmert, zum Mitgeschöpf vorzufinden ist.
Dieser letzte Punkt eignet sich besonders, um die Einstellungen der Menschen zum Mitgeschöpf Tier zu problematisieren. (FOLIE 4)
Die Textauswahl auf dem Arbeitsblatt ist provozierend. Die Texte von Lichtenberg, Levi-Strauss und aus dem Schöpfungsbericht sind geeignet, eine kontroverse Diskussion zu ermöglichen. Die Schüler/innen empfanden besonders Lichtenbergs Aussage unmöglich. So schreibt Ines:
"Er (Lichtenberg) nutzt es regelrecht aus, daß ihm kein anderes Wesen widersprechenkann. Ich finde es sehr eingebildet, den Menschen als edel zu bezeichnen, wenn man sich einmal die Berichte über das Leiden der Tiere ansieht, und die anderen Geschöpfe abzustufen."
Der Auszug aus Genesis 1 soll zur nächsten Lerneinheit überleiten.
2. Lerneinheit
Die Beschäftigung mit der "Quelle" unseres Glaubens birgt die Chance, die
Aktualität biblischer Berichte oder Fragestellungen aufzuzeigen.
Es wurde an den Text Genesis 1,28ff angeknüpft und die Frage gestellt, wie der Herrschaftsauftrag wohl zu verstehen ist.
Die Diskussion ergab, daß es wohl nicht vorstellbar ist, daß Gott dem Menschen die Schöpfung zum Raubbau ausgeliefert hat.
Zur Information werden die folgenden Bibelstellen angegeben: FOLIE 5
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Schüler/innen erarbeiteten in Gruppen jeweils drei oder vier Bibelstellen und sprachen über ihre Ergebnisse.
Folgende Fragestellungen ergaben sich aus der Lektüre:
- Können wir Menschen den Fleischverzehr eigentlich billigen?
- Was müssen wir zur Artenerhaltung heute beitragen?
- Was bedeutet das "Schreien" nach Erlösung?
- Gibt es eine berechtigte Hoffnung auf ein Friedensreich?
Es war anschließend nicht ganz leicht, die Arbeitsergebnisse systematisch festzuhalten, da auch kontrovers diskutiert wurde. Es wurde aber folgendes besonders herausgearbeitet:
- Menschen und Tiere erhalten ursprünglich die Pflanzen als Nahrung
- Menschen werden als Herrscher über die Tiere angesehen
- Menschen verbreiten bis heute Furcht und Schrecken
Besonders eingegangen wurde noch auf den Vergleich von Genesis 1, 28 -30 und 9, 1-7 als Auslegung von 2,15.
Anstelle der absoluten Machtergreifung des Menschen sollte sein Machtverzicht treten, der der Kreatur eine Chance gibt.
An der jahwistischen Tradition Genesis 2 kann aufgezeigt werden, daß es um partnerschaftliche Zuordnung von Mensch und Tier geht. Namensgebung durch den Menschen beinhaltet Schutzfunktion.
Das wurde aus dem Akt der Namensgebung der Kinder den Schüler/innen verdeutlicht.
Dabei wurde das Abl. "Das Bild des Herrschers im Israel des AT" zu Hilfe genommen.15 FOLIE 6
Diese biblische Interpretation warf die Frage nach der Stellung der anderen Religionen zum Tier auf.
Das Thema wurde nur knapp an zwei Darstellungen aus der altägyptischen Götterwelt behandelt.16 FOLIE 7
Als Ergebnis der Textanalyse wurde festgestellt, daß die Ehrfurcht vor dem Leben vorherrscht und Tiere nur getötet wurden, wenn es unbedingt sein mußte. Die Lehrkraft schließt mit dem Hinweis, daß das Schächten der Tiere auf den damaligen technischen Bedingungen beruhte und das Verbot Blut zu essen, der Vorstellung entstammt, daß es Sitz der Seele und des Lebens ist und in den Schoß der Erde zurückkehren soll, um neues Leben hervorzubringen.
3. Lerneinheit
Aus den Materialien, die die Schüler/innen mitbrachten, ergaben sich viele Ansatzpunkte zur Vertiefung des Themas. Da einige Schüler/innen die Ankündigungen der ZDF-Filmreihe zur Problematik von Massentierhaltung und Schlachtung gelesen hatten, entschied sich die Lerngruppe für die Weiterbehandlung dieses Aspekts im Unterricht.
Die gezeigten Filmausschnitte lassen keinen Zweifel an der Unmenschlichkeit der Haltung, des Transports und der Tötung von Nutztieren aufkommen. Sicherlich ist die Frage erlaubt, ob eine solche Darstellung den Schüler/innen zugemutet werden kann.
Ich meine, daß eine theoretische Diskussion des Problems nicht zu einem emotionalen Zugang führen wird. Ein Besuch im Schlachthof ist ebenso auszuschließen.
Die Schüler/innen zeigten in der anschließenden Diskussion ihre Betroffenheit und erkannten auch die Diskrepanz zwischen den hohen ethischen Forderungen und der Wirklichkeit des Umgangs mit den Nutztieren. Alle erklärten sich mit der geschundenen Kreatur solidarisch.
Witze oder Vergleiche zu den Horrorvideos blieben gänzlich aus; jeder war in dieser Situation betroffen.
Als Überleitung zur sachlichen Aufarbeitung des Gesehenen diente das Lied "Du schufst, Herr unsere Erde gut"17 FOLIE 8
Die Schüler/innen wollten als Hausaufgabe noch selbst eine Strophe zum Thema Tierschutz dazudichten, doch leider blieb es bei der Absicht!
Anschließend wurde in Gruppenarbeit ein Vergleich mit den Bestimmungen des Tierschutzes durchgeführt.
Die Schüler/innen bekamen dazu Auszüge aus dem Tierschutzgesetz und dem Bundesnaturschutzgesetz18 FOLIE 9
Das tabellarische Ergebnis möchte ich kurz vorstellen. FOLIE 10
Zum Schluß der Unterrichtsstunde fragten mich die Schüler/innen, ob sie nicht Plakate und Appelle verfassen könnten, um die erkannten Mißstände zu dokumentieren und zu kommentieren.
Drei Schüler/innen beschlossen spontan, auf Fleisch und Wurst zukünftig zu verzichten.
4. Lerneinheit
Den Abschluß der Unterrichtseinheit bildete eine kreative Umsetzung der im Unterricht durchlebten Phasen des Mitgefühls und der Solidarität mit den Tieren. Es ist wichtig, den Schüler/innen Gelegenheit zu geben, ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ein methodischer Wechsel, die Verknüpfung von kognitiver Arbeit und kreativer "Handarbeit" ist ein pädagogisches Prinzip des ganzheitlichen Zugangs zum Thema Schöpfung. Die Materialien standen den Schüler/innen zur Verfügung, weil wir für diese Arbeit in den Kunstraum der Schule gehen konnten. In den Plakaten kamen vor allem folgende Aspekte zum Ausdruck:
Die grauenhafte Qual der leidenden Kreatur stand absolut im Vordergrund. Der biblische Bezug wurde nicht aufgegriffen.
Die formulierten Appelle und ein formuliertes Gebet waren die Ausnahme.
Reflexion der Unterrichtseinheit
In der vorliegenden Unterrichtseinheit sollten die Schüler/innen sich der Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier stärker bewußt werden. Die Beschäftigung mit dieser Problematik sollte ihnen aufzeigen, daß nicht der Mensch Maß aller Dinge sein kann, sondern daß er ethische Verantwortung für alle Lebewesen trägt. Klaus Michael Meyer-Abich schreibt dazu: "Vielleicht ist der Mensch das einzige Lebewesen, das Verantwortung für seine natürliche Mitwelt empfinden und entsprechend handeln kann."19
Die Thematik der Unterrichtseinheit beschäftigte viele Schüler/innen auch schon vorher; das zeigte sich auch an den vielen Artikeln und Berichten, die sie mitbrachten. Den Zusammenhang mit den biblischen Texten und dem damit verbundenen Auftrag des Menschen verbalisierten sie erneut. Die Filmausschnitte machten eine starke Betroffenheit der Schüler/innen deutlich, und ich denke, daß die gewonnenen Erkenntnisse und Einstellungen zum Tier bzw. Nutztier sie auch später dazu veranlassen werden, nachdenklich und ggf. engagiert zu sein, wenn es um die Belange der Nutztiere geht. Das zeigte sich auch an der Begeisterung, mit der an den Plakaten gearbeitet wurde und der Tatsache, daß die schon erwähnten drei Schüler/innen es bis heute durchgehalten haben, auf Fleisch in der Nahrung zu verzichten. Da in der Lerngruppe auch Schüler/innen waren, deren Väter in der Landwirtschaft tätig sind, blieben sie in dem Zwiespalt wirtschaftlicher Interessen und ethischer Forderungen. Sie betonten vor allem, daß es ihnen gefallen habe, daß im Unterricht auch auf die Vollendung der Schöpfung durch Gott selbst hingewiesen wurde.
Hier kann man mir eine Kompromißhaltung vorwerfen, aber die "Solidarität der Sünder" fordert sie.
Wichtig ist die intensive Einbeziehung der eigenen Person der Schüler/innen, damit sie einen vielfältigen Zugang zu dem Unterichtsgegenstand gewinnen. Die Erstellung der Plakate bietet die Gelegenheit, auch der gesamten Schule in einer kleinen Ausstellung in der Pausenhalle die Thematik näherzubringen.
Zusammenfassend halte ich fest, daß diese beispielhafte Erarbeitung eines Aspektes der Tierschutzproblematik geeignet ist, Beziehungen zwischen heutiger Realität, individuellen Erfahrungen und Meinungen und biblischen Grundaussagen herzustellen und für Schüler/innen dieser Altersstufe erfahrbar zu machen.
Sicherlich gibt es vielfältige andere Zugänge zu dieser Thematik, aber dieser Bericht will Sie anregen und ermutigen, sich den Fragen zuzuwenden und sie im Unterricht ausführlich zur Sprache zu bringen.
[...]
1 Teutsch, Gotthard M. (Hg): Umwelt-Mitwelt-Schöpfung, EZW-Arbeitstexte Nr. 29, Stuttgart 1993
2 Teutsch, ebenda, S. 18
3 wib 4/93, S.21
4 Kluge, Jürgen, in: Die andere Seite der Umwelterziehung, Cornelsen 1991, S. 47
5 Teutsch, Gotthard M.: Tierversuche und Tierschutz, München 1983, S.16
6 ebenda, S.17
7 Singer, Peter: Befreiung der Tiere, München 1982, S.209
8 zitiert nach: Teutsch, Gotthard M., Lexikon der Tierschutzethik, Göttingen 1987, S. 36
9 Ren‚ Descartes (1596 - 1650) begründete die Unterscheidung von res cogitans (Bewußtsein oder Seele) res extensa (Körperwelt). Nach dieser Theorie ist nur das Denken des Menschen Subjekt, nur der Mensch kann fühlen, erfahren, zweifeln; die Objektwelt ist letztlich tote Materie - und dazu gehört sowohl der Körper des Menschen wie auch das Tier. Nur dem Menschen wird ein Eigenwert beigemessen.
10 ebenda, S. 109
11 Bericht von Klaus Lindner im ZDF, 1993
12 Lehrplan Realschule Ev. Religion Klasse 7,9 und 10 sowie WPK, Kiel 1986, S.37
13 ebenda, S. 62
14 Gerhard Liedke in: KU Praxis, H. 28, Gütersloh 1990
15 aus: Materialdienst des VKR-Niedersachsen, Christentum und Ökologie, H. 2/89, Hannover 1989, Nr. 2.89.11
16 Darstellungen aus: Tutanchamun, Ausstellungskatalog des Museums für Kunst und Gewerbe, Hamburg 1981, S. 81 u. 132
17 aus: Texte aus der VELKD H.41/1991, Der Mensch: Geschöpf oder Schöpfer?, Hannover o.J., S. 73
18 Klaus Sojka/Ute Schulz-Kühnel: Das neue Tierschutz-Buch, München 1991, S.23f
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Einführung in die Thematik?
Die Einführung in die Thematik beleuchtet die Problematik des Umwelt- und Tierschutzes und die Reaktionen der Menschen darauf. Es wird diskutiert, ob die Berichterstattung über Tierleid zu dauerhafter Verhaltensänderung führt, und es wird die Frage aufgeworfen, ob es angesichts anderer gesellschaftlicher Probleme nicht wichtigere Themen als Umwelt- und Tierschutz gibt. Es wird betont, dass alle Lebewesen eine Einheit bilden und dass der verantwortungsvolle Umgang mit Tieren ein Teil der Friedenserziehung ist.
Was sind die Bemerkungen zur Situation der Altersstufe?
Dieser Abschnitt beschreibt die Situation von Schülern/innen am Ende der Pubertät, die eine Neuorientierung zur Umwelt vollziehen und eine Bereitschaft zum Engagement zeigen. Es wird angenommen, dass sie eine soziale Grundhaltung entwickeln, die sich auch Fragen der Umwelt und der ethischen Bewertung eigenen Handelns nicht verschließt. Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass der Umgang mit ethischen Fragestellungen noch schwierig ist und dass ein traditionell von den christlichen Kirchen vermitteltes Wertesystem nicht mehr selbstverständlich ist.
Was beinhaltet die Sachanalyse?
Die Sachanalyse behandelt die Themen Bewahrung der Schöpfung, das Mensch-Tier-Verhältnis, die Massentierhaltung und den Tierschutz. Es wird die Schöpfungsverantwortung des Menschen betont und das Mensch-Tier-Verhältnis aus biblischer Sicht beleuchtet. Die Kirche und der Tierschutz werden ebenso thematisiert wie die ethischen Probleme der Massentierhaltung und der Tötung von Tieren.
Was wird unter didaktischer Analyse verstanden?
Die didaktische Analyse ordnet die Unterrichtseinheit "Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier" dem Lehrplan für Realschulen zu und beschreibt, wie die Themen Umweltschutz und Verantwortung für Tiere im Religionsunterricht behandelt werden können. Es wird betont, dass der Religionsunterricht den Schülern/innen helfen soll, eine Sinngebung für das eigene Leben zu finden und zur Entfaltung der Persönlichkeit beizutragen.
Welche methodischen Anmerkungen zum Unterrichtsverlauf werden gegeben?
Dieser Abschnitt beschreibt den Aufbau der Unterrichtseinheit, die sich mit den Einstellungen zum Mitgeschöpf Tier, Texten aus der Bibel, den Stationen eines Schweines (Haltung, Transport, Schlachtung) und Formen des Protests befasst. Es werden die Lernvoraussetzungen skizziert und die einzelnen Lerneinheiten detailliert beschrieben.
Was ist das Ergebnis der Reflexion der Unterrichtseinheit?
Die Reflexion der Unterrichtseinheit kommt zu dem Schluss, dass die Schüler/innen sich der Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier stärker bewusst geworden sind und dass die Filmausschnitte eine starke Betroffenheit ausgelöst haben. Es wird betont, dass die gewonnenen Erkenntnisse und Einstellungen zum Tier sie auch später dazu veranlassen werden, nachdenklich und engagiert zu sein, wenn es um die Belange der Nutztiere geht. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Einbeziehung der eigenen Person der Schüler/innen wichtig ist, um einen vielfältigen Zugang zu dem Unterichtsgegenstand zu gewinnen.
- Quote paper
- Wolfgang Link (Author), 1993, Verantwortung für das Mitgeschöpf Tier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96037