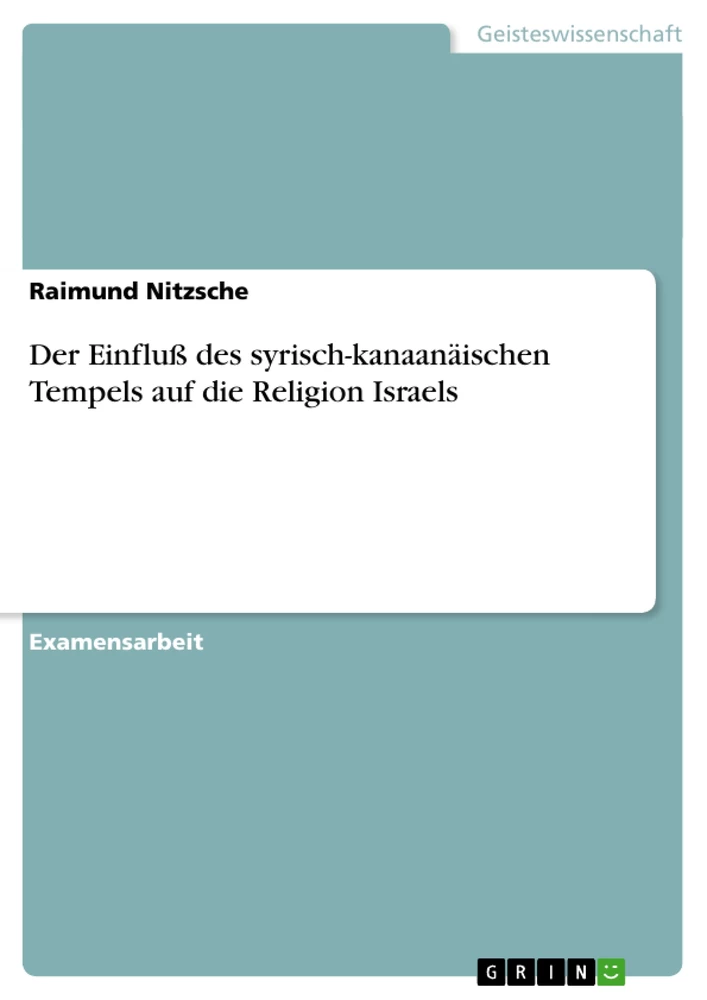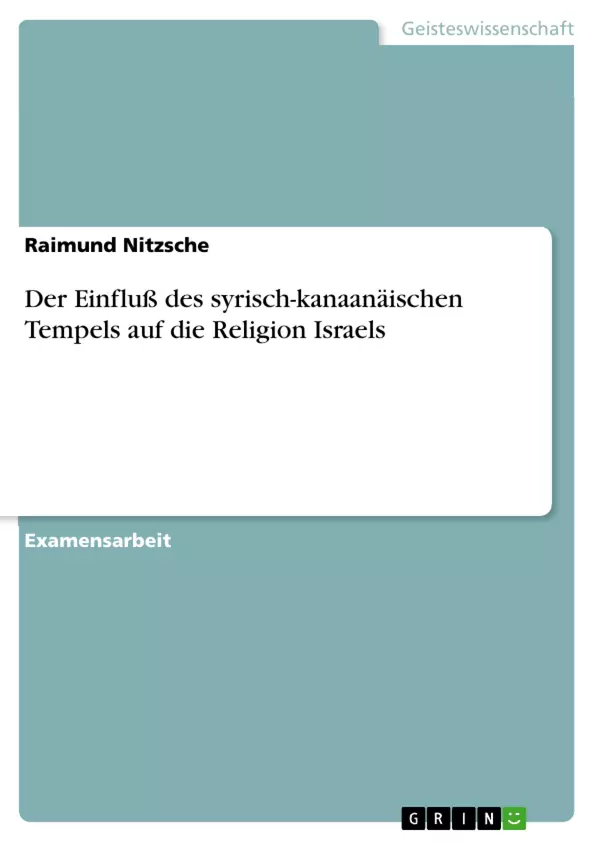Welche Rolle spielte der Tempel wirklich im alten Israel, und wie sehr wurde er von kanaanäischen Traditionen beeinflusst? Diese intriguierende Frage steht im Zentrum dieser tiefgründigen Analyse der religiösen und kulturellen Landschaft Israels zur Zeit des ersten Tempels. Das Buch entführt den Leser in eine Zeit, in der der Glaube an Jahwe sich mit den etablierten Kulten Kanaans auseinandersetzte, und untersucht, wie dieser Zusammenprall die Entwicklung des israelitischen Tempelkultes prägte. Von den religionsgeschichtlichen Voraussetzungen, die den Boden für den Tempelbau bereiteten, bis hin zu den Einflüssen des Tempels auf die Religion Israels werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen israelitischen und kanaanäischen Vorstellungen detailliert beleuchtet. Der Leser erfährt, wie der Tempel nicht nur als Ort der Nähe Gottes, sondern auch als Schmelztiegel verschiedener religiöser Praktiken fungierte, wobei das Opfer eine zentrale Rolle spielte. Die Zionstheologie, die den Tempel als unantastbares Heiligtum verklärte, wird ebenso kritisch hinterfragt wie die prophetische Kultkritik, die die Gefahr eines rein formalen Götzendienstes anprangerte. Das Buch zeichnet ein nuanciertes Bild des salomonischen Tempels, analysiert seine architektonischen Wurzeln im syrisch-palästinensischen Tempel-Typus und beleuchtet die geschichtlichen Grundlagen seines Baus. Dabei wird deutlich, wie der Tempelbau sowohl eine politische als auch eine religiöse Bedeutung hatte, indem er zur Zentralisierung des Kultes und zur Stärkung des Königtums beitrug. Es wird aufgezeigt, wie die Assimilation kanaanäischer Elemente in den israelitischen Glauben nicht nur zu einer Bereicherung, sondern auch zu Spannungen und Konflikten führte, die sich in der prophetischen Kritik entluden. Ein faszinierender Einblick in die religiösen Wurzeln des alten Israel, der die Bedeutung von Tempel und Tempelkult als Spiegelbild der kulturellen und religiösen Auseinandersetzungen jener Zeit aufzeigt und das Zusammenspiel von Assimilation und Umformung kanaanäischer Einflüsse in der Religion Israels verständlich macht. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für die Geschichte Israels, die Religionsgeschichte des Nahen Ostens und die Ursprünge des Jahweglaubens interessieren, und ein Schlüssel zum Verständnis der komplexen religiösen Landschaft des alten Israels, beleuchtet durch die Linse des Tempels und seiner tiefgreifenden kanaanäischen Einflüsse. Diese Arbeit bietet eine umfassende Analyse, die Tempelarchitektur, Kultpraktiken und theologische Entwicklungen miteinander verknüpft und so ein vielschichtiges Verständnis der israelitischen Religion ermöglicht.
Inhaltsverzeichnis
0. EINLEITUNG
1. RELIGIONSGESCHICHTLICHE VORAUSSETZUNGEN
1.1. DER GOTT DER VÄTER UND DIE KANAANÄISCHEN HEILIGTÜMER
1.2. KERNPUNKTE DES FRÜHEN JAHWEGLAUBENS
2. SALOMOS TEMPEL UND DER "SYRISCH-PALÄSTINENSISCHE TEMPEL"
2.1. ZUM BEGRIFF "TEMPEL"
2.2. TYPOLOGIE DER TEMPEL IN SYRIEN-PALÄSTINA
2.3. TEMPEL AUS ISRAELITISCHER ZEIT
2.4. DER TEMPEL SALOMOS
2.4.1. GESCHICHTLICHE GRUNDLAGEN DES TEMPELBAUS
2.4.2.KURZE BESCHREIBUNG UND EINORDNUNG DES TEMPELS
3. EINFLÜSSE DES TEM PELS AUF DIE RELIGION ISRAELS
3.1. DER TEMPEL ALS ORT DER NÄHE GOTTES
3.1.1. DIE NÄHE GOTTES ALS GARANT DER SICHERHEIT - DIE ZIONSTHEOLOGIE DES PSALTERS
3.1.2. DIE NÄHE GOTTES ALS FREIE ENTSCHEIDUNG JAHWES - JAHWES ERWÄHLUNG DES TEMPELS IN DER SICHT DES DEUTERONOMIUMS
3.2. DER TEMPEL ALS ORT DES KULTUS
3.2.1. OPFER ALS HAUPTTEIL DES KULTUS
3.2.2. PROPHETISCHE KULTKRITIK
4. ZUSAMMENFASSUNG: TEMPEL UND TEMPELKULT IN ISRAEL ALS BEISPIEL FÜR ASSIMILATION UND UMFORMUNG KANAANÄISCHER EINFLÜSSE IN DER RELIGION ISRAELS
0. Einleitung
"Israels Religion ist eine synkretistische Religion", beginnt Otto Eißfeldt seinen Aufsatz "Jahwe und Baal"1. Von der ursprünglichen Religion nomadisierender Stämme bis zu Religion und Kultus der Königszeit wurden verschiedenste Einflüsse aufgenommen und umgeformt, um den Jahweglauben der veränderten Umwelt anzupassen. Der Prozeß der Auseinandersetzung der Religionen begann schon mit der Landnahme im Kulturland.
Jahwe, der Gott des Exodus und der Wüstenwanderung stand den kanaanäischen Göttern gegenüber, deren Funktion in der Gewährleistung von Fruchtbarkeit der Äcker bestand. Jahwe hatte dazu von Haus aus keine Beziehung. Doch durch die Übernahme des Ackerbaus mußten sich die Einwanderer (und damit auch Jahwe) damit auseinandersetzen.
Jahwe mußte seine Macht im Kulturland mit seinen neuen Bedingungen neu unter Beweis stellen. In dieser Auseinandersetzung zwischen Jahwe und den Göttern (besonders Baal) nahm Jahwe neue Züge an, übernahm Funktionen (und Eigenschaften) seiner Widersacher.
So ist die Entwicklung der israelitischen Religion als ständige Auseinandersetzung zwischen alten Bekenntnissen der nomadischen Stämme und der Anpassung Jahwes an die Erfordernisse der Situation im Kulturland zu sehen. Dabei nahm es aber nicht wahllos alle Vorstellungen der Umwelt mit auf sondern grenzte sich in vielen Bereichen bewußt von seiner Umwelt ab und blieb so eine eigenständige Größe.
Diese Assimilationskraft des alttestamentlichen Gottesglaubens ist für J.Hempel2einer der
wichtigsten Unterschiede zu den Religionen der Umwelt: "So wird der Gott der Wüste zum Gott des Kulturlandes, der Gott des Krieges zum Gott des Friedens, der Gott des Volkes zum Gott der Welt und zum Gott des Einzelnen Menschen. (...) In dieser Assimilationskraft aber wurzelt der Aufstieg der Jahvereligion zur Weltreligion, wurzelt die Ausweitung des Alten Testaments zum Weltbuch."3
In dieser Arbeit soll versucht werden, anhand von Tempel und Tempelkult ein Stück dieser Assimilation religiösen Gutes aus der kanaanäischen Umwelt zu betrachten. Zwei Motive, an denen sich die prophetische Kritik besonders entzündet hat, möchte ich dabei in den Mittelpunkt stellen:
- die Vorstellung vom Wohnen Jahwes auf dem Zion
- das Opfer. Dabei ist natürlich deutlich, daß die Übernahme kanaanäischer Opferzeremonien schon in vorstaatlicher Zeit begonnen hat. Aber erst einer Zeit des offiziellen Tempelkultes ist eine bewußte Auseinandersetzung damit zu erwarten.
1. Religionsgeschichtliche Voraussetzungen
1.1. Der Gott der Väter und die kanaanäischen Heiligtümer
Die Religion Israels gründet sich auf die Erwählung des Volkes durch Jahwe, die seinen Ausdruck fand im Exodusgeschehen und dem Sinaibund. Doch die bereits im Kulturland ansässigen Stämme hatten eigene religiöse Traditionen, die später als israelitsches Gemeingut übernommen wurden indem dieser Jahwe sich Mose als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs offenbart.
Kennzeichen dieser religiösen Tradition, die man zusammenfaßt als Gott der Väter, ist im Unterschied zu den gleichfalls als El-Gottheiten bezeichneten Lokalgottheiten Kanaans das Fehlen jeder Ortsgebundenheit. Entscheidend ist für sie vielmehr die ständige Beziehung der Gottheit zu einer bestimmten Menschengruppe4. Gestiftet wird diese Beziehung durch Erwählung. Damit war dieser Religion ein wesentliches Merkmal der späteren Jahwereligion eigen: "eine Religion mit vorwiegender Betonung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, weiterhin zwischen Gott und menschlichem Verband, ohne starre Bindung an einen Ort, dafür umso bewegungsfähiger im Eingehenauf alle Veränderungen des Schicksals der Verehrerkreise."5
Mit dem Eindringen dieser Stämme ins Kulturland beteiligten sie sich an Kulten an kanaanäischen Heiligtümern, indem sie die dort verehrten Gottheiten ihren Göttern gleichstellten. So kam es zu einer Aneignung dieser Heiligtümer indem sie die Ahnen zu deren Kultstiftern werden läßt. Dafür werden die vorhandenen Heiligtumslegen übernommen und entsprechend umgedeutet.
1.2. Kernpunkte des frühen Jahweglaubens
Jahwe war nicht seit je der Gott Israels bzw. einer Gruppe, die später Bestandteil des Volkes Israel wurde.
Jahwe erscheint in der Exodustradition ähnlich wie der Vätergott als ein Gott der Verheißung, der die Rettung zusagt und die Menschen in die Freiheit führt. Er erscheint als ein Gott der mitgeht mit dem Volk und die Wanderung anführt6.
Von ganz anderer Art sind die Aussagen, die von Jahwe im Zusammenhang mit der Sinaioffenbarung getroffen2 werden: Jahwe ist ein Gott, der an einem Berg wohnt bzw. dort erscheint. Er ist also ein einen Ort festgelegt. Seine Theophanie vollzieht sich im Naturgeschehen und schließt einen Bund, bei dem sein göttliches Recht verkündet wird.
Das Wissen um die Herkunft Jahwes vom Sinai oder aus dem Süden hat sich in frühen Theophanieschilderungen erhalten, wie wir sie beispielsweise im Deboralied vorliegen haben, wo (Ri 5,4f.) von Jahwes Ausziehen aus der Steppe Edoms berichtet wird und Jahwe außerdem mit dem eigentümlichen Prädikat ____ __ (außerdem noch in Ps 68,9) bezeichnet wird. Doch ist Jahwe kein an eine bestimmte Lokalität gebundenes Wesen, sondern gleichzeitig außerweltlich. Jahwe ist also, gegenüber den Vätergottheiten kein Gott, der ohne Ortsbindung ist, der aber im Vergleich zu den Lokalgottheiten Kanaans nicht vollkommen auf einen bestimmten Ort festgelegt ist, sondern von da aus aufbricht, um seine Ziele durchzusetzen.
2. Salomos Tempel und der "syrisch-palästinensische Tempel"
2.1. Zum Begriff "Tempel"
Das lateinische Wort templum bezeichnet ursprünglich einen abgegrenzten heiligen Bezirk, der im Hebräischen ___ bezeichnet wird. Als heiliger Ort war er Stätte des Kultus. Seine Rechtfertigung erhielt er durch Theophanien und/oder durch besondere Naturgegebenheiten.
Erst mit der Entwicklung des Hausbaus wurden feste Tempel errichtet, in denen Priester Dienst tun. Vorbild für die Tempel sind profane Hausbauten, was sich auch in der Benennung als "Haus Gottes" widerspiegelt.
Die Bedeutung von Tempeln für die Götter wird deutlich aus dem ugaritischen Baals-Mythos: Baal, der durch die Kämpfe seiner Schwester Anat und durch den Sieg über seinen Widersacher Jam zum führenden Gott des ugaritischen Pantheon aufsteigt, möchte als Wohnung und als Herrschaftssitz eine Behausung:
Ach, nicht hat Baal ein Haus wie die Götter, Eine Behausung wie die Söhne der Aschirat, Eine Wohnung (wie) El, Eine Heimstätte (wie) [seine Söhne], (...)7
Der Tempel ist gedacht als die Wohnung des Gottes, dem er geweiht ist8. Er ein Zeichen für die Macht und Bedeutung eines Gottes, aber auch Garant für dessen Anwesenheit und Wirksamkeit inmitten der Welt.
So werden zur Bezeichnung von Tempeln im AT die Vokabeln tyb und Lkyh verwendet. Beide Vokabeln sind ursprünglich keine speziellen religiösen oder kultischen Termina.
a) tyb
Das ursemitische Wort tyb bezeichnet im Hebräischen ein Bauwerk aus Holz und Stein, worin ein Mann mit seiner Familie wohnt. Auch der Palast des Königs (klmh-tyb) kann damit gemeint sein, wenn der König der Hauptbewohner des Gebäudes ist. Die Verwendung zur Bezeichnung eines Tempels (myhwl¿h tyB bzw. tyB + Name des Gottes) kommt analog zustande, wenn das Gebäude als Wohnung der Gottheit errichtet wurde9.
b) Lkyh
lkyh, ein Lehnwort aus dem sumerischene-gal(großes Haus, Palast, Tempel), hat im AT drei Bedeutungen10: 'Palast', 'Tempel' und 'mittlerer Raum' im salomonischen Tempel. Wie bei tyB kommt auch die hier Übertragung der Bedeutung auf einen Tempel dadurch zustande, daß der Tempel als Wohnung der Gottheit gedacht wird. Im AT bezieht sich lkyh in der Bedeutung von 'Tempel‘ immer auf den Tempel Jahwes11. In den Berichten von Salomos Tempelbau (1Kön 6,1-7,51; 2Chr 3-4) wird mit lkyh nie der Tempel als solcher bezeichnet, sondern der mittlere Raum, der sonst auch 'das Heilige' genannt wird. Gleiches gilt auch von der Tempelvision bei Ezechiel (Ez 41). An diesen Stellen wird der Tempel stets tyB genannt12.
2.2. Typologie der Tempel in Syrien-Palästina
Die Kultur Palästinas war aufgrund seiner Lage zwischen den Großreichen von Mesopotamien, Ägypten und Anatolien zu allen Zeiten eine Mischkultur. Einflüsse aus allen diesen Kulturen haben eine verwirrende Fülle von Formen auch in der Anlage von Tempeln hervorgebracht13. Mit gewissen Abstrichen kann man aber alle bisher sicher als Tempel bestimmte Bauwerke in 4 Typen einordnen (s. Abbildung)14:
- Langraum: entweder mit geschlossener Front15oder als Anten-Tempel16.17
- Breitraum: bei palästinensischen Tempeln lag der Eingang stets in der Mitte einer Langseite18
- Knickachsbau
- Quadratbau19.20
Der Bau von Tempeln beginnt in Palästina in der Frühen Bronzezeit, also in der Zeit, in der die Stadtkultur sich erstmals voll entfaltete. Die Tempel als Tempelgebäude befanden sich in den Städten, welche Königsstädte waren21. Als Zentralheiligtümer (neben den weiterhin bestehenden und genutzten Höhenheiligtümern) waren sie meist Eigentum des Königs22. Zum Ausdruck kommt dies darin, daß der Tempel in den Komplex des Palastes eingegliedert ist23.24.
In der Frühen Bronzezeit finden sich sowohl Breitraumtempel als auch beide Varianten des Langraumtempels (in Nordsyrien). In der späten Bronzezeit kommen Knickachstempel und Quadratbau hinzu, während der Breitraumtempel scheinbar verschwindet.
Langraumtempel, besonders Anten-Tempel wurden mit der Zeit zu dem beherrschenden Tempel-Typ in Syrien-Palästina, so daß man vereinfachend vom "syrischen Tempeltypus"25 sprechen kann. Dessen besonderes Kennzeichen ist die sehr starke Betonung der Länge gegenüber der Breite des Baus und die Dreiteilung des Raumes, wobei die Vorhalle von der Vorderfront und den zwei Anten gebildet wird. Von der Cella ist ein Adyton abgeteilt, welches auf der Längsachse liegt und oft erhöht ist. Das Adyton dient der Aufnahme des Kultbildes, wenn ein solches im Tempel vorhanden ist. Eine Orientierung des Eingangs nach Osten ist für Kuschke26ein weiteres Merkmal. Dies ist aber abhängig von der Lage des Terrains27.
2.3. Tempel aus israelitischer Zeit
Für die Zeit des davidisch-salomonischen Großreiches und auch der getrennten Reiche sind Tempelanlagen in Syrien/Palästina kaum nachgewiesen. Eine Anlage (Knickachsbau) findet sich im philistäischentell qasile28. Das einzige Beispiel für einen Anten-Tempel im syrisch- palästinensischen Bereich wurde im syrischentell ta'yinatgefunden. Der in Palastkomplex eingegliederte Tempel wird immer als "Verwandter" des Jerusalemer Tempels herangezogen29.
Über Tempel in Israel neben dem Jerusalemer Tempel ist wenig bekannt. Von der Wallfahrtsstätte in Silo, die man sich gewiß als Tempel zu denken hat, konnten keinerlei Spuren gefunden werden. Für dieses Heiligtum fehlt ein ?e?o? ?o?o?. Seine Legitimation erhielt Silo durch die Lade, die als Wanderheiligtum keines festen Platzes bedurfte. Im AT wurde dieser Tempel später mit der "Stiftshütte", dem in die Wüstenzeit zurückreichenden Zeltheiligtum, gleichgesetzt30. Auch von den israelitischen Tempeln in Bethel31und Dan32(1Kön 12,29f) ist nicht einmal das Aussehen bekannt. Jerobeam I. ließ diese (schon bestehenden?) Tempel als Konkurrenz zum Jerusalemer Tempel zu Reichsheiligtümern des Nordreichs Israel erheben und stellte als Konkurrenz (und Ersatz als Thronpostament) zur Lade Stierbilder auf, die aber als Kultbilder Jahwes mißverstanden wurden und deshalb auf Kritik der Propheten stießen (z.B. Hosea 8,6: das "Kalb Samarias"). Aus diesem Grunde ließ Josia das Heiligtum von Bethel zerstören (2Kön 23.15-18), während das Heiligtum von Dan schon durch den Aramäer Ben- Hadad I. zerstört wurde, als Asa ihn um Hilfe gegen den Israeliten Baesa bat (1Kön 15,20).
Auch von dem dem durch Omri in Samaria errichteten Baals-Tempel fehlen uns sowohl Nachrichten über sein Aussehen als auch Grabungsfunde. Das kann mit der noch unvollständigen Ausgrabung des Ortes zusammenhängen. Von der für unsere Arbeit wichtigen Eisen-Zeit sind in Samaria bis heute nur Teile einer ummauerten Residenz mit Palast, "Elfenbeinhaus" und Verwaltungsgebäuden freigelegt33.
Umstritten ist die Deutung des Heiligtums von Arad34. Während Aharony35von einem "royal temple" spricht, ordnen es Wüst36und Kuschke als "Höhentempel" bzw. "Grenzheiligtum" ein. Es wurde anstelle einer älteren Opferhöhe errichtet und teilte sich ein in den Hof mit Altar und einen anschließenden Breitraum mit einer 1,50 m breiten und tiefen Kultnische, zu der Stufen führten, in der Rückwand. Nachdem der Altar schon im 7.Jh. nicht mehr verwendet wurde, wurde auch das Heiligtum Ende des 7.Jh außer Dienst gestellt.
2.4. Der Tempel Salomos
2.4.1. Geschichtliche Grundlagen des Tempelbaus
Der Aufbau einer zentralen Verwaltung für Israel und Juda und die neue Haupstadt Jerusalem durch David war für den Bestand des Staatenbundes aus Israel und Juda notwendig. Um die Stämme zusammenzuhalten, begann David durch die Überführung der Lade als dem alten Heiligtum der Stämme nach Jerusalem mit der Zentralisation des Kultes. Bis dahin hatte Jerusalem keine Tradition als Ort der Verehrung Jahwes. Die Ladeerzählung in 1.Sam 4-6 und 2.Sam 6 kann man als Kultlegende für das Jerusalemer Jahweheiligtum ansehen37: Jahwe hat sich durch verschiedene Wunder auf dem Weg der Lade von Silo nach Jerusalem kundgetan und damit verdeutlicht, daß mit der Überführung nicht menschlicher sondern Gottes Wille am Werk war.
Auch die alteingessesene Bevölkerung Jerusalems mußte zur Stärkung von Davids Hausmacht gebührende Beachtung finden. Möglich wurde dies dadurch, daß die Priester des 'el æljon von Jerusalem durch David übernommen wurden für den Jahwekult. Dafür kam es zur Identifikation von Jahwe mit 'El æljon. Eine solche Identifikation war geschichtlich schon dadurch angebahnt, daß es im Zusammenhang der Volkwerdung Israels zur Gleichsetzung Jahes mit den Vätergottheiten kam, die ihrerseits wohl lokale 'El-Gottheiten Kanaans waren38.
Aus dem Bereich der æljon-Tradition kann die Kultlegende in 2Sam 24 stammen39. Sie weist nach H.Schmid40auf den heiligen Fels in Jerusalem. Diesen Ort und seine Theophanie nimmt David für Jahwe in Anspruch und errichtet vor ihm einen Altar. Dort baute er das Zelt mit der Lade und dort soll nach Schmid das Allerheiligste des salomonischen Tempels gewesen sein41.
2.4.2.Kurze Beschreibung und Einordnung des Tempels
Salomo ließ, nachdem David mit seinem Tempelbauplan zunächst gescheitert war, den Jahwetempel von tyrischen Bauleuten errichten. Die Angaben aus 1Kön 6 erlauben, für die Rekonstruktion des Heiligtums einige Daten zu entnehmen. Man wird sich dem Tempel als dreiteligen Anten-Tempel vorzustellen haben (Verhältnis Länge : Breite = 3:1; Höhe des Hauses ca 15m). Der Tempel gehört somit in seinem Aufbau in eine ununterbrochene Traditionslinie syrischer Anten-Tempel, die von dem Tempel vontell el-huweraaus dem 3. Jahrtausend über die Anlagen vonMumbaqat, tell ta'yinatbis hin zu römischen Tempeln in Syrien reicht. Der Eingang zum Tempel führte von Osten durch eine offene Vorhalle (ulam), die ungefähr 4,50*9.00 m gemessen hat42. Vor dem Eingang zum ulam standen rechts und links zwei freistehende43Säulen, die in 1Kön 7,21 Jachin und Boas genannt werden, deren Funktion und Symbolik ungeklärt bleiben.
Eine Tür führte zum hekal (18*9m). Auf einem Podest befand sich der debir, den man sich als hölzernen Kubus (Kantenlänge je 10 m) vorzustellen hat. Imdebirstanden die Lade und zwei Cherubim.
3. Einflüsse des Tempels auf die Religion Israels
3.1. Der Tempel als Ort der Nähe Gottes
Mit dem Bau des Tempels ergaben sich weitreichende Veränderungen des Gottesbildes in Israel: Jahwe hat Wohnung genommen in seinem Tempel, er ist in der allgemeinen Vorstellung der Umwelt verfügbar geworden. Er muß nicht mehr aufbrechen vom Sinai, um seinem Volk zu Hilfe zu eilen. Es gibt einen Ort, wo man ihn aufsuchen kann, wo man mit ihm in Kontakt treten kann.
Und es besteht die Gefahr, daß die Religion zu einem rein institutionalisiertem Kult verkommt, bei dem das Verhältnis zwischen Gott und Mensch bzw. Gott und Volk aus dem Blick gerät. Jahwe würde so lediglich die Aufgaben der kanaanäischen Gottheiten übernehmen und als Gott des Bundes und der Geschichte aus dem Blick geraten.
3.1.1. Die Nähe Gottes als Garant der Sicherheit - Die Zionstheologie des Psalters
Mit dem Bau des Jerusalemer Tempels und der Assimilation der in der Stadt ansässigen Priesterschaft kam es auch zur Aufnahme alter kanaanäischer Kulttraditionen von Jerusalem. "Kein Heiligtum der kanaanäischen Welt hat Israel vor die Aufgabe so weitreichender Rezeptionen gestellt wie die mit höchsten Gottesaussagen und Kulttraditionen ausgestattete alte Jebusiterstadt Jerusalem."44
Verschiedene Stellen im AT45können für Versuche herangezogen werden, Spuren und Motive dieses Kultes aufzuspüren. Doch es wird sich nicht in jedem Fall entscheiden lassen, an welcher Stelle alte Traditionen vorliegen, oder wo eigenständige israelitische Motive oder Weiterentwicklungen vorliegen.
Die Aufnahme und Verarbeitung dieser Traditionen brachte eine nicht zu unterschätzende Erweiterung der Gottesvorstellungen und der Religion Israels mit sich.Nach Gn 14,18-20 kann als Stadtgottheit von Jerusalem El æljon angenommen werden, dessen Priester Melchisedek auch König der Stadt war.'El ist im ugaritischen Pantheon der König, der Schöpfer der Erde und Vater Menschheit46. 'El thront auf einem Berg, auf dem Flüsse entspringen.47Dieser Gott hatte in Kanaan verschiedene lokale Erscheinungsformen (El-Schaddaj von Mamre, El-Olam von Beerseba, El-Roi von Lahaj-Roi, El-Berith von Sichem etc.) 'El `æljon kann mit gewisser Sicherheit als lokale Erscheinungsform des kanaanäischen 'El angesehen werden, wenn auch im AT Gn14 die einzige Stelle ist, an der die volle Namensform _____ _¿ genannt wird48.49. An anderen Stellen steht nur `æljon, die meisten davon finden sich in kultischen Texten. Deshalb können wohl die `æljon-Aussagen des AT alle auf das Jerusalemer Heiligtum dieses Gottes bezogen werden50.
Die Identifikation Jahwes mit 'El æljon brachte es mit sich, daß dessen Bezeichnungen auch auf Jahwe übergingen. So wird die Bezeichnung Jahwes als _____ ___ (Ps. 24,7.10) darauf zurückzuführen sein, daß 'El als der höchste Gott, als "Himmelskönig" verehrt wurde.
Zu der Vorstellung von Jahwe = _____ gehört also auch die Vorstellung vom Thronen Jahwes auf Wolkenhöhen (Jes 14,14) und über allen Göttern. Und auch die Vorstellung vom Zion des Psalters gehört in diesen Zusammenhang. Der Zion des Psalters ist eine Kombination verschiedener Vorstellungen aus der kanaanäischen und mesopotamischen Umwelt. Die Bezeichnung des Zion als Götterberg findet sich im AT außer im Psalter nur noch in der eschatologischen Prophetie51. Dieser Berg, sein heiliger Berg, schön sich erhebend, ist die "Wonne der ganzen Welt". Er wird bezeichnet als äußerster Winkel des ____. In den anderen Zionsliedern des Psalters werden noch Quellen/Ströme erwähnt52.
Der Zaphon ist in der kanaanäischen Mythologie der Gottesberg, auf dem Alijian Baal wohnt. An diese Vorstellung des Tempelberges als Gottesberg knüpfen sich Vorstellungen von der Sicherheit und Uneinnehmbarkeit der Stadt, die aufgrund ihres Hangs zur Verabsolutierung Angriffspunkt prophetischer Kritik wurden: Jahwes Anwesenheit auf dem Zion garantiert die Unverletzlichkeit der dadurch geheiligten Stadt. Jahwe hat die Stadt gegründet und erweist sich als ihr Schutz. Die Unverletzlichkeit zeigt sich nach außen in den Befestigungen der Stadt. Die Überlieferung vom Abwehr des Ansturms der Völker durch Jahwe ist ein weiteres Motiv für die Sicherheit der Stadt.
3.1.2. Die Nähe Gottes als freie Entscheidung Jahwes - Jahwes Erwählung des Tempels in der Sicht des Deuteronomiums
Wenn das Deuteronomium von Gottes Verhältnis zu seinem Heiligtum redet, wird die Redewendung gebraucht, daß Jahwe die Stadt "erwählt", um seinen Namen dort wohnen zu lassen (Dt 12,5. 11. 14. 18. 21. 26; 15,20; 14,23. 24.25.26 u.ö.)53. Himmel und Erde können Jahwe nicht fassen, und doch hat er sich einen Ort auf Erden erwählt, wo er sich finden läßt von denen, die ihn suchen. Diese Erwählung ist nicht getrennt von der Erwählung Israels zu verstehen, das Jerusalemer Heiligtum steht als Teil für das ganze erwählte Volk.
Der Tempel ist ein Zeichen dafür, daß die Heilsgeschichte an einen gewissen Abschluß gekommen ist. Der Tempel ist damit ein Teil der Geschichte des Volkes. Er ist der Ort, wo das erwählte Volk zusammenkommt als Volk Gottes. Im Kult vergegenwärtigt sich das Volk das Volk der Heilstat Jahwes. Gleichzeitig ist er der Ort der Entscheidung gegen den Götzendienst und der Entscheidung für Jahwe, der sich für das Volk entschieden hat.
"Der Tempel ist nicht nur Schlußstein im Bau der Heilsgeschichte, sondern zugleich auch Prüfstein für die Wahrheit der geschichtlichen Gottesnähe. Er ist Zentrum der deuteronomischen Konzeption von der Gottesnähe, aber kein Dingzentrum, kein Sicherheitszentrum, sondern kritisches Zentrum, Fragezentrum, persönliches Zentrum."54
Daß die Zusage des Wohnens nicht getrennt vom Bund zwischen Jahwe und Israel gesehen werden kann, daß diese Zusage an die Einhaltung des Bundes geknüpft ist, wird deutlich bei Jeremia (7,3f.):
So spricht Jahwe Zebaoth, der Gott Israels: Bessert eure Wege und eure Taten, dann will ich bei euch wohnen an diesem Ort.
Vertraut nicht auf die Lügenworte, die sagen: Tempel Jahwes, Tempel Jahwes, Tempel Jahwes ist dies.
Er knüpft dabei an an Jahwe Zebaoth, den Gott der Lade, an eine Gottesvorstellung also, die nicht an einem festen Ortsheiliigtum hängt.
Als Beispiel dafür, daß eine Zusage des Wohnens auch rückgängig gemacht werden kann, verweist Jeremia auf das Heiligtum von Silo. Und ebenso wird auch die Zusage für den Tempel in Jerusalem zurückgezogen, wenn das Volk den Bund nicht einhält.
3.2. Der Tempel als Ort des Kultus
Der Tempel, sei es in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes als heiliger Ort oder aber als festes Bauwerk (welches wiederum an einem heiligen Ort errichtet wurde) ist Ort des Kultus, also der bewußten und wiederholten Reaktion der Menschen auf die Begegnungen mit dem Heiligen in festen Kulthandlungen55. Diese Kulthandlungen sind Offenbarungen der geheimen Kräfte in der Weltordnung mit dem Ziel der Erlangung und Erhaltung von Leben im weitesten Sinn56, also der Sicherung von Fruchtbarkeit und Gesundheit von Äckern, Vieh und Menschen, der Nahrungsvorsorge, aber auch der Stärkung und Sicherung der im Kult vereinten menschlichen Gemeinschaft. Der Kult ist göttlich gestiftet und aus diesem Grunde wirksam.
3.2.1. Opfer als Hauptteil des Kultus
"Für das AT deckt sich der Kult nahezu mit den Opfern"57, kann L.Köhler in seiner Theologie der AT mit nicht ganz ohne Berechtigung schreiben.
Das Opfer ist ein in allen Religionen verbreitetes Phänomen, eine Religion vollständig ohne Opfer ist kaum vorstellbar. Es ist eine rituelle Handlung, bei der der Mensch durch die Zerstörung lebender oder sonstiger machthaltiger Wesen in Kontakt oder Gemeinschaft mit unsichtbaren Kräften zu kommen und sie zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Wichtig ist dabei nicht die Gabe als solche, sondern die Einbindung in einen Ritus58. Wichtig ist einerseits die Machtwirkung, die dem Opfer zugeschrieben wird. Daneben ist aber auch die Stiftung einer Gemeinschaft unter den Menschem vor Gott durch das Opfer bedeutsam. Ein Opfer kann aber auch als eine Gabe gesehen werden, bei dem der Gebende den Beschenkten zu Gegengaben veranlassen will. Deutlich wird dieses Moment besonders in Gelübden, wo das Opfer erst erfolgt, wenn die Bitte erhört worden ist.
Über die Herkunft oder göttliche Stiftung des Opfers ist aus dem AT so wenig zu entnehmen wie aus anderen altorientalischen Quellen59.
3.2.1.1. Opfer im kanaanäischen Kult
Das ugaritische Keret-Epos gibt eine ausführliche Schilderung eines Opfers60:
Du sollst dich waschen und schminken
Wasche deine Hand (bis zum) Ellenbogen [Deine] Fin[ger] bis zur Schulter! Tritt ein [in den Schatten des ...], Nimm ein Lam[m in deine Hand], Ein [Op]ferlamm [in] deine Rechte, Ein Zicklein aus [der Viehhürde]! Alles von [der Speise] für Gäste! Nimm ein ..., einen Opfervogel, Gi[eß in den Po]kal aus Silber Wein, In den Pokal aus [Go]ld Met! Steige auf die Plattform des [Tur]mes, Ja, auf die Plattform des [Tur]mes! Setz dich rittlings (?) auf die Zinne der Mauer! Erhebe deine Hand zum Himmel, Opfere dem Stier, deinem Vater El, diene Baal durch dein Opfer, dem Sohn Dagans durch deine Speise! Dann möge herabsteigen Keret vom Dach...
Diese Anweisung erhält der König Keret im Traum. Das Opfer wird von El als Gegenleistung dafür verlangt, daß er Keret zu neuer Nachkommenschaft verhilft.
Die in ugaritischen Texten gebrauchte Opferterminologie weißt große Ähnlichkeiten mit hebräischen Vokabeln auf: So werden neben dem allgemeinendbh(entspricht ___)slm (hebr.:_____), kll(=___) undsrpverwendet.srphat zwar keine sprachliche Entsprechung, ist aber sachlich dem hebräischen Brandopfer gleich61.
In punischen Opfertarifen62 finden sich genaue Anweisungen, was bei verschiedenen Gelegenheiten geopfert werden soll. Darin werden drei verschiedene Formen des Opfers genannt: kalil, sewa'at und selem kalil. Dabei haben zwei Bezeichnungen sprachliche Entsprechungen im Hebräischen:kalildürfte dem Hebräischen ___ entsprechen, also ein "Ganzopfer" sein, das ganz auf dem Altar verbrannt wird. Die Deutung vonselem kalilist schwierig. Wahrscheinlich handelt es sich hier um ein eine Kultfeier abschließendes Schlußopfer oder aber um ein Ersatzopfer63.sewa'atscheint ein Bitt- oder Sündopfer64zu sein, daß, sofern es mit einer Opfermahlzeit verbunden war, seine sachliche Entsprechung im hebräischen _____ hätte.
Als Opfermaterialien werden Rinder, Schafe, Jungziegen, bestimmte Gazellenarten, pflanzliche Opfer und Wein und Honig als Trankopfer in den Tarifen aufgeführt.
Eine Rolle spielten auch Kinderopfer, wenngleich sie in der Texten von Ugarit nicht erwähnt werden. Dafür wurde die Bezeichnungmlk= Darbringung verwendet65. Dieses Opfer wird als Dankopfer, als Erfüllung eines in der Not abgelegten Gelübdes und in der Hoffnung auf künftigen Segen dargebracht. Es war wohl keine regelmäßige Institution, sondern nur bestimmten Anlässen vorbehalten, wobei statt der Darbringung des Kindes auch ein Ersatzopfer dargebracht werden konnte66.
3.2.1.2. Opfer im AT
Alle Formen des Opfers im AT lassen sich in zwei grundlegende Arten einteilen67: Gemeinschafts- und Gabe-(Huldigungs-/Verehrungs-, aber auch Sühne-) Opfer.
Im Gemeinschaftsopfer (___ - ein Schlachtopfer und auch _____ = "Dankopfer" bei Luther) wird im Mahl eine Gemeinschaft bewirkt. Die Kultgemeinde findet Gemeinschaft untereinander und mit Gott, der einer der Teilnehmer am Mahl ist. Die Gemeinschaft begründet ein "Schutz- und Trutzverhältnis"68: Gott und Menschen bekennen sich zueinander, gehen einen Bund ein.
Kann man diese Form des Opfers schon für die Zeit der Wüstenwanderung voraussetzen, wie dies z.B. aus der Perikope Ex 18,1-12 gelesen werden kann: ____¿_ ______ (___) ___ ___ ____ ____?.
Israeliten und Midianiter opfern gemeinsam "vor Gott" und schließen damit eine Gemeinschaft. Für das Alter der Überlieferung spricht die Tatsache, daß das Verhältnis von Israeliten und Midianitern schon seit der Richterzeit ein gespanntes war (vgl. Ri 6ff.). Die Erwähnung des Brandopfers ist wohl ebenso wie die Hinzufügung Aarons in V 12b eine spätere Ergänzung69.
Vorausgesetzt ist aber wie für jedes Opfer eine feste Opferstätte (in dieser Perikope der Gottesberg der Midianiter), daß man die Bedeutung des Opfers für die Stufe der Wandergesellschaft nicht zu hoch ansetzen sollte70.71.
Anders ist der Sinn des Gabeopfers: Gott ist Empfänger einer Gabe und wird dadurch als Herr anerkannt. Die Gabe ist eine Leistung, deren Erbringung Pflicht ist, von der man aber auch Gegenleistung erhofft. Das führt zur Tendenz, Opfer zu häufen, um sich der Gegenleistung umso sicherer zu sein. Gabeopfer können Brandopfer (___), auch als Ganzopfer (___) und Speiseopfer (____) sein. Aber auch Trank- und Räucheropfer sind bezeugt72.
Gabeopfer sind mit großer Sicherheit erst in Kanaan in den Kult Israels aufgenommen worden. So sind Brandopfer nur im westsemitisch-kanaanäischen Raum üblich, aber nicht in Ägypten oder Mesopotamien.
Über die zu beachtenden Riten und Ordnungen bei Opfern gibt es genaue Anweisungen, die uns im AT vorliegen. Was dagegen fehlt, ist die hinter dem Opfer stehende Geisteshaltung, das Motiv des Opfernden und die Vorstellung von Bedeutung und Wirksamkeit des Opfers. So bleibt "hinsichtlich dessen, was Gott beim Opfer geschehen läßt, eine Zone des Schweigens und des Geheimnisses"73.
3.2.2. Prophetische Kultkritik
In der Übernahme kanaanäischer Riten durch die Jahwereligion bestand von vornherein die Gefahr des Abfalls von Jahwe zu Baal und die Gefahr, daß Jahwe lediglich als Ersatz für Baal als Fruchtbarkeits- und Naturgott angesehen wurde.
Die Propheten machten diesen Abfall deutlich und riefen stattdessen den geschichtsmächtigen Jahwe des Exodus ins Bewußtsein. Hatte man Jahwe mit der Errichtung des Tempels an einen Ort festgelegt, riefen seine Propheten den wahren, sich auf keinen Ort festzulegenden Gott in die Erinnerung des Volkes. Es geht den Propheten nicht um eine kultlose, durchgeistigte Religion sondern um die Änderung des Volkes, was am Kult teilnimmt.
Anhand einiger weniger Stellen soll diese prophetische Kritik an Kult und/oder Tempel aufgezeigt werden.
Amos verkündet Israel die Absage Jahwes an den offiziellen Kult, wie er am Staatsheiligtum von Bethel geübt wurde (5,21-23):
21 Ich hasse eure Feste, eure Versammlungen will ich nicht riechen.
22 Auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt, und eure Speiseopfer mag ich nicht, eure Mastkälber als Dankopfer sehe ich nicht an.
23 Nimm weg von mir den Lärm deiner Lieder, das Spiel deiner Harfe will ich nicht hören.
Als Forderung verkündet er dagegen, daß Recht (____) und Gerechtigkeit (____) im Volke sprudeln sollen.
Amos kritisiert den aufgeblähten Kult, hinter dem die Vorstellung steht, daß man sich Gott mit dem Darbringen von Opfern sicher sein kann, den Kult, der vergißt, daß hinter dem Opfer der Bund Jahwes und seinem Volk stehen muß. Nicht auf eine grundlegende Ablehnung des Kultes will Amos hinaus, sondern auf eine Rückbesinnung auf Jahwe, den Gott der sich in der Geschichte Israels offenbart hat.
Diesen Gott gilt es neu zu suchen74, aber nicht an heiligen Orten und in überlieferten Bräuchen, sondern in der Geschichte und im Beachten seines Bundes. Amos stellt die polemische Frage, ob Israel in der Zeit der Wüstenwanderung denn Opfer dargebracht habe.
Recht und Gerechtigkeit sind das Jahwe gemäße Verhalten und nicht das Anhäufen von immer neuen Opfern. "Ich habe Gefallen an Gnade (___) und nicht an Opfer (___), an Gotteserkenntnis und nicht an Brandopfer", sagt Hosea (Hosea 6,6), der in seinem Anliegen dem Amos verwandt ist. Und Micha stellt als Antwort auf die Frage, wie man sich Jahwe nähern soll, ob Jahwe Gefallen an Opfern hat (Mi 6,8): "Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe bei dir sucht: Nichts anderes als Recht üben, Gnade (___) lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott."
Indem man sich an heiligen Orten oder durch schematische Kultübungen Jahwe zu nähern glaubt, entfernt man sich doch immer weiter von ihm bis zu einem Punkt, wo Jahwe mit Baal quasi gleichgesetzt wird75. Und in dieser geistigen Entfernung vom Jahwe der Geschichte wird verkannt, daß dieser Jahwe in der Geschichte weiterhin anwesend ist und sich seinem Volk im angedrohten Gericht kundtut.
4. Zusammenfassung: Tempel und Tempelkult in Israel als Beispiel für Assimilation und Umformung kanaanäischer Einflüsse in der Religion Israels
Israel hat den Tempelkult aus seiner kanaanäischen Umwelt übernommen. Diese Übernahme war nicht unproblematisch: Waren die kanaanäischen Gottheiten Naturgottheiten, die sich an festen Orten offenbarten, so war Jahwe als Gott der Geschichte in das Leben seines Volkes getreten. Er offenbart sich nicht im Raum sondern in der Zeit dem Ort der Geschichte. Jahwe läßt sich nicht auf bestimmte Orte in der Welt festlegen. Das gibt der Religion Israels eine den Kanaanäern gegenüber vollkommen andere Dimension: Das Verhältnis zu Gott ist ein Verhältnis der Erwählung und des Bundes. Der Kult Israels ist ursprünglich Bekenntnis zu diesem Bund. Das Bekenntnis zu Jahwe wurde zum konstituierenden Element des Volkes Israel. In diesem Bekenntnis grenzten sie sich ab von den Kanaanäern.
Als Gott der nomadischen Midianiter hatte Jahwe von Haus aus keine Beziehung zum Kulturland und seinen Bräuchen. Trotzdem offenbart er sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als Gott der Väter, der Israels Vorfahren Land und Nachkommenschaft verhießen hat. Als Gott des Volkes Israel mußte er seine Macht gegenüber den Göttern der Kanaanäer erweisen. Er mußte deren Funktion als Garant der Ordnung der Natur wahrnehmen, um ihnen gegenüber bestehen zu können und er mußte dabei seine Eigenständigkeit bewahren.
Das Volk Israel stand dabei immer in der Gefahr des Abfalls von Jahwe zugunsten der kanaanäischen Götter. So wurden Kulthandlungen der Kanaanäer aufgenommen und in Beziehung zu Israel gesetzt. Der Kult wurde ausgeübt an Heiligtümern, die schon die Patriarchen von den Kanaanäern übernommen und deren Legenden sie umgeformt hatten.
Waren die Israeliten erst ein religiöser Stämmebund, so wurden sie durch die Einführung des Königtums unter dem Druck der Philisterkriege zu einem Volk wie die anderen Völker. Der Bund Jahwes mit seinem Volk wird ergänzt durch die Erwählung des Königs, der als Sohn Gottes per adoptionem gilt.
Mit der Erwählung Davids geht die Erwählung des Zion parallel. Jahwe erwählt einen Ort in Israel, wo er bei seinem Volk wohnen will.
Damit ist rein äußerlich kaum noch ein Unterschied zwischen Jahwe und den kanaanäischen Göttern zu erkennen: Er ist an einem festen Ort ansässig geworden, wo man ihm dient. Er wird angesehen als Gott, der für die Fruchtbarkeit der Natur zuständig ist und dem man deshalb Opfer bringt.
Doch das Element des Bundes wird in der Verkündigung der Propheten wieder aufgegriffen: Der Tempelkult mit seinen zahlreichen Riten ist nichts, wenn nicht der ursprüngliche Bund eingehalten wird. Die Geschichte Israels deuten sie als Gericht Jahwes an seinem Volk, das dem Bund vom Sinai untreu geworden ist. Die Zusage der Nähe Gottes bezieht sich nicht auf die Nähe im Raum seines Tempels sondern auf seine Nähe im Handeln der Geschichte.
Damit ist die Abgrenzung von den anderen Völkern wieder deutlich gemacht. Gleichzeitig war damit die Grundlage für das Überleben der Jahwereligion auch nach dem Ende der Staaten Israels und Judas gegeben.
Literaturverzeichnis
1. Quellen und Nachschlagewerke
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2. Kommentare
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3. Sonstige Literatur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1O.Eißfeldt, "Jahve und Baal" in: Kleine Schriften zum Alten Testament, S. 313-324.
2J.Hempel, Der alttestamentliche Gott S.63f.
3ebd.
4A.Alt, Der Gott der Väter, in: Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, S.28.
5Alt, ebd. S.61.
6W.H.Schmidt, Atl. Glaube S.46,
7zit. nach Beyerlin, Textbuch S.220.
8Der Unterschied zwischen dem irdischen Tempel und dem himmlischen Heim ist dabei so zu sehen, daß der Tempel die irdische Entsprechung des himmlischen Sitzes ist.
9s. ThWAT I Sp. 634f.
10ThWAT II Sp409f.
11außer Esr 5.14, wo der Tempel in Babel gemeint ist.
12Zu beobachten ist, daß ____ _¿___ nie in Parallelismus mit ____ ___ steht.
13BRL2 S.333.
14Einteilung nach Kuschke in: BRL2 S.334f.
15nach Kuschke (BRL2 S.337) beheimatet in Nordsyrien. Beispiele sind unter anderem die Anlagen vonMumbaqat, Hazor, Megiddo.
16Als älteste Beispiele können die Anten-Tempel vonTell el Huweraaus der FB III-Zeit gelten. Besonders der sogenannte "Außenbau" zeigt schon alle Merkmale, die später weiter entfaltet wurden.
17Anten: Verlängerung der Längsmauern über die Frontwand der Cella hinaus.
18so z.B. bei den Anlagen von Engedi, dem Doppel-Breitraum-Tempel von Megiddo oder auch der sogenannten "Zitadelle" von Ai. (Zu der Deutung der Funde von Ai vgl. G.E.Wright, The Significance of Ai in the third Millenium B.C. in: Archäologie und AT S. 299- 319, bes. S.306-313.)
19Nicht eingehen kann ich hier auf die Diskussion, ob die Quadratbauten als Tempel zu identifizieren sind oder ob die gefundenen Gebäude andere Bestimmung hatten. Vgl. dazu Kuschke in BRL2 S.336.
20Dabei ist zu beachten, daß sich diese Einteilung aufgrund der Fundergebnisse nur eine Typologie der Grundrisse sein kann. Bei den ausgegrabenen Anlagen sind meist nur geringe Reste der aufgehenden Mauerwerks erhalten und Informationen aus literarischer Überlieferung sind in ihrer Interpretation umstritten, da die Bedeutung bautechnischer Fachausdrücke oft unbekannt ist (was seinerseits mit dem Fehlen archäologischer Beispiele zusammenhängt.) (Kuschke, BRL2 S.333).
21Auch Kulthöhen konnten mit Gebäuden versehen sein. s. dazu P.Welten in BRL2 S.194f. Welten bezeichnet diese Höhen als Tempelhöhen im Unterschied zu Kulthöhen. Ein Beispiel dafür ist die Tempelhöhe von Arad, die oft als Tempel bezeichnet wird.
22BRL2 S.333.
23ebd. Ausnahmen davon sind u.a. die zwei Tempel von Ugarit.
24Durch die Bedeutung der Religion für alle Lebensbereiche hat auch das Königtum als wichtigste weltliche Ordnungsmacht religiöse Bedeutung. Der König gilt als von den Göttern eingesetzt (der König als adoptierter oder leiblicherr Sohn Gottes!) und hat demzufolge die höchste Verantwortung für den Kult. Er ist Mittler zwischen Gott und Mensch, indem er einerseits die Gottheit auf Erden vertritt und andererseits die Menschen vor Gott. An seinem Verhalten entscheiden sich Segen und Fluch der Götter für das ganze Volk.
25z.B. A.Alt, Verbreitung und Herkunft des syrischen Tempeltypus (Kl.Schriften zur Geschichte Israels II 100-115).
26BRL2 S.340.
27Zur Orientierung von Tempeln vgl. Möhlenbrink, Der Tempel Salomos, S.79-85. Möhlenbrink vertritt die Annahme, daß Tempel in Syrien-Palästina gemäß assyrisch-babylonischem Vorbild nach der Hauptwindrichtung ausgerichtet wurden.
28BRL2 S.338.
29BRL2 S.341.
30G.v.Rad weißt in seinem Aufsatz "Zelt und Lade" (Gesammelte Studien zum Alten Testament S. 109-129) nach, daß die Vorstellungskomplexe von Zeltheiligtum und Bundeslade erst sekundär vereint worden sind. Vielmehr gehören beide Komplexe zu unterschielichen Stadien der Religionsgeschichte. Auf der einen Seite spricht man im Zusammenhang mit der Lade von "Jahwe, der auf den Cheruben thront",redet, man Gott also als immer anwesend betrachtet, ist das Zelt ein Zelt der Begegnung, zu dem Jahwe von oben in einer Wolke harabkommt, um den Menschen zu begegnen. Die Lade stammt für Rad aus dem Kulturland. Mit ihr sieht er das Moment der Gegenwart Gottes in die Religion Israels kommen. Die Lade wird dadurch auch zum Kristallisationspunkt, an dem aus unterschiedlichen Stämmen ein Volk Israel wird. Und außerdem hängt an der Lade das Element der kultisch-religiösen Freude, des Lobsingens und Dankens vor Jahwe (S.128f).
31Das kanaanäische Heiligtum des El Bethel wurde durch die Gleichsetzung von El und Jahwe zu einem israelischen Heiligtum. Seine Gründung wurde auf Jakob zurückgeführt. Wenn sich die Stellen Gn 28,10ff und Gn 12,8 auf den gleichen Ort beziehen, könnte dieses Heiligtum östlich von Bethel (etwa in Burg Betin) vermutet werden. Diese Hypothese stellt M.Wüst in BRL2 (S. 44f) auf. Das würde erklären, weshalb bei Ausgrabungen in Bethel keine Spuren des israelitischen Heiligtums gefunden wurden.
32Bei Ausgrabungen fand man eine bis in römische Zeit benutzte Kultstätte. Aus der Eisenzeit stammt ein als Kulthöhe interpretierter Bau, der mehrfach umgebaut wurde. Es handelt sich dabei um mit Steinen aufgefülltes Rechtec bzw. Quadrat, welches stellenweise bis zu 1,5 m hoch ist. Im 9.Jh. war die Anlage von einem Hof umgeben, später wurden Treppen als Zugang angelegt. Südlich der Treppe wurde ein Hörneraltar gefunden. (vgl. H.Weippert in BRL2 S. 55f) A.Kuschke, Tempel (BRL2 S.337f) hält für ein Heiligtum in Dan allerdings nur eine Klassifikation als Tempelhöhe für möglich, da es sich hierbei um ein Grenzheiligtum gehandelt habe.
33BRL2 S.267.
34M.Wüst, Arad in: BRL2 S.11f. vgl. dazu Cornfeld/Botterweck, Die Bibel und ihre Welt S.117-121.
35Y.Aharoni, Arad: Its Inscriptions and Temple, BA31, 1968 S.2-32, zitiert nach Wüst, Arad in: BRL2 S.12.
36Wüst ebd.
37W.H.Schmidt, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, S.249; so auch G.v.Rad, Theologie I S. 53.
38so O.Eißfeldt in: Jahwe, der Gott der Väter (Kleine Schriften S.259-271).
39Rad, Theologie I.S.57f; H.Schmid, Jahwe und die Kulttradition von Jerusalem s.175. H.Schmid stellt dort die Vermutung auf, daß in dem "Engel", der in Vs.16a u.17 genannt wird, eine vorisraelitische Gottheit stehen könnte, wenn dies auch aus dem vorliegenden Text allein nicht geschlossen werden könne. In "Der Tempelbau Salomos in religionsgeschichtlicher Sicht (Archäologie und Altes Testament S.241-250) sieht er in 2Sam 24,16 den eigentlichenieros logos für ein Jerusalemer Heiligtum (S.246). Ursprünglich sieht er hinter dem Pestengel eine eigenständige Pestgottheit, wie etwa dem aus Ugarit bekannten Rescheph, der El untergeordnet war. Durch die Ersetzung Els durch Jahwe wurde aus diesem Pestgott ein Engel Jahwes, "in dem sich Jahwe manifestierte wie vielleicht El in Rescheph". (ebd.)
40H.Schmid, Der Tempelbau Salomos a.a.O. S.246.
41Schmid ebd.
42G.E.Wrifht, Biblische Archäologie S. 136.
43Modelle von Götterschreinen sprechen dafür, daß diese Säulen freistehend vor dem Tor standen. Doch ist es auch denkbar, daß diese Säulen analog zu Stützsäulen beim Tempel vontell ta'yinatoder auch vonMumbaqatdas Dach der Vorhalle stützten. (vgl. dazu Kuschke, Tempel in BRL2 S.340).
44Kraus, Psalmen I, S.96f.
45außer den Zionsliedern Ps.46;48;76 und anderen Psalmen, die speziell Jerusalem verhaftet sind (z.B. 84;87;122;132) kommen dafür Anspielungen in prophetischen Texten (z.B. Jes.1,21ff; 6;8,6.18;28,14ff; bzw . bei Deuterojesaja 52,1f.7ff u.a.) und teilweise auch altorientalische Quellen in Betracht. s. W.H.Schmidt, Alttestamentlicher Glaube, S.251.
46Von ihm heißt es in Gn14,19.22, daß er __¿__ __¿_ ___ ist. Dabei wird ___ als Schöpfungsterminus im Sinne von: hervorbringen, erschaffen zu verstehen sein. Durch das Hervorbringen wird der Besitz an einer Sache erworben (so H.Schmid, S.181.).
47vgl. H.Schmid, Jahwe und die... S.180f.
48Zobel, ThWAT VI.Sp145. In den Qumranschriften findet sich die Bezeichnung 'el `æljon ebenfalls, so in 1QH 4,31;6,33 u.ö.
49El kommt außerbiblisch in Parallelität mit `æljon vor, auch wenn die direkte Bezeichnung 'El `æljon in keiner außerbiblischen Quelle genannt wird. (Inschrift auf der Stele von Sudschin: "... und vor der Siebengottheit und vor El und `æljon und vor dem Him(mel)" zit.n.H.Schmid, Jahwe und die... S.179.).
50Zobel, `æljon. in: ThWAT VI.Sp.146f.
51so z.B. Jes.2,2-4//Mi 4,1-4 (der Zion wird zum höchsten Berg, auf dem Jahwe residiert). Ob man aber schließen darf, wie dies Wanke (S.66 f.) tut, daß eine Übertragung außerisraelitischer Motive auf den Zion nur für die exilische und nachexilische Zeit nachzuweisen ist, bleibt dahingestellt. Wanke macht selbst auf die unsichere Datierung der Jes//Mi-Stelle aufmerksam.
52so Psalm 46,5
53Da Jahwe im Himmel wohnt (Dt 4,36; 26,15), wird als Zeichen für Jahwes besondere Nähe der Ausdruck vom Wohnenlassen des Namens gebraucht.
54M.Schmidt, Prophet und Tempel, S.97.
55RGG3 Sp. 121.
56ebd. Sp.123.
57L.Köhler, Theologie des AT4 , S. 172.
58A.Schimmel, Opfer, in: RGG3 Iv. Bd. Sp. 1637.
59wenn man von dem sumerische Mythus "Enki und Ninmach" über die Erschaffung des Menschen absieht, den man als Stiftung des Opfers ansehehen kann: Die Götter erschaffen den Menschen, damit der für den Untehrhalt der Götter sorgen soll. (vgl. Beyerlin, Textbuch S.102f)
60I K 62-80 zit. nach Beyerlin, Textbuch S. 241f.
61Ringgren, Religionen S.231.
62s. AOT S.177-179.
63Ringgren, Religionen des AO, S.231f.
64Ringren, a.a.O. S. 232.
65Kraus, Psalmen I, S. 96 möchte dagegen am Bestehen einesmlk-Kultes als Kult einer Naturgottheit unter der Urbevölkerung Jerusalems festhalten.
66ThWAT IV Sp. 963f.
67L.Köhler, Theologie S.172. vgl. dagegen Zobel/Beyse S. 282ff., wo eine Einteilung in drei Arten von Opfern vorgenommen wird. Beim Gabeopfer wird unterschieden zwischen einer Gabe an Jahwe und einem Sühneopfer.
68Köhler, a.a.O. S.173.
69W.H.Schmidt, Altt. Glaube S.73.
70Zobel/Beyse S.282.
71Unklar ist die ursprüngliche Bedeutung des sicher aus der Hirtenzeit stammenden Passa. Mögliche Ursprünge können ein Opfer oder aber ein mit einer Mahlzeit verbundener Blutritus sein (Zobel/Beyse S.282).
72Zum Gabeopfer gehört auch das Kinderopfer, daß mit dem Ausdruck ____ "als Darbringung" bezeichnet wird. Es hat ebenso wie im phönizischen Ursprungsland dem Charakter einer extremen Klage- und Bittzeremonie (vgl. 2Kön 3,27). Doch wurde dasmlk- Opfer als dem Wesen Jahwes fremd verurteilt und verboten. Ebenso wie bei den Phöniziern war es nie Teil des offiziellen Kults.
73G.v.Rad, Theologie I S.259.
74Suchet Jahwe, damit ihr lebt, aber sucht nicht in Bethel und in Gilgal 5.4f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der ursprüngliche Kontext der Religion Israels?
Israels Religion entwickelte sich aus den Traditionen nomadisierender Stämme, die sich mit den kanaanäischen Religionen auseinandersetzten. Dies führte zu einer synkretistischen Religion, die Einflüsse aufnahm und umformte, um den Jahweglauben anzupassen.
Wie beeinflusste der Tempel Salomos die israelitische Religion?
Der Tempel Salomos zentralisierte den Kult und festigte Jerusalem als religiöses Zentrum. Er beeinflusste das Gottesbild, indem er Jahwe an einen Ort band, was sowohl die Nähe zu Gott als auch die Gefahr der Verfestigung des Kults mit sich brachte.
Welche Rolle spielte der Tempel als Ort der Nähe Gottes?
Der Tempel wurde zum Ort, an dem man Gott aufsuchen und mit ihm in Kontakt treten konnte. Die Zionstheologie des Psalters betont die Nähe Gottes als Garant der Sicherheit Jerusalems. Das Deuteronomium sieht die Erwählung des Tempels als freie Entscheidung Jahwes, aber auch als Prüfstein für die Wahrheit der geschichtlichen Gottesnähe.
Welche Bedeutung hatte der Tempel als Ort des Kultus?
Der Tempel war der zentrale Ort des Kultus, der durch bewusste und wiederholte Reaktionen auf Begegnungen mit dem Heiligen in Kulthandlungen geprägt war. Opfer spielten dabei eine zentrale Rolle, sowohl als Gemeinschafts- als auch als Gabeopfer.
Wie gestaltete sich die prophetische Kritik an Kult und Tempel?
Propheten kritisierten den aufgeblähten Kult und forderten eine Rückbesinnung auf den Jahwe-Bund. Sie prangerten die Gefahr des Abfalls von Jahwe zugunsten der kanaanäischen Götter an und betonten die Bedeutung von Recht, Gerechtigkeit und Gnade gegenüber bloßen Kulthandlungen.
Welche kanaanäischen Einflüsse gab es im israelitischen Tempelkult?
Israel übernahm Elemente des kanaanäischen Tempelkults, wie z.B. bestimmte Opferzeremonien und die Vorstellung von Jahwe als Gott, der für die Fruchtbarkeit der Natur zuständig ist. Diese Übernahme war aber nicht unproblematisch, da Jahwe ursprünglich als Gott der Geschichte in das Leben seines Volkes getreten war und sich nicht auf bestimmte Orte festlegen ließ.
Was waren die religionsgeschichtlichen Voraussetzungen für den Tempelbau?
Die Religionsgeschichte Israels beruht auf der Erwählung des Volkes durch Jahwe und den damit einhergehenden Ereignissen des Auszugs und der Vergabe des Gesetzes am Berg Sinai. Mit dem Eindringen in das Kulturland schlossen sich die Stämme den Kulten an den kanaanäischen Heiligtümern an, indem sie die dort verehrten Gottheiten ihren Göttern gleichstellten.
Was sind die Kernpunkte des frühen Jahweglaubens?
Der Jahweglaube beinhaltet, dass Jahwe in der Exodustradition als Gott der Verheißung erscheint, der die Menschen in die Freiheit führt. Zusätzlich ist Jahwe ein Gott, der an einem Berg wohnt bzw. dort erscheint. Seine Theophanie vollzieht sich im Naturgeschehen und schließt einen Bund, bei dem sein göttliches Recht verkündet wird.
Welche verschiedenen Tempeltypen gab es in Syrien-Palästina?
Die Tempel konnten in 4 Typen eingeordnet werden: Langraumtempel, Breitraumtempel, Knickachsbau und Quadratbau. Der Langraumtempel, besonders der Antentempel, wurde im Laufe der Zeit zum vorherrschenden Tempeltyp in Syrien-Palästina.
Was waren die geschichtlichen Grundlagen des Tempelbaus unter Salomo?
David begann mit der Zentralisierung des Kultes durch die Überführung der Lade nach Jerusalem. Die Priester des 'el æljon von Jerusalem wurden in den Jahwekult übernommen, was zur Identifikation von Jahwe mit 'El æljon führte.
- Arbeit zitieren
- Raimund Nitzsche (Autor:in), 1993, Der Einfluß des syrisch-kanaanäischen Tempels auf die Religion Israels, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96044