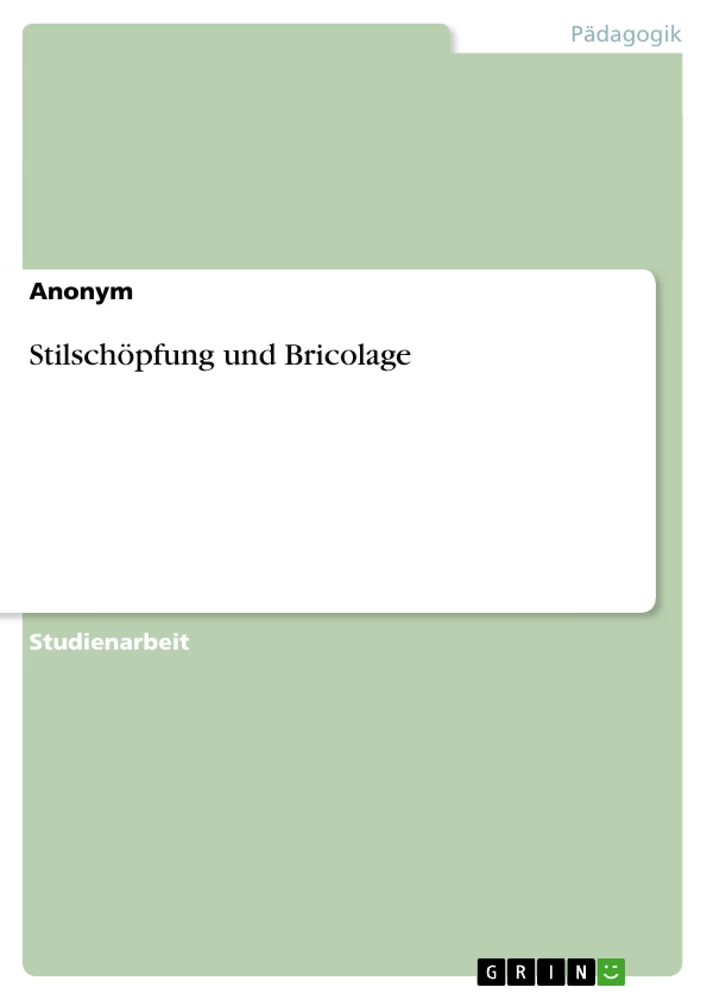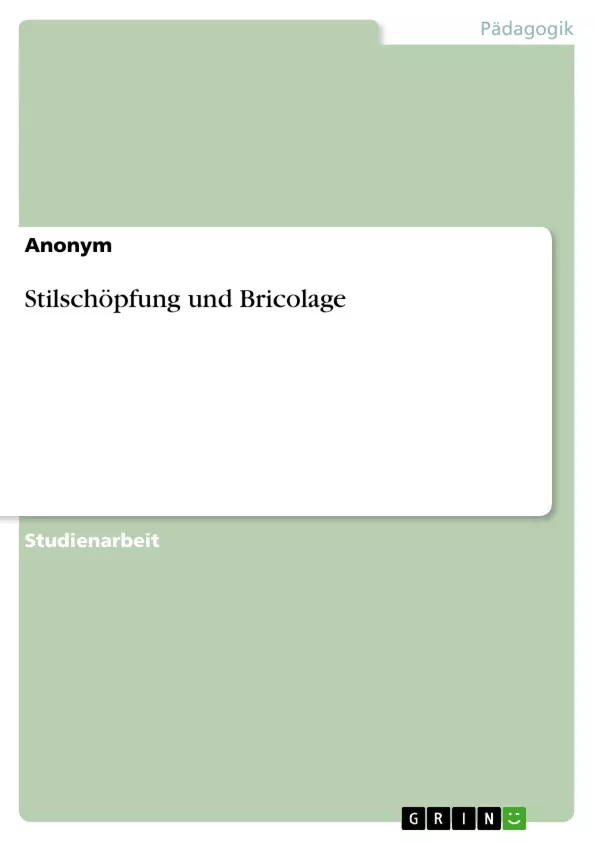Stilschöpfung und Bricolage
1. Einleitung
Der Begriff „Jugendkultur“ zielt auf die Darstellung zweier Sachverhalte ab, die durch ihre Gegensätzlichkeit den Begriff selbst paradox erscheinen lassen: Zum einen wird durch ihn die Alltagswelt von Jugendlichen beschrieben, zum anderen sollen fungiert er zur Erläuterung für von den Jugendlichen selbstentwickelten Alternativ- oder Alltagsfluchtwelten, die sich zumeist als deviant und gegenkulturell definieren. Insofern ist der Begriff durchaus als nicht unproblematisch anzusehen, soll aber im weiteren dennoch verwendet werden, zumal er sich in der wissenschaftlichen Rede über Jugend etabliert hat.
Als erste, gemäßigt deviante Jugendkultur bildete sich zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts die Gemeinschaft der Wandervögel heraus. Die Kernintentionen dieser der bürgerlichen Schicht entstammenden Formation wie der Rückbezug zur Natur kennzeichnet indes nicht ihr gegenkulturelles Moment. Dieses besteht vielmehr in der relativen Autonomie der Wandervögel, sie unterstanden keiner staatlichen oder kirchlichen Obhut. Zwar war der Anteil der seinerzeit den Wandervögeln angehörigen Jugendlichen war recht gering, „(Schätzungen gehen von 2% = 60.000 Personen aus); die Ausstrahlungskraft ihrer Ideen [...], ihrer Lebensstilmittel, ihrer äußeren (Kleidungs-) Formen ihrer neuen Aktivitäten, Geselligkeiten und Gruppenstrukturen auf das Gemeinschaftsleben der Jugend war jedoch enorm“.1
Aus dem Impuls dieser ersten deutschen Jugendkultur heraus hat sich mittlerweile eine Multiplikation der jugendlichen Szenen vollzogen, die sich einer Übersichtlichkeit und sich somit allzu einfachen Klassifizierung entziehen, einen von der klassischen Jugendforschung verwendeten, homogenen Begriff von der Jugend obsolet haben werden lassen:
„In den 90er Jahren haben sich gegenüber den 80er Jahren die diversen Jugend-Szenen noch einmal beträchtlich vermehrt und vielfältig ausdifferenziert, so daß inzwischen eine kaum mehr überschaubare Pluralität von unterschiedlichen jugendlichen Verhaltensweisen und Orientierungen, jugendkulturellen Einstellungen, Ausfächerungen und Stilisierungen vagabundiert [...].“2
Klassische jugendkulturelle Polaritäten wie Rocker versus Modernists oder Punks versus Popper sind in diesem Jahrzehnt nun nicht mehr existent; der Großteil der insgesamt wesentlich stärker individualistisch geprägten Jugend der 90er Jahre bedient sich vielmehr eklektisch der von den Jugendszenen wie von der Alltagswelt dargebotenen Potentiale, die wie, später zu erkennen sein wird, als Zeichenvorräte auszulegen sind, und deutet sie gegebenenfalls in für die personale und kollektive Identität brauchbarer Weise um.
Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen in diesem Zusammenhang bedeutsame, jugendkulturelle Begrifflichkeiten wie der bereits angesprochene Individualismus, Stilschöpfung und Bricolage, die die Verknüpfung bestehender Jugendkulturen und Ausbildung neuer Formen zu beschreiben versuchen, beleuchtet werden. Am Beispiel des Musikvideos „Stripped“ der Gruppe Rammstein soll abschließend kritisch untersucht werden, wie sogenannte Zeichenspielerei zu Mißdeutungen auf der Rezipientenseite, der Seite der Fans, führen kann. Auf einzelne Jugendkulturen soll indes nur beispielhaft eingegangen werden, denn prinzipiell sind die zu beschreibenden Phänomene allen Szenen gemeinsam.
2. Zur Individualisierung der Jugend
Die Ursachen für die zunehmende Individualisierung Jugendlicher liegen in gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Die Sozietät der 90er Jahre ist wesentlich komplexer und ausdifferenzierter als jene zu Beginn dieses Jahrhunderts. Essentieller Faktor für diese Tendenz sind Veränderungsprozesse der Arbeitswelt; hierzu zählen der Anstieg der erwerbsarbeitsfreien Lebenszeit durch steigende Lebenserwartung mit zugleich sinkenden Arbeitszeiten. Das ökonomische Wohlfahrtsmaß erfuhr in der Nachkriegszeit einen enormen Anstieg, so daß ein Nährboden für industrielle Innovationen entstand, der eine stetige Veränderung der Berufsstrukturen mit sich zog.
Konsequenz dieser Tendenz sind ein Aufbrechen traditioneller Lebenswelten und wachsende Mobilität des erwerbstätigen Teils der Gesellschaft. Die Schattenseite dieser Entwicklung liegt in der abnehmenden Bedeutung klassischer Berufsbilder und somit einem insgesamt geringer werdenden Bedarf an Arbeitsanbietern in diesen Branchen. Für die Jugendlichen bedeutet diese Tendenz neben zahlreichen Chancen in Form neuer Berufsbilder, beispielsweise im Rahmen der Informationstechnologie, jedoch auch eine permanente Unsicherheit und zwangsläufig für viele, insbesondere Jugendliche niedrigen und mittleren Bildungsniveaus, eine sinkende Identifikation mit der Arbeitswelt.
Waldemar Vogelsang stellt in seinen Ausführungen heraus, daß im Rahmen des Strukturwandels für die heutigen Jugendlichen „ursprünglich gesellschaftlich vorgezeichnete Lebenspläne individuell verfügbar (werden)“.3 Jedoch rezipiert Vogelsang diese neu entstandene Multioptionalität zu affirmativ. Er definiert Jugendkulturen als Repräsentanten „individuelle(r) Lösungen respektive produktiv-innovatorische(r) Reaktionen auf fortschreitende gesamtgesellschaftliche Individualisierungsprozesse. Sie sind eine Art „Do-it- yourself-Bewegung angesichts des Bedeutungsrückganges traditioneller Sinnoligopole und Orientierungsmächte (Familie, Nachbarschaft, Religion) bei gleichzeitiger Pluralisierung - und damit Wählbarkeit - alternativer Sinnprovinzen und Identitätsagenturen.“4 Vogelsangs Deutung, daß „Individualität und Selbstauffassung sich immer weniger über die Arbeitswelt, kollektive Normen und soziale Zugehörigkeiten (definiert), sondern ganz wesentlich auch über unermüdliche Versuche, das schier unerschöpfliche kulturelle Arsenal von Deutungsmustern, Gesinnungen und Lebensstilen zur unverwechselbaren Ich-Konstitution zu amalgamieren“5, ignoriert völlig, daß die stagnierende Identifikation über die Arbeitswelt nicht von mangelndem Interesse der Jugendlichen an diesem Thema herrührt. Der Begriff „Arbeit“ ist bei Jugendlichen zentraler Punkt der Problemwahrnehmung und insofern von essentieller Bedeutung für die jugendliche Lebenswelt.6Jedoch bieten die bereits angesprochenen, permanenten Veränderungen der Berufswelt, verbunden mit derzeit nicht sehr aussichtsreichen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt den Jugendlichen kaum Sicherheiten, so daß eine Abwendung von der Selbstidentifikation über Arbeit vielmehr aus einer Not heraus erfolgt.
Insofern erscheint die von Vogelsang vertretene Auffassung von einer frei wählbaren Lebensbewältigung, einem „Übergang von der Norm- zur Wahlbiographie, eine Transformation der sozial vorgegebenen in eine selbst hergestellte oder herzustellende Biographie“7 fragwürdig, weil sie den Jugendlichen eine allzu hedonistische und freizeitorientierte Gesinnung beimißt.
Der Einbezug ökonomisch begründeter, struktureller Wandlungen in die Analyse jugendlicher wie gesamtgesellschaftlicher Veränderungsprozesse ist unabkömmlich.
3. Aufbruch kollektiver Identitäten
3.1 Eklektizismus
Im Rahmen der angesprochenen, durch den Strukturwandel der Arbeitswelt verstärkten „latenten Tendenz zur Einzelgänger-Gesellschaft“8 gewinnen die Angebote im Bereich der Freizeit, und somit die Freizeitkultur, zu denen auch die Jugendkultur zählt, an Bedeutung. Jedoch ist auch hier eine Dekonstruktion vorzufinden:
„Jeder sucht sich das heraus, was ihm, und nur ihm, Spaß macht. Übergreifende Sinngebungen oder Jugendbewegungen braucht niemand mehr. [...] Mit den kollektiven Strukturen sterben Fraktionszwang und dogmatisches Denken. So progressiv Bewegungen wie die der 68er auch waren - sie alle tendierten dazu, ab einem bestimmten Punkt dogmatisch zu werden und die Entfaltung neuer und kreativer Ansätze zu unterdrücken. Nicht so in der ‚egotaktischen‘ Zukunft: Wo es kein verbindliches Lebensideal mehr gibt, stehen viele verschiedene Möglichkeiten gleichberechtigt nebeneinander.“9
Zwar bleiben auch hier die ökonomischen Wandlungen als Grundlage der Veränderungen weitgehend unberücksichtigt, es ist jedoch zu erkennen, daß auch in der Freizeitwelt keine monolithischen, kollektiven Identitäten mehr dominieren.
Freilich sind Anhänger „traditioneller“ Jugendszenen wie der Hippies oder der Modernists auch weiterhin noch zu finden, klassische jugendkulturelle Polaritäten sind jedoch, wie bereits angeführt, obsolet geworden, so daß auch die gesellschaftliche Bedeutsamkeit einzelner Jugendszenen geringer geworden ist, während die Ausprägung individueller Präferenzen und der personellen Identität in diesem Zuge wichtiger geworden ist. Zwar können sich Jugendliche auch weiterhin exakt einer Jugendszene zugehörig fühlen, dieses trifft insbesondere für sehr komplexe, die Identität der Zugehörigen (z. B. durch eigene Weltanschauung, Mode, Musik, Sprache, Rituale etc.) stark prägende Subkulturen wie der Gothic-Szene zu. Die Mehrheit der Jugendlichen jedoch bedient sich eklektisch der verschiedenen Szenen, so daß insbesondere in den Bereichen Mode und Musik durch Vermischungen Pluralisierungen und Hybriditäten entstehen, die sich einer eindeutigen Verortung entziehen können. Prinzipiell scheint dieses eine Kooption, eine Übernahme der Trends durch Firmen zur Überführung in Warenform zu erschweren und so der Devianz der Jugendszenen dienlich zu sein. Dem von den Jugendlichen betriebenen Eklektizismus jedoch ist immanent, daß durch die Selektion jugendkultureller Versatzstücke diese ihrer originären Bedeutung entrissen werden; sie erfahren durch die Umdeutung zu Zwecken der personellen Identität der Individuen einen Verlust ihrer Genuinität und werden so einem oberflächlichen Lifestyle dienlich, der durch Ausgrenzungsmechanismen der Szenen bekämpft wird: So ist in diesem Zusammenhang in der Skateboarding-Szene der Begriff des „Posers“ bedeutsam, er bezeichnet einen Jugendlichen, der sich optisch durch Kleidung und Skate-Ausrüstung als Skater zu erkennen gibt, jedoch den szenetypischen Habitus sowie angemessene Fahrkünste nicht vorweisen kann.
Insofern kann der von den Jugendlichen betriebene Eklektizismus eine für die Jugendkulturen fatale Folge haben, da sie im Rahmen ihrer Ausbreitung, die sie durch das Bedienen vieler Jugendlicher erfahren, an Ursprünglichkeit verlieren, ihres subversiv-devianten Potentials beraubt und auf vermarktungsfähige Warenform reduziert werden.
3.2 Die Funktion der Medien: Zwei Modelle
In diesem Zusammenhang spielen auf Jugendliche zugeschnittene Medien eine wichtige Rolle, da sie Jugendszenen vermitteln können, die für den einzelnen Jugendlichen in seiner bisherigen Lebenswelt keine Rolle gespielt haben. Dieses trifft insbesondere für Jugendliche im ländlichen Raum, in lebensweltlichen Strukturschwächen zu, in denen lokale Anbindungen an vorhandene Milieus (beispielsweise der Landjugend) durch das Eindringen der Medien zwar aufgebrochen werden können. Jugendmedien wie VIVA oder MTV jedoch sind kommerziell angelegt und fokussieren sich somit auf eine werbefreundliche, warenförmige Präsentation der Jugendszenen.
„Die symbolischen Elemente, typischerweise Kleidung und Musik, werden aus dem Kontext der sozialen Beziehungen herausgenommen, denn diese Elemente sind es, die sich für die Promotion auf der breiteren Basis des Jugendmarktes eignen.“10
Insofern ist eine genuine Vermittlung jugendkultureller Identität durch diese Jugendmedien auszuschließen, vielmehr bewirken sie eine Stimulation des auf Warenform reduzierten Eklektizismus.
Norbert Bolz charakterisiert den Musikfernsehsender MTV in diesem Zusammenhang als abschwächenden Mittler widerspenstiger Jugendszenen. Durch die kommerzielle mediale Repräsentation werden die Jugendkulturen, in diesem BeispielGrunge, ihres subversiven Potentials beraubt, „das Böse [wird] als Konfektionsware“ präsentiert. Eine „Einführung der Negation des Systems in das System selbst“11, auf ökonomisch effektive Versatzstücke reduziert, charakterisiert die Konsequenz medialer Vermittlung von Jugendkulturen. Mit einer Ausbreitung der lokal angebunden Szenen über Medien bis hin globalen Szenen zu geht immer eine Generalisierung des Subkulturstils und infolgedessen eine Verwässerung der ursprünglichen Intentionen der Kernszene einher.
„[...] Symbolische Elemente verlieren ihre anfänglich integrale Beziehung zu einem spezifischen Lebenskontext und werden offener für Variationen bei der Übernahme durch andere Gruppen, deren Aktivitäten, Selbstbilder und zentrale Anliegen nicht dieselben sind.“12
Bolz Ausführungen stehen in der Tradition des Manipulationsverdachts der Kulturindustriethese Adornos/Horkheimers, in der die Medien die Rolle des hegemonialen Stabilisators einnehmen und dem Rezipienten keine Möglichkeit des Ausweichens dieser Vereinnahmung zusprechen. Diesem steht die Auffassung der Cultural Studies entgegen. John Fiske, einer der bedeutendsten Vertreter dieser Schule transferiert das Encoding/Decoding- Modell Stuart Halls13
auf den Gegenstand der jugendkulturellen Forschung. Seine Theorie spricht populären Texten, zu denen die Publikationen jugendlicher Medien zählen, die Möglichkeit einer aktiven und verschiedenartigen Aufnahme durch die Rezipienten, hier die Jugendlichen, zu. Des weiteren sieht er auch in den populären Produkten, die den Jugendlichen zur Verfügung stehen und die für ihre Lebenswelt, sei es auf die eigene Person bezogen oder auf die Peergroup, in welcher die Jugendkulturen für den Jugendlichen bedeutsam sein können, eine prinzipielle Polysemie:
„[...] Im Unterschied zu polit-ökonomischen Theorien und zur Kulturindustriekritik der Kritischen Theorie geht Fiske davon aus, daß der mechanische Schluß von der Warenform auf die manipulative Funktion von Populärkultur die doppelte Ökonomie und Zirkulation kulturindustrieller Produkte übersieht.“14
Diese von Fiske skizzierte Möglichkeit einer dem Individuum dienlichen (Um-) Deutung populärer Gegenstände soll später anhand der Analyse der faschistoiden Ästhetik als Zeichenspielerei der Gruppe Rammstein näher untersucht werden, ist jedoch ebenfalls für die folgende Beschreibung der jugendkulturellen Bricolage-Technik bedeutsam.
4. Stilmischung
4.1. Bricolage
Dieter Baacke greift in seinen Ausführungen die bereits dargestellten jugend- und gesamtkulturellen Phänomene der Pluralisierung und Individualisierung sowie der Resistenz (Baacke geht davon aus, daß „Jugendliche zwar Ängste und Gefühle (formulieren), in ihrem Privatleben aber [als Überlebensstrategie hinsichtlich des Bedeutungsverlustes überkommener Sozialisationsinstanzen] auf Glückserfüllung und Hoffnungszeichen (beharren)“15 auf und begründet die Existenz dieser „Strukturzüge“16im Vorhandensein „eine(s) hohen Grades von [...] postkonventioneller Selbstreflexivität“17. Diese Strategien bieten den Jugendlichen die Möglichkeit zur Ausprägung einer Vielfalt von Selbstdarstellungsmustern, die sie als „Arsenal in ihren eigenen SelbstKostümierungs-Fundus (übernehmen)“18
Im Zusammenhang dieser nach außen durch das „Ausprobieren verschiedener Kleidungsmuster“19gekennzeichneten Multioptionalität ist der von Lévi-Strauss eingeführte Begriff der Bricolage zu nennen.
Claude Lévi-Strauss definiert in seinen Untersuchungen über Naturvölker, primitive Kulturen, Bricolage als Fähigkeit, über Mythen wie Hexerei oder Aberglauben aus verfügbaren, gegenständlichen Versatzstücken, beispielsweise totemistischen Symbolen, immer neue Gesamtzusammenhänge zu erstellen, die trotz ihrer Heterogenität von allen Mitgliedern der Kultur erkannt werden und so die Gemeinschaft homogenisieren können.
Das Individuum, nach Lévi-Strauss als „bricoleur“20(Bastler) definiert, entnimmt für sein Vorhaben, im Falle der Jugendszenen wie auch der Naturvölker ist dieses Kommunikation, Objekte aus einem Vorrat an Werkzeugen und Rohstoffen. Diese „[...] sind schon mit Bedeutungen besetzt, und da er sie in seiner Arbeit immer wieder neu kombiniert und zusammenstellt, entdeckt er auch immer wieder neue Bedeutungen an ihnen.“21
Auf der jugendkulturellen Ebene sind der skizzierte Vorrat beispielsweise die für den Jugendlichen als quasi subkulturellen bricoleur verfügbaren Kleidungsstücke, die durch ihre vielfältige Zusammenstellung zu Ausdrucksträgern einer subkulturspezifischen kollektiven Identität sowie einer wechselfähigen, individualistisch geprägten personalen Identität werden. Die verwendeten Materialien beschränken sich nicht auf gängige Kleidungsstücke, die durch Neukombination aus ihrem konventionellen Kontext enthoben werden (beispielsweise das Tragen von Sommerkleidern zu Springerstiefeln als GrungeOutfit), sondern schließen die Dekontextualisierung und Umdeutung von Gegenständen, deren Verwendungszweck ursprünglich nicht das Tragen am Körper zählte, mit ein: So waren in die Wangen gestochene Sicherheitsnadeln beliebtes Schmuckstück der Punks, in der Streetwear-Mode22ist das Tragen von Fahrradketten als Portemonnaiehalter üblich.
Dick Hebdige, wie Fiske ebenfalls Vertreter der Cultural Studies, spricht in diesem Zusammenhang den Anhängern der Modernists-Jugendkultur die Rolle der bricoleurs zu, „da auch sie eine Reihe von Gebrauchsgütern beschlagnahmten und einer symbolischen Ordnung einfügten, die ihre ursprünglichen Biedermann-Bedeutungen auslöschte oder untergrub. So funktionierten sie die Pillen, die ursprünglich gegen neurotische Erkrankungen verschrieben worden waren, zu ihren eigenen Zwecken um, und den Motorroller, ursprünglich ein äußerst respektables Transportmittel, verwandelten sie in ein bedrohliches Symbol ihrer Gruppensolidarität“.23
Als wichtigstes Merkmal der Stilaneignung und -ausbildung von Jugendszenen bleibt somit festzuhalten, daß in den kulturellen Techniken der Jugendszenen immer auf einen (kultur-) industriell vorgefertigten Zeichenvorrat zurückgegriffen werden muß, „die Schöpfung kultureller Stile umfaßt also eine differenzierende Selektion aus der Matrix des Bestehenden“.24Die Subversivität der Szenen entsteht durch Neuordnung, nicht durch Neuschöpfung.
Geht man von der Theorie der Cultural Studies aus, die eine aktive Rezeption für möglich hält, so kann und muß, falls eine Normabweichung markiert werden soll, die persönliche und szenetypische Aneignung der Objekte bewirken, seien es jugendliche Fernsehsendungen oder Sportartikel, im allgemeinen Gegenstände und Sachverhalte, denen ehemals eine bestimmte, allgemeingültige Funktion eingeschrieben ist, daß sich die Individuen und Kollektive einer hegemonialen Manipulation entziehen können und sie in ihre eigene Lebenswelt, auch als „alternative Welt“25bezeichnet, transferieren können.
4.2 Problematische Zeichenspielerei: Rammstein
Eine der dominanten Rezeptionsart (im Falle der Sicherheitsnadel wäre dies der Gebrauch im Haushalt) widerstrebende Rezeption, von Fiske als „oppositional reading“26definiert, birgt jedoch freilich auch ein Gefahrenpotential, da der gesellschaftliche Diskursrahmen oft verlassen wird und politisch extreme Auslegungen ermöglicht werden. Als Beispiel ist hier die Rezeption der Musik der Gruppe Rammstein zu nennen. Ähnlich wie andere Vertreter der „Neuen Deutschen Härte“ kokettieren auch sie mit faschistischer Ästhetik. So zeigt das Video zu ihrem Depeche Mode- Cover des SongsStrippedAusschnitte aus dem NS-Film Olympia von Leni Riefenstahl. Rammstein, die sich wie auch der ebenfalls mit faschistoiden Bildern und Texten arbeitende Musiker Joachim Witt als politisch linksorientiert erklären, gelingt es nicht, der von ihnen praktizierten Zeichenspielerei eine klar erkennbare Absicht (beispielsweise Zynismus und Ironie) beizufügen, die sie des Vorwurfs einer Band, die rechtsorientierten Jugendlichen gefällig sein will, entlasten könnte. Dadurch, daß „ihr Umgang mit Zeichen und Mythen ziemlich unmittelbar (ist)“,27sie über eine Selbstinszenierung, die sich auf Effekte (insbesondere pyrotechnischer Art) reduziert, nicht hinauskommen, forcieren sie eine, nach Fiske oppositionelle Lesart/Rezeption durch die Konsumenten - Jugendliche, die einer rechtsgerichteten Ideologie nahestehen und die ihnen mit diesem allzu offen gehaltenen Text zur Verfügung stehenden Zeichen für ihre Zwecke assimilieren können. Insofern kann eine Zeichenspielerei, die durch potentielle Vieldeutigkeit extreme Interpretationen ermöglicht, durchaus gefährlich sein.
Der Umgang mit faschistischen Symbolen ist indes kein jugendkulturelles Novum, in der Punkszene wurden Hakenkreuz-Armbinden als nach außen hin schockierendes Zeichen getragen:
„Es [das Hakenkreuz] spiegelte eindeutig das Interesse der Punks an einem dekadenten Deutschland - einem Deutschland, das ‚no future‘ hatte. Es rief eine Periode wach, die von dem Hauch einer machtvollen Mythologie umgeben war.“28
In der Punkszene konnte die Verwendung dieses Zeichens angemessen „dekodiert“ werden, so daß die Gefahr einer Fehlinterpretation ausgeschlossen wurde. Durch die von den Punks vollzogene Dekontextualisierung des Hakenkreuzes, durch die Nichtexistenz „irgendwelcher identifizierbarer Werte“29 reduzierte sich der nach außen provozierte Schockeffekt auf die stumme, symbolische Darstellung der Devianz der Szene und fungierte beispielsweise als Zeichen der Aversion der Punks gegenüber dem aus ihrer Sicht naiven Humanismus der Hippie-Generation. In diesem Fall ist die Verwendung faschistischer Symbolik somit als relativ unproblematisch zu bewerten, die unreflektierte (womöglich gar bewußt in Kauf genommene) Zeichenspielerei Rammsteins jedoch evoziert eine Übernahme durch rechtsgerichtete Jugendszenen.
5. Schluß
Die Analyse der kulturellen Techniken moderner Jugendszenen hat verdeutlicht, daß durch Multiplikation der Jugendkulturen und ihre Verwebung durch den von vielen Jugendlichen betriebenen Eklektizismus traditionelle jugendkulturelle Polaritäten obsolet geworden sind. Neue, der Postmoderne immanente, individualistische Tendenzen sind gesamtgesellschaftlich begründet und als Reaktion auf ökonomische Veränderungsprozesse wie den Strukturwandel zu verstehen.
Durch die Praxis der Selektion aus den einzelnen Jugendszenen können diese einen Bedeutungsverlust erleiden, da sich die Auswahl weitgehend auf die Bereiche der Mode und spezifischer Produkte (wie Sportgeräte) reduziert. Dieser Prozeß wird durch die mediale Verbreitung durch kommerzielle Jugendmedien forciert.
Jedoch ist im Sinne der Cultural Studies durch diesen Kommunikationsweg nicht unmittelbar auf eine stets wirksame Manipulation der Jugendlichen zwecks Steigerung ihres Konsums zu schließen. Die den Rezipienten zugesprochene Möglichkeit, das ihnen Dargebotene nicht im Sinne des Darbietenden zu rezipieren, kann diesen direkten Schluß verhindern. Diesbezüglich weist Eggo Müller in seinen Ausführungen zu Fiskes auf den „hohen Anteil von 80 bis 90 Prozent ökonomischer Fehlschläge in der kommerziellen Kultur“30hin.
Des weiteren kann anhand des von John Fiske entwickelten Modells der drei Lesarten des Populären veranschaulicht werden, daß sehr offen strukturierte populäre Texte zu einer extrem gegensätzlichen Dekodierung führen können. Die problematische Zeichenspielerei der Gruppe Rammstein ist, da der Rahmen der Auslegung der verwendeten Zeichen in keiner Weise eingeschränkt wird, für rechtsgerichtete Jugendszenen zugänglich und dienlich.
Die vielfältigen, neuartigen Methoden und Analysetechniken der Cultural Studies, die neben der im Rahmen dieser Hausarbeit skizzierten populärkulturellen Lesarten jugend- und subkulturelle Phänomene anhand der Gesichtspunkte Klasse, Geschlecht/Sexualität, Ethnizität sowie Begrifflichkeiten aktuellen Bezugs wie Cyberkulturen und Globalisierung untersuchen, werden erst in diesem Jahrzehnt in der deutschen Jugendforschung rezipiert. Ein stärkerer Einbezug der nicht erzieherisch angelegten Jugendforschung der Cultural Studies in die Wissenschaft über Jugendkulturen könnte somit innovative Impulse liefern.
6. Literaturverzeichnis
Baacke, Dieter (1999³) Jugend und Jugendkulturen. Darstellung und Deutung. Weinheim/München: Juventa
Bolz, Norbert (1997) 1953 - Auch eine Gnade der späten Geburt. In: Hörisch, Jochen (Hg.) Mediengenerationen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 60-89.
Clarke, John (1979) Stilschöpfung. In: Kemper, Peter/Langhoff, Thomas/Sonnenschein, Ulrich (Hg.) (1998) „but I like it“. Jugendkultur und Popmusik. Stuttgart: Reclam, S.375-391
Ferchhoff, Wilfried (1993) Jugend an der Wende des 20. Jahrhunderts. Lebensformen und Lebensstile. Opladen: Leske + Budrich
Hall, Stuart (1980) Kodieren/Dekodieren. In: Bromley, Roger/Göttlich, Udo/Winter, Carsten (1999) Cultural Studies. Grundlagentexte zur Einführung. Lüneburg: zu Klampen, S. 92-112
Hebdige, Dick (1979) Stil als absichtliche Kommunikation. In: Kemper, Peter/Langhoff,
Thomas/Sonnenschein, Ulrich (Hg.) (1998) „but I like it“. Jugendkultur und Popmusik. Stuttgart: Reclam, S. 392-419
Janke, Klaus/Niehues, Stefan (1995) Echt abgedreht. Die Jugend der 90er Jahre. München: Beck´sche Reihe.
Jugendwerk der Deutschen Shell (Hg.) (1997) Jugend `97. Zukunftsperspektiven, Gesellschaftliches Engagement, Politische Orientierungen. Opladen: Leske + Budrich.
Müller, Eggo (1993) Pleasure and Resistance. John Fiskes Beitrag zur Populärkulturtheorie. In: Montage A/V 2.1, S.52-66
Nachtwey, Reiner (1987) Pflege Wildwuchs Bricolage. Ästhetisch-kulturelle Jugendarbeit. Opladen: Leske + Budrich
Poschardt, Ulf (1999) Stripped. Pop und Affirmation bei Kraftwerk, Laibach und Rammstein. In: Die Beute 3. Politikbegriffe in der Popkultur. Berlin: ID Verlag
Vogelsang, Waldemar (1994) Jugend- und Medienkulturen. Ein Beitrag zur Ethnographie medienvermittelter Jugendwelten. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 3, S. 464-491.
[...]
1Ferchhoff,Jugend an der Wende des 20.Jahrhunderts, S. 26
2Ebd., S. 83 (jugend-) kulturellen
3Vogelsang,Jugend- und Medienkulturen, S. 467
4Ebd.
5Ebd.
6vgl. Jugendwerk der Deutschen Shell,Jugend´97, S. 278-284
7Vogelsang,Jugend- und Medienkulturen, S. 467
8Janke/Niehues,Echt abgedreht, S. 201
9Janke/Niehues,Echt abgedreht, S. 201f.
10Clarke,Stilschöpfung, S. 391
11Bolz,1953 - Auch eine Gnade der späten Geburt, S. 72
12Clarke,Stilschöpfung, S. 388
13vgl. Hall,Kodieren/Dekodieren, S.92-112
14Müller,Pleasure and Resistance,S.56
15Baacke,Jugend und Jugendkulturen, S. 217
16Ebd., S. 216
17Ebd., S.217
18Ebd.
19Ebd.
20Vlg. Clarke, Stilschöpfung, S.375
21Nachtwey,Pflege, Wildwuchs, Bricolage, S. 174
22der Begriff Streetwear hat den Ausdruck Clubwear weitgehend abgelöst, da diese aus dem Skateboardbereich stammende Mode nicht mehr nur in der Musik- sondern in allen Szenen getragen wird und somit repräsentatives Zeichen für Stilmischung ist.
23Hebdige,Stil als absichtliche Kommunikation, S. 397
24Clarke,Stilschöpfung, S. 378
25vgl. Vorwort zu Kemper/Langhoff/Sonnenschein,„but I like it“, S. 9
26vgl. Müller,Pleasure and Resistance, S.59
27Poschardt, Stripped, S. 64
28Hebdige,Stil als absichtliche Kommunikation, S. 409
29Ebd., S. 410
Häufig gestellte Fragen zu "Stilschöpfung und Bricolage"
Was ist der Kerngedanke des Textes "Stilschöpfung und Bricolage"?
Der Text untersucht, wie sich Jugendkulturen in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft entwickeln und ausdrücken. Er beleuchtet die Begriffe Individualismus, Stilschöpfung und Bricolage im Kontext von Jugendkulturen und analysiert, wie Jugendliche bestehende kulturelle Elemente neu kombinieren und interpretieren, um ihre eigene Identität zu formen.
Was versteht der Text unter "Bricolage" im Zusammenhang mit Jugendkulturen?
Der Text bezieht sich auf Lévi-Strauss' Begriff der Bricolage als die Fähigkeit, aus einem vorhandenen Vorrat an kulturellen Versatzstücken (z.B. Kleidung, Symbole) immer neue Zusammenhänge zu erstellen. Jugendliche nutzen diese Technik, um subkulturelle Identitäten auszudrücken und individuelle Stile zu kreieren, indem sie Gegenstände dekontextualisieren und umdeuten.
Welche Rolle spielen Medien, insbesondere Jugendmedien wie MTV oder VIVA, in Bezug auf Jugendkulturen?
Der Text argumentiert, dass kommerzielle Jugendmedien zwar Jugendszenen vermitteln können, aber oft eine vereinfachte, warenförmige Darstellung bieten. Dadurch fördern sie möglicherweise einen oberflächlichen Eklektizismus und reduzieren das subversive Potential der Jugendkulturen, anstatt eine authentische Vermittlung zu gewährleisten.
Wie wird der Begriff des "Eklektizismus" in Bezug auf Jugendkulturen im Text verwendet?
Der Eklektizismus beschreibt die Tendenz, dass Jugendliche sich aus verschiedenen Jugendszenen bedienen und Elemente unterschiedlicher Stile kombinieren. Dadurch entstehen Pluralisierungen und Hybriditäten in Mode und Musik, die sich einer eindeutigen Zuordnung entziehen können. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass jugendkulturelle Elemente ihrer ursprünglichen Bedeutung beraubt und zu einem oberflächlichen Lifestyle degradiert werden.
Was ist die "problematische Zeichenspielerei" am Beispiel von Rammstein, die im Text diskutiert wird?
Der Text analysiert die Band Rammstein als Beispiel für eine "problematische Zeichenspielerei". Durch die Verwendung faschistoider Ästhetik in ihren Musikvideos, ohne eine klare Distanzierung oder ironische Brechung, besteht die Gefahr, dass ihre Zeichen von rechtsgerichteten Jugendlichen falsch interpretiert und für ihre eigenen Zwecke vereinnahmt werden. Die potentielle Vieldeutigkeit ermöglicht extreme Interpretationen.
Welche Bedeutung hat die Theorie der Cultural Studies für die Analyse von Jugendkulturen im Text?
Der Text bezieht sich auf die Cultural Studies, insbesondere auf die Arbeiten von John Fiske, um die Möglichkeit einer aktiven und vielfältigen Rezeption populärer Kulturprodukte durch Jugendliche zu betonen. Im Gegensatz zu älteren Manipulationstheorien geht die Cultural Studies davon aus, dass Jugendliche populäre Texte aktiv umdeuten und für ihre eigene Identitätsbildung nutzen können.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen tragen zur Individualisierung der Jugend bei, laut dem Text?
Der Text nennt als Ursachen für die zunehmende Individualisierung gesellschaftliche Veränderungsprozesse wie den Strukturwandel in der Arbeitswelt, den Anstieg der erwerbsarbeitsfreien Lebenszeit und die wachsende Mobilität. Diese Faktoren führen zu einem Aufbrechen traditioneller Lebenswelten und einer sinkenden Identifikation mit klassischen Berufsbildern, was Jugendliche dazu veranlasst, alternative Formen der Identitätsbildung zu suchen.
Was sind die zentralen Kritikpunkte am Umgang mit Arbeit in der Lebenswelt Jugendlicher?
Der Text kritisiert, dass die stagnierende Identifikation Jugendlicher mit der Arbeitswelt nicht aus mangelndem Interesse resultiert, sondern aus der Unsicherheit und den fehlenden Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt, die durch permanente Veränderungen der Berufswelt bedingt sind. Die Abwendung von der Selbstidentifikation über Arbeit erfolgt somit eher aus Notwendigkeit als aus freier Wahl.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2000, Stilschöpfung und Bricolage, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96064