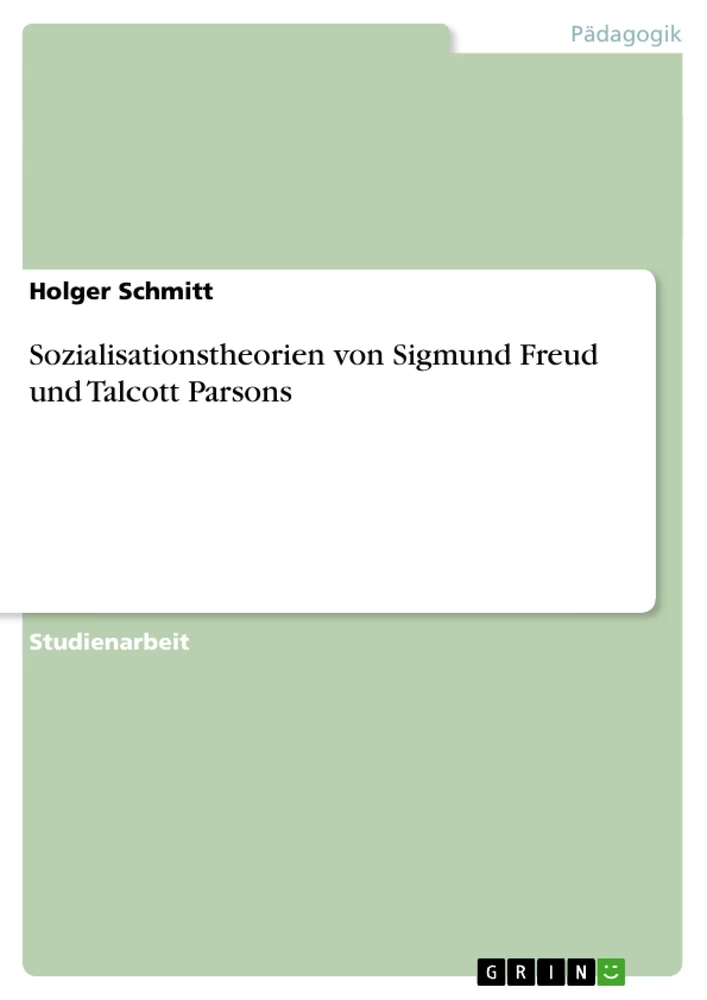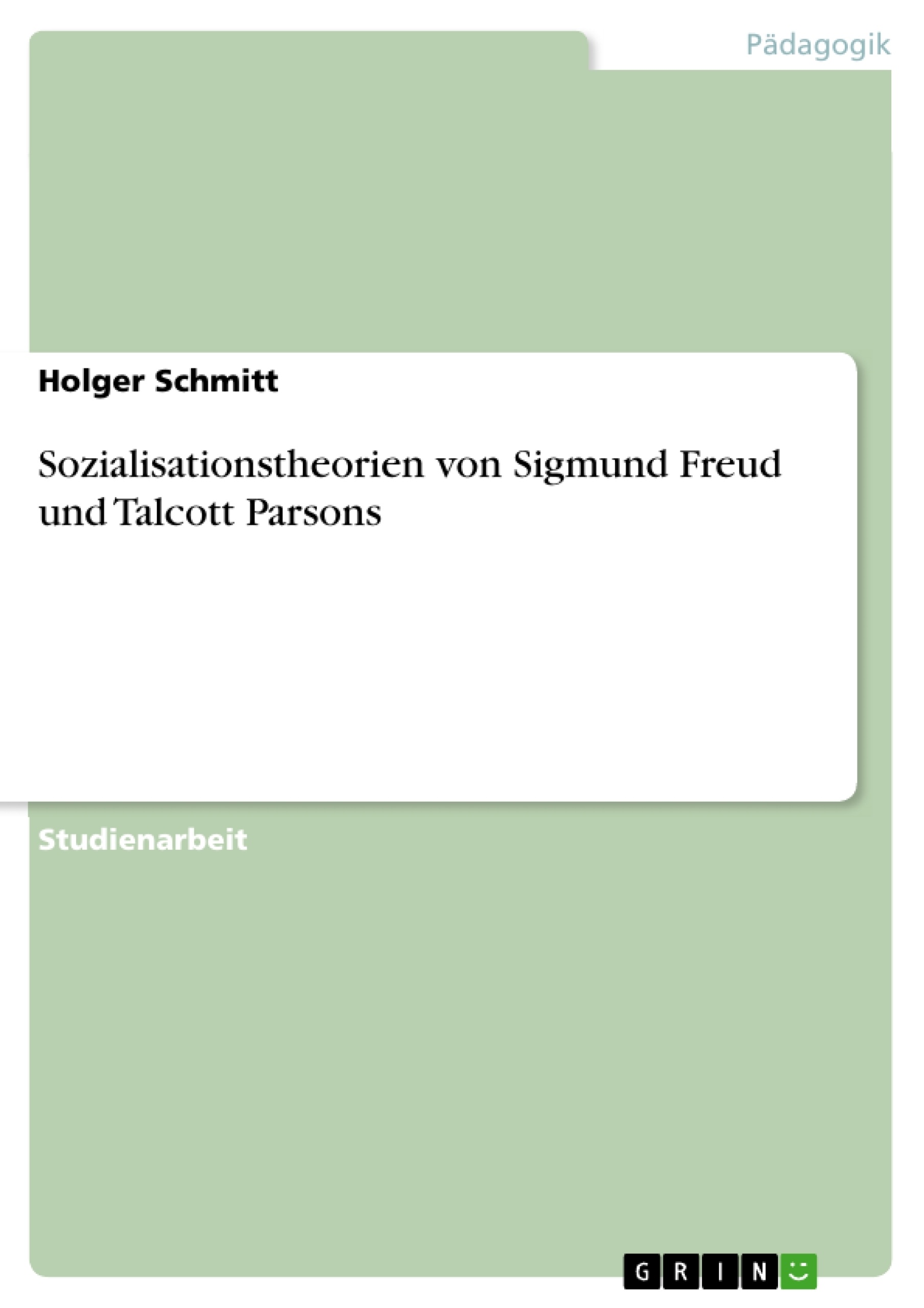Was formt uns zu dem, was wir sind? Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Sozialisation, einem Prozess, der uns von der Geburt an prägt und uns zu handlungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft macht. Dieses Buch beleuchtet die komplexen Theorien von Sigmund Freud und Talcott Parsons, zwei Giganten des 20. Jahrhunderts, die unterschiedliche, aber dennoch tiefgreifende Einblicke in die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit bieten. Entdecken Sie Freuds psychoanalytische Perspektive, die die Bedeutung unbewusster Triebe und frühkindlicher Erfahrungen hervorhebt, insbesondere die Rolle des "Es", "Ich" und "Über-Ich" bei der Gestaltung unseres Verhaltens. Verfolgen Sie die Entwicklung durch orale, anale, phallische, Latenz- und genitale Phasen, und verstehen Sie, wie diese prägenden Erfahrungen unsere späteren Beziehungen und unser Selbstverständnis beeinflussen. Erfahren Sie mehr über die Kritik an Freuds Theorie, einschließlich seiner vermeintlichen Frauenfeindlichkeit und der Fokussierung auf die Kleinfamilie. Wagen Sie sich dann in Parsons' strukturfunktionalistische Sichtweise, die das Individuum im Kontext komplexer sozialer Systeme betrachtet. Untersuchen Sie, wie kulturelle Werte, soziale Normen und interpersonelle Beziehungen zusammenwirken, um die Persönlichkeitsentwicklung zu lenken. Entschlüsseln Sie Parsons' AGIL-Schema (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) und seine Phasen der Sozialisation: orale Abhängigkeit von der Mutter, Liebesabhängigkeit, ödipale Phase, Latenzphase und Adoleszenzphase. Analysieren Sie die Kritik an Parsons' Theorie, einschließlich des Vorwurfs der Überbetonung der Vergesellschaftung und der Vernachlässigung von Konflikten und abweichendem Verhalten. Diese Gegenüberstellung bietet einen tiefen Einblick in die fundamentalen Kräfte, die unsere Identität formen, und regt dazu an, über die Wechselwirkung zwischen individueller Psyche und sozialer Struktur nachzudenken. Ob Student der Sozialwissenschaften, Pädagoge oder einfach nur neugieriger Leser – dieses Buch bietet Ihnen eine wertvolle Perspektive auf die lebenslange Reise der Sozialisation. Entdecken Sie, wie internalisierte Normen und Werte unsere Persönlichkeit formen und uns zu dem machen, was wir sind, indem wir uns mit den zentralen Fragen der menschlichen Entwicklung und der Rolle der Gesellschaft bei der Gestaltung des Einzelnen auseinandersetzen. Es ist eine Reise durch die Entwicklung des Individuums, bei der die Theorien von Freud und Parsons aufschlussreiche Perspektiven auf die Verflechtung von Psyche und Gesellschaft bieten. Erhalten Sie wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Persönlichkeitsbildung und die Bedeutung der Sozialisation für die Funktionsweise unserer Gesellschaft. Dieses Buch ist ein Muss für jeden, der die Komplexität des menschlichen Verhaltens verstehen möchte.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung Seite
1.1. : Begriffsbestimmung : Sozialisation
2. Hauptteil I Sigmund Freud
2.1. : Zur Person
2.2. : Einführung: Sozialisationstheorie
2.3. : Grundlagen: „Der psychische Apparat“
2.3.1.: „ES“
2.3.2.: „ICH“
2.3.3.: „ÜBER-ICH“
2.3.4.: Verhältnis der Instanzen
2.4.: Phasenlehre
2.4.1.: „Orale Phase“
2.4.2.: „Sadistisch-anale Phase“
2.4.3.: „Phallische Phase“
2.4.4.: „Latenzzeit“
2.4.5.: „Genitale Phase“
2.5.: Kritik und Ausblick
3. Hauptteil II Talcott Parsons
3.1.: Zur Person
3.2.: Einführung: Sozialisationstheorie
3.3.: Voraussetzung der Handlungstheorie
3.4.: Handlungstheorie
3.4.1.: Das „kulturelle System“
3.4.2.: Das „soziale System“
3.4.3.: Das „Persönlichkeitssystem“
3.4.4.: Das „Organismussystem“
3.4.5.: Funktionskategorien der Systeme - „AGIL“
3.5.: Sozialisationsbegriff bei Parsons
3.6.: Phasen der Sozialisation
3.6.1.: „Orale Abhängigkeit von der Mutter“
3.6.2.: „Liebesabhängigkeit von der Mutter“
3.6.3.: „Ödipale Phase“
3.6.4.: „Latenzphase“
3.6.5.: „Adoleszensphase“
3.7.: Kritik und Ausblick
4. Schluß
4.1.: Schlußbetrachtung
Anhang
Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Zu Beginn meiner Arbeit möchte ich den zentralen Begriff der Sozialisation, als Basis aller weiteren Betrachtungen, definieren.
Um mich den Theorien von Freud und Parsons anzunähern, werde ich jeweils die Autoren kurz vorstellen und das Theoriegebilde hinter ihren Sozialisationsmodellen ausführen. Danach verdeutliche ich, anhand von „Phasen“, ihre Ansätze, um schließlich kritische Aspekte aufzeigen zu können und mit einer allgemeinen Schlußbetrachtung abzuschließen.
1. 1. : Begriffsbestimmung : Sozialisation
Was wird allgemein unter Sozialisation verstanden?
„Sozialisierungsprozeß, Gesamtheit aller Prozesse, durch die dem Individuum die gesellschaftlichen Normen und Werte vermittelt werden “
(Familien Lexikon 1991, S. 1278)
Diese Erklärung ist beispielhaft für eine Alltagsdefinition. Für die weitere Betrachtung reicht dieser Ansatz jedoch nicht aus, grenzt er sich doch unter anderem nicht genau von dem Erziehungsbegriff ab.
Das Kollidieren mit anderen Begrifflichkeiten ist typisch für diesen globalen Prozeß. Um die ganze Bandbreite der Bedeutungsebenen und die Berührungspunkte mit anderen Schlagwörtern der Sozialwissenschaften aufzuzeigen, hat Hurrelmann (1976, S.15, 16) folgenden Definitionsversuch unternommen, indem er die Berührungspunkte den jeweiligen Teilaspekten der Sozialisation gegenüberstellt.
„a) zur Bezeichnung der gesellschaftlichen Aktivitäten und
Vorkehrungen, die direkt oder indirekt auf die Entwicklung der Persönlichkeitsstrukturen der Gesellschaftsmitglieder Einfluß nehmen - auf dieser Ebene steht er neben dem klassischen pädagogischen Begriff der Erziehung;
b) zur Bezeichnung der Persönlichkeitsentwicklung selbst, sofern diese
durch Umweltfaktoren bestimmt wird - auf dieser Ebene tritt er in Konkurrenz zum klassischen, psychologischen Begriff Entwicklung; c) zur Bezeichnung des Prozesses der Vermittlung von und der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Werten, Normen und Handlungsmustern, in dessen Verlauf das Gesellschaftsmitglied zu einem potentiell handlungsfähigen, menschlichen Subjekt wird - so zugeschnitten nimmt er die Stelle der klassischen soziologischen Konzeption, der Vergesellschaftung der menschlichen Natur ein.“
Diese Definition läßt erahnen, warum Sozialisationstheorien aus allen Bereichen der Sozialwissenschaften hervorgegangen sind und wie schwer sich eine universale Theoriebildung gestaltet.
Im folgenden gehe ich auf die Theorie Sigmund Freuds, als Vertreter der Medizin bzw. Psychologie, ein.
Aus der Soziologie werde ich anschließend den Ansatz von Talcott Parsons vorstellen, der erstmals versucht hat, aufbauend auf Freud, eine interdisziplinäre Theorie zu bilden, die alle Bereiche der Definition mit einbezieht. Eine mögliche Gliederung einer Sozialisationstheorie ist es, Aspekte der Entwicklungspsychologie zu benutzen, um die Entwicklung des Menschen in Phasen zu gliedern.
Eine erste Aufschlüsselung in einzelne Phasen könnte wie folgt lauten:
„... In der primären S. werden Sprache, Denken, Fühlen und Handeln betreffende Persönlichkeitsmerkmale ausgeformt. Sozialisationsinstanzen sind alle gesellschaftl. Einrichtungen, die die S.prozesse (bewußt oder unbewußt) steuern und bestimmte Normen und Wertvorstellungen, Ziele und Verhaltensformen vermitteln. Etwa nach Vollendung des 3. Lebensjahres beginnt die sekundäre S., in der das Individuum lebenslang neues soziales Rollenverhalten hinzulernt; Erziehung als bewußtes und abgrenzendes Handeln kann dabei bestimmte Einflüsse des S.prozesses unterstützen, anderen entgegenwirken“ (Meyers Lexikon 1993 ).
Diese grobe Einteilung anhand der Ontogenese ergänzt Tillmann (1989, S. 18, 19) um den Begriff der tertiären Sozialisation (im Erwachsenenalter). Doch auch diese Annäherung erscheint nicht genau genug und muß daher von einer Theorie mit weiteren Phasen der Entwicklung gefüllt werden.
Der Phasenlehre kommt auch in dieser Arbeit eine besondere Stellung zu und unabhängig davon wird, gemäß der zu untersuchenden Autoren, der Schwerpunkt der Betrachtung in der Kindheit und Jugend, also der primären Sozialisation und einigen Teilen der sekundären Sozialisation liegen, da hier, laut den Quellen, alle wesentlichen Prozesse der Internalisierung von Normen und Werten und der Pesönlichkeitswerdung ablaufen.
Ziel dieser Arbeit ist somit, zwei wesentliche Sozialisationstheorien und ihre Autoren vorzustellen.
2. Hauptteil I Sigmund Freud
2. 1. : Zur Person
Sigmund Freud wurde am 6. Mai 1856 in Freiberg (Mähren) geboren.
Er studierte Medizin in Wien und interessierte sich nach seinem Studium vor allem für seelisch bedingte Erkrankungen. Sein Ziel war es, ein Verfahren zur Heilung von Neurosen zu erarbeiten. Im Laufe seiner praktischen Tätigkeit entwickelte er die Psychoanalyse, an deren Weiterentwicklung er bis zu seinem Tod, 1939 in London, arbeitete.
Freud war seit 1902 Titular-Professor in Wien und erhielt 1930 den Goethepreis. Die Nazis zwangen ihn 1938, als Sohn jüdischer Eltern, zur Emigration nach London, wo er 1939 verstarb.
Sein Hauptwerk „Die Traumdeutung“ erschien 1900, mit dem er sich erheblich von der damals klassischen Lehrmeinung entfernte. Wie er zu diesem revolutionärer Ansatz gekommen ist, läßt sich jedoch erklären, wenn die verklemmten, viktorianischen Verhältnisse mit all ihren Zwängen und der totalen Tabuisierung von Sexualität, wie sie in seiner Heimatstadt Wien zu dieser Zeit betrachtet werden.
Es ist daher nicht verwunderlich, daß er in seiner Praxis immer Verdrängtes aus dem Bereich der Sexualität, als Ursache für Neurosen oder andere Pathologien des Geistes, fand. Somit mußte er diesem natürlich besonderes Gewicht in seiner Theorie verleihen.
(Fischer Taschenbuch Verlag 1972, Einband)
2. 2. Einführung: Sozialisationstheorie
Sigmund Freud beabsichtigte keinen sozialisationstheoretischen Ansatz mit seiner Psychoanalyse, sondern ein Erklärungsmodell, um Pathologien des Geistes zu heilen. Seine Theorie gewann ihre Erkenntnisse vor allem aus der Behandlung von Patienten (Tillmann 1989, S. 98).
Trotzdem kann seine „Phasenlehre“ als Ausgangspunkt für die Untersuchung der Sozialisation des Menschen benutzt werden. Besonders die Termini, die er einführt, sind bis heute Standard, um Vorgänge aus diesem Bereich zu erklären.
2. 3. Grundlagen: „Der psychische Apparat“
Grundlegend für die „Phasenlehre“ ist zunächst ein Bild des „psychischen Apparates“. Er besteht aus drei Instanzen, dem „ES“, dem „ICH“ und dem „ÜBER-ICH“.
Im folgenden habe ich versucht, die Trieblehre, ein eigenständiger Ansatz, mit in die Instanzen und das Phasenmodell zu integrieren. Sie ist, nach Freud, Grundbedingung menschlicher Aktivität (Tillmann 1989, S. 99).
2. 3. 1. „ES“
Als älteste Instanz des „psychischen Apparates“ nach Freud (1972, S. 9) haben wir einen Teil, der aus Ererbtem, bei Geburt Mitgebrachtem und konstitutionell Festgelegtem, also vor allem aus Trieben und Körperorganisationen, besteht. Diese Provinz des Geistes nennt Freud „ES“. Das „ES“ funktioniert nach dem Lustprinzip, ist unbelehrbar und unausrottbar (Mühlbauer 1980, S. 36). Die Hauptkraft des „ES“ sind die Triebe, die genbedingt durch den Zustand psychischer Erregung aktiviert werden (Brenner 1967, S. 27). Wenn also ein Zustand der Erregung erreicht ist, geht ein Bestreben hieraus hervor, diesen Zustand nach Verlassen wieder zu erreichen. Die ganze Mannigfaltigkeit der menschlichen Triebe führt Freud auf zwei Urtriebe zurück. Zum einen den „Erostrieb“, zum anderen den „Destruktionstrieb“ oder „Todestrieb“.
Der „Erostrieb“ hat zum Ziel, stets wieder größere Einheiten herzustellen und zu erhalten, sprich zu verbinden. Die Energie dazu nennt Freud die „Libido“. Sie zeichnet sich durch die Fähigkeit der Beweglichkeit und Fixierung aus. Der Gegenpart dieses Triebes ist der „Destruktionstrieb“. Er ist bestrebt, Zusammenhänge aufzulösen, Dinge zu zerstören und das Lebende in seinen anorganischen Zustand zu überführen. Beiden gemeinsam ist das Bestreben in einen früheren, erlebten Zustand zurückzukehren.
Der „Erostrieb“ ist bestrebt, zu Einheiten zurückzukehren, die zerstört sind und der „Destruktionstrieb“ will eben im Zustand der Einheiten wieder die Zerstörung (Freud 1972, S 11, 12).
Das gesamte Spektrum menschlicher Triebe ist in der Schnittmenge der beiden Urtriebe zu finden. So sind alle beobachtbaren Erscheinungen ein Gemisch aus Eros und Destruktion.
2. 3. 2. „ICH“
In der ältesten Provinz des Geistes bildet sich an der Peripherie, wo später motorische Kontrolle, Wahrnehmung, Erinnerung, Affekte, Denken, Planung und Steuerung stattfinden und an der die Reize der Organe auflaufen, ein Reizschutz, der aus einer besonderen Organisation besteht. Diese Organisation wird zum Vollstrecker der Triebe aber auch steuernde Instanz. An dieser Schlüsselstelle lernt es neue Reize kennen und speichert Erfahrungen über sie im Gedächtnis. Überstarke Reize vermeidet es durch Flucht, mäßigen Reizen begegnet es durch Anpassung.
Ist das „ES“ noch nicht auf die Erhaltung der Art und des Selbst bedacht und nur dem Lustprinzip folgend, bildet sich jetzt ein nach dem Realitätsprinzip agierender Bereich. Ihn nennt Freud das „ICH“.
Dieses „ICH“ hat die schwierige Aufgabe übernommen, uns am Leben zu erhalten, durch Angst vor Gefahren zu schützen und zusätzlich die günstigste und gefahrloseste Art der Befriedigung unserer Triebe, mit Rücksicht auf die Außenwelt, herauszufinden und durchzuführen.
Es muß also zwischen dem „ES“ und der Außenwelt vermitteln und hat die Verfügung über alle willkürlichen Muskelbewegungen.
Um diese vermittelnde Rolle spielen zu können, muß das „ICH“ Herrschaft über das „ES“ gewinnen und lernen, die Außenwelt zu seinem Vorteil zu verändern. Doch auch das „ICH“ strebt nach Lust und will Unlust ausweichen. Das „ICH“ ist dem Lustprinzip verpflichtet, muß sich aber zugleich am Realitätsprinzip orientieren (Tillmann 1989, S 57, 58). Es kann jedoch entscheiden, ob Triebansprüche sofort befriedigt oder auf einen günstigeren Augenblick verschoben werden, Anpassungen ermöglicht oder Abwehrmechanismen gegen Triebansprüche mobilisiert werden (Mühlbauer 1980, S. 36). Nur im Schlafzustand gibt das „ICH“ den Führungsanspruch gegenüber dem „ES“ frei und verzichtet auf die Organisation.
Eine erwartete Unlust löst ein Angstsignal aus. Ihr Anlaß wird Gefahr genannt (Freud 1972, S. 10). Die Angst ist somit ein Abwehrmechanismus des „ICH“; Angst vor Objektverlust, Verlust der Liebe eines Objekts, Kastrationsangst, Schuldgefühle etc.. Angst ist also ein Schutzmechanismus gegen das „ES“ und alle anderen Instanzen. Es entsteht automatisch, sobald das „ICH“ durch Reize überwältigt wird. Ohne Angst wäre keine Sozialisation möglich (Mühlbauer 1980, S. 43).
Die Triebenergie macht durch ihre Umleitung in andere, gesellschaftlich höherwertige Tätigkeiten, über das „ICH“, den Motor der Sozialisation aus. Ist das „ES“ von Natur aus mitgebracht, so repräsentiert das „ICH“ den Einfluß des selbst Erlebten der Vergangenheit.
„Auch Außenwelt wirkt triebunterdrückend ...“ (Tillmann 1989, S. 60).
2. 3. 3. „ÜBER-ICH“
Aus dem „ICH“ entsteht, durch den Einfluß der Eltern, Erzieher, Ersatzpersonen, Ideale, Vorbilder etc., mit dem Hintergrund des jeweiligen Milieus, den Familienanforderungen sowie Rassen- und Kulturtraditionen, eine eigene Provinz, nämlich die des „ÜBER-ICH“. In dieser Instanz lebt der Einfluß der oben Genannten in uns weiter. Es repräsentiert die Einflüsse der Vergangenheit, die wir im wesentlichen von anderen Menschen übernommen haben (Freud 1972, S. 10,11).
Diesem Prozeß können wir uns nicht entziehen. Er geschieht zwangsläufig durch die von Natur aus bedingte, lange Abhängigkeit von Anderen. Das „ÜBER-ICH“ funktioniert nach dem Moralitätsprinzip und basiert auf dem Gesetz der Wiedervergeltung, indem sowohl Wünsche als auch Taten moralisch kontrolliert werden. Es beobachtet also ständig unsere Wünsche und unser Tun nach der Schablone der internalisierten Werte und Normen. So heißt es bei Mühlbauer (1980, S. 37): „... Über-Ich sei die einschränkende, verbietende, strafende, mißbilligende, sühnefordernde Instanz.“
2. 3. 4. Verhältnis der Instanzen:
Die drei aufgezeigten Instanzen bilden in ihrer Gesamtheit den „psychischen Apparat“. Zusätzlich interagieren alle Teile durch das „ICH“ mit der Außenwelt.
„Man sieht, daß Es und Über-Ich bei all ihrer fundamentalen Verschiedenheit die eine Übereinstimmung zeigen, daß sie die Einflüsse der Vergangenheit repräsentieren, das Es den der ererbten, das Über-Ich im wesentlichen den der von Anderen übernommenen, während das Ich hauptsächlich durch das selbst Erlebte, also Akzidentelle und Aktuelle bestimmt wird“ (Freud 1972, S. 11). Die zentrale, uns bewußte Stelle ist somit das „ICH“; die stärkste jedoch das „ES“.
Aus den Organen und Körperstellen strömt, durch das „ES“ verstärkt, die Energie des „Erostriebes“, die Libido, ins „ICH“ und wird dort gespeichert. Dies führt zunächst, da die Außenwelt im ersten Stadium noch nicht klar in Objekte unterteilt ist, zu einem „primären Narzißmus“. Später, durch die Wahrnehmung der Außenwelt und die Einteilung in Objekte, kann diese Libidoenergie auf Objekte übertragen werden („Objektbesetzung“). Schließlich kann von diesen Objekten selbst die Libido wieder zurück empfangen werden und das „ICH“ verstärken.
Der Säugling kann empfangene Zuwendungen noch nicht der Mutter zuordnen, da er diese vermutlich noch nicht als Objekt wahrnimmt. Durch die spätere Objektbesetzung kann er, sobald seine Wahrnehmung, also das „ICH“, die Mutter als Person der Außenwelt erkennt, die Energie auf sie übertragen, sie also lieben. Wenn nun im letzten Schritt die Mutter dem Kind wieder Zuwendung gibt, führt das zu einem starken Lustgewinn.
Der „Destruktionstrieb“ wird ebenfalls im Inneren des „ICH“ fixiert und wirkt dort selbstzerstörend. Es handelt sich hierbei auch um Aggressionstriebe. Auch aus dem „ÜBER-ICH“ strömen Anerkennung oder Ablehnung auf das „ICH“ ein, je nachdem, ob eine Handlung oder ein Gedanke in die Schablone des Gewissens paßt oder nicht. Wir erfahren dann entweder Selbstzufriedenheit im „ICH“ oder Schuldgefühle.
„Das Über-Ich mag neue Bedürfnisse geltend machen, seine Hauptleistung bleibt aber die Einschränkung der Befriedigung“ (Freud 1972, S. 11).
2. 4. Phasenlehre
Die Sexualität nimmt, wie zu Beginn beschrieben, als Mischform der Urtriebe, einen wesentlichen Stellenwert bei Freud ein. Die psychosexuelle Entwicklung beim Menschen betrachtet er als Grundlage für die Einteilung in verschiedene Entwicklungsstufen. Hierbei sind die Übergänge fließend und markiert durch den Wechsel der jeweiligen Triebobjekte des Kindes.
Wie schon am Beispiel der Libido beim Kind gezeigt, wechselt die Objektbindung von Objekt zu Objekt, ohne die alte ganz aufzugeben (Mühlbauer 1980, S. 34).
Es gibt nach Freud vier Phasen der psychosexuellen Entwicklung des Kindes. Die erste, von 0 bis 1 ½ Jahre, nennt er die „orale Phase“. Danach beginnt, bis 3 Jahre, die „sadistisch-anale Phase“ und darauf folgt, von 3 bis 5/6 Jahren, die „phallische Phase“, an die sich eine Pausenperiode der Entwicklung anschließt, die „Latenzzeit“ genannt wird. Sie endet ungefähr mit dem 12. Lebensjahr. Die vierte Phase, die Pubertät, auch „genitale Phase“, ist bei Freud die letzte Stufe der psychosexuellen Entwicklung.
2. 4. 1. „Orale Phase“
Mit dem traumatischen Erlebnis der Geburt beginnt die „orale Phase“. Im Kind ist zunächst nur das „ES“ vorhanden. Das nach dem Lustprinzip arbeitende „ES“ wird durch die erogene Zone Mund befriedigt. Die Ernährung wird zur Lustmaximierung genutzt; ist in diesem Stadium also sexuell (Freud 1972, S. 15, 16).
Auch die destruktive Seite äußert sich, in Unlust, Treten, Schlagen und sadistischen Impulsen, die sich mit den ersten Zähnen in Beißen artikulieren können.
Für unsere sozialisatorische Betrachtung ist interessant, daß in dieser Phase die starke libidinöse Bindung zur Mutter und damit innige Beziehung mit der Umwelt, die Sozialisation schon beginnen läßt (Mühlbauer 1980, S. 34).
Schon ab etwa ½ Jahr beginnt der Prozeß der Identifikation durch Imitation (Mühlbauer 1980, S. 39).
Frustration ist Ausdruck der Reaktion auf die Umwelt und Motor zur Einflußnahme auf eben diese. Dabei sind der Grad der Abhängigkeit und die Modalitäten der Zuwendung die bestimmenden Faktoren bei der Sozialisation in diesem Alter.
2. 4. 2. „Sadistisch-anale Phase“
„Die Beherrschung der analen und urethralen Schließmuskeln führt zur Verschiebung des Lustzentrums“ (Mühlbauer 1980, S. 33).
Die erogene Zone ist nun der Anus und Lusterfahrung ist das Festhalten und Loslassen des Muskels. Destruktive Elemente finden, als Mischung mit Eros, in Sadismus ihren Ausdruck. So bildet die Befriedigung in Aggression, zum Beispiel sich beschmutzen mit den Exkrementen, den Ausdruck der Unlust. Durch die im Kapitel des „ICH“ beschriebenen Abläufe, bildet sich in dieser Phase das „ICH“ heraus. Erstes Anzeichen hierfür ist der Stolz auf das selbst produzierte Exkrement.
Sozialisationstheoretisch führt die Frustration zur Realitätsprüfung und somit zur Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Durch diese wechselseitigen Einflüsse aus dem „ES“ und der Außenwelt entsteht ein einmaliges „ICH“.
2. 4. 3. „Phallische Phase“
Bis zu dieser Phase verläuft die Entwicklung von Jungen und Mädchen gleich. Der Knabe entdeckt als erogene Zone seinen Phallus, das Mädchen, als Phallusersatz, ihre Klitoris.
Der sich nun anbahnende Prozeß wird, nach der griechischen Sage, in der ein Königssohn unwissend seinen Vater tötet und seine Mutter heiratet, „Ödipuskomplex“ genannt. Analog dazu gibt es beim Mädchen die „Elektraphase“. Das Luststreben findet seinen Ausdruck in den Sexualfunktionen, von denen das Kind bereits eine, wenn auch grobe Vorstellung hat. Als destruktiven Aspekt beschreibt Mühlbauer (1980, S. 35) sogar den phantasiemäßigen Gebrauch des Penis als Waffe.
Lustgewinn durch manuelle Betätigung der Genitalien und reiben an der Mutter führt beim Knaben zum unbewußten Wunsch, der Gatte der Mutter zu sein und den Rivalen, den Vater, zu beseitigen. Da dieses aus Furcht vor Vergeltung des Vaters und Liebesverlust der Mutter, verdrängt werden muß, entsteht eine Identifikation mit dem Stärkeren, dem Vater, um an dessen Macht lustvoll teilzuhaben.
Der Anblick des weiblichen Genitals führt zur Verstärkung der Furcht vor Vergeltung, der sogenannten Kastrationsangst. Dieses Trauma schafft den Übergang in die Latenzzeit.
Außerdem zertrümmert die Andersartigkeit der Mutter die Identifikation mit ihr und führt, in Kombination mit der Macht des Vaters, zur Identifikation mit ihm. Das Mädchen sieht sich anfangs ebenfalls in der Mutter und erkennt in ihrer Penislosigkeit gegenüber dem Vater die Unmöglichkeit der Befriedigung der Mutter. Sie wünscht sich von der Mutter einen Penis als Geschenk. Durch den versagten Penis entsteht Haß auf die Mutter und Eifersucht. Es drängt sie zum Vater, dessen Penis sie zur Verfügung wünscht. Dies gipfelt in dem Wunsch, von ihm ein Kind geschenkt zu bekommen. Der Kinderwunsch tritt nun an die Stelle des Peniswunsches (Freud 1972, S. 50). So versucht das Mädchen, beim Vater die Mutter zu ersetzen. Um für den Vater attraktiv zu erscheinen, identifiziert sie sich mit der Mutter (Tillmann 1989, S. 65). Dies wird aber, ebenfalls aus Angst Liebesverlust und Furcht vor Vergeltung, verdrängt.
Das Mangelgefühl des Mädchens, aufgrund der Penislosigkeit, führt schließlich zur endgültigen Identifikation mit der Mutter. Ihr bleibt somit zwar das wesentliche Trauma der Kastrationsangst erspart, dafür entsteht aber ein Mangelgefühl, das sogar zur Abwendung von der Sexualität überhaupt führen kann (Freud 1972, S. 49).
Beiden gemeinsam ist der unbewußte Wunsch nach Auslöschung der Konkurrenten (Geschwister).
Dieser Prototyp der Entwicklung verläuft vorherbestimmt, auch ohne diese idealen Voraussetzungen (Kleinfamilie), in ähnlicher, abgewandelter Form immer gleich.
Die genitalen Wünsche haben auch erhebliche Wirkung auf die Auseinandersetzung mit der Außenwelt.
Die wahrgenommenen Zurückweisungen und somit Normen (Inzestverbot), bilden nun den Prototyp des Gewissens.
Die internalisierten Normen und Werte hinterlassen einen Abdruck im „ICH“ und es bildet sich das „ÜBER-ICH“ heraus. Durch diese Internalisierung findet eine Identifikation mit der Außenwelt statt. Ein weiterer Schritt der Sozialisation ist damit vollendet.
Die „phallische Phase“ bildet den Höhepunkt der Sozialisation des Kindes.
Jetzt sind alle Ebenen des „ICH“ ausgebildet, jedoch im Bereich der Objektbeziehung noch nicht ausgereift.
2. 4. 4. „Latenzzeit“
Diese Zeit ist, nach Freud, keine eigenständige Phase der psychosexuellen Entwicklung, da dieser Reifungsprozeß bis zur nächsten Stufe ruht. Freud schreibt in einer Fußnote (1972, S. 15) einen interessanten, möglichen Erklärungsansatz aus seiner Zeit.
„Die Vermutung, daß der Mensch von einem Säugetier abstammt, das mit fünf Jahren geschlechtsreif wurde ... irgendein großer, äußerer Einfluß auf die Art hat dann die geradlinige Entwicklung der Sexualität gestört “
2. 4. 5. „Genitale Phase“
Freud spricht im Rahmen der Pubertät von der „genitalen Phase“. In dieser Entwicklungsstufe wird die Organisation der Objektbeziehungen vollendet und die Fähigkeit zum Orgasmus erworben.
Sozialisationstheoretisch interessant ist die Verinnerlichung der Außenwelt in Form der Identifikation mit Idolen, Vorbildern und Helden.
2. 5. Kritik und Ausblick
Brenner beschreibt den Sozialisationsprozeß nach Freud treffend, wenn er sagt, daß animalische Begierden, durch die Erfahrungen der Kindheit geformt, lebenslang die Hauptmotivation für das menschliche Handeln bilden (Brenner 1967, S. 219). Triebsublemierung wird zum Hauptmotor der Sozialisation, nach Freud.
Hauptkritikpunkt an der dargestellten, Freudschen Lehre sind seine Frauenfeindlichkeit, das Ausgehen von der Kleinfamilie und die mechanische Sicht der Triebe (Tillmann 1989, S. 69). Freud hätte die Unterdrückung der Frauen in dieser patriarchalen Zeit nicht erkannt und seine Grundthese des „Penisneides“ sei Ausdruck dieses Fehlers.
Dieser Punkt könnte widerlegt werden, wenn er symbolisch verstanden würde, als Neid an der Machtposition des Mannes in der Gesellschaft (Tillmann 1989, S. 70, 71).
Eine solche Deutung scheint jedoch nicht realistisch, hat Freud zu Lebzeiten doch selbst mehrfach darauf hingewiesen, daß ihm die weibliche Psyche erhebliche Probleme bereitet. An der Weiterentwicklung seiner Theorie wurde deshalb besonders in diesem Bereich gearbeitet.
Im gleichen Atemzug kann die Reduzierung auf die Kleinfamilie genannt werden. Hierbei muß meiner Meinung nach jedoch der psychologische Blickwinkel Freuds berücksichtigt werden, der als Ausgangspunkt jeglicher Betrachtung das Individuum hat. Die Gesellschaft wird hier durch den Einfluß der Familienmitglieder mit eingebracht. Entstand doch ihre Persönlichkeitswerdung unter spezifischen gesellschaftlichen Bedingungen und die wiederum unter speziellen, kulturhistorischen Aspekten (Tillmann 1989, S. 17). Der Kritikpunkt der mechanischen Sichtweise des Triebbegriffes, bei dem alles nach physikalischen Gesetzen abzulaufen scheint, wurde von seinen Nachfolgern ebenfalls überarbeitet (vgl. Emotionen).
3. Hauptteil II Talcott Parsons
3. 1. Zur Person
Parsons wurde 1902 als Sohn eines Pfarrers, der später Dekan und Präsident eines Colleges war, in Colorado geboren. Nach dem Besuch des Colleges in Amherst studierte er, bis zum ersten Examen, Medizin und Biologie, entschied sich dann jedoch, mit Hilfe seines Onkels, für die Wirtschaftswissenschaften und wechselte nach London.
Hier orientierte er sich erneut um und studierte nun Anthropologie und Soziologie. Durch ein Stipendium gelangte er nach Heidelberg. Hier kam er vor allem mit der Theorie von Max Weber in Berührung. Nach Ablauf des Stipendiums machte er seinen Abschluß in Amherst, wo er auch seine Doktorarbeit schrieb. Ab 1927 lehrte er in Havert Wirtschaftstheorie und wurde schließlich, ab 1929, Mitglied in der dort neu gegründeten Abteilung für Soziologie. Hier bildete er sich im Bereich Philosophie und Medizin ständig weiter. Bemerkenswert ist, daß er es in der Psychoanalyse bis zur Befähigung zur therapeutischen Behandlung geschafft hat, die er allerdings, als nicht Mediziner, nicht ausüben durfte.
Diese enorme wissenschaftliche Kraft spiegelt sich auch in seiner großen Produktivität wider, mit deren Hilfe er kontinuierlich, in über 40 Jahren fast, 200 Werke, Beiträge und Abhandlungen veröffentlichte, die in ihrer Gesamtheit ein umfassendes Theoriegebäude bilden. Eben diese Fülle bildet aber auch die Schwierigkeit bei einer Annäherung an seine Theorien.
„Parsons Werk ist ein Labyrinth; ein Koloseum von Begriffen und Konzepten, daß vermutlich dazu verurteilt ist, als gigantische Geistesruine am Wege der Geschichte zurückzubleiben“ (Jensen 1980, S. 7).
Zu seinen Lebzeiten, in den 50er und 60er Jahren, beherrschte sein Erklärungsmodell die Soziologie in den USA fast völlig (Mühlbauer 1980, S. 61). Sein Gesamtwerk sollte ein Erklärungsmodell für alle Humanwissenschaften bereitstellen und unterscheidet sich dadurch von allen anderen Ansätzen bis zu dieser Zeit. Daraus erklärt sich auch sein Interesse an anderen Humanwissenschaften und den Versuch der Integration in seine Theorie (Mühlbauer 1980, S. 62).
Sein Gesamtwerk kann, gemäß Jensen (1980, S. 11), grob in drei Phasen eingeteilt werden. In eine erste „Grundlagen- oder Fundamentierungs-Phase“, in eine zweite, in der er die Theorie der Sozialsysteme konzipierte und eine dritte Phase, in der er die Theorie der „Interaktions-Medien“ entwickelt hat.
„Parsons hat erstmals einen theoretischen Entwurf vorgelegt, in dem alle vier Ebenen des Sozialisationsprozesses (Subjekt, Interaktion, Institution, Gesamtgesellschaft) thematisiert und systematisch aufeinander bezogen werden“ (Tillmann 1989, S. 36).
Für die weitere Betrachtung in dieser Arbeit sind vor allem die erste Phase, mit seiner Handlungstheorie und die zweite Phase, mit der Theorie sozialer Systeme, interessant.
3. 2. Einführung: Sozialisationstheorie
Als Grundlage der Sozialisationstheorie bei Parsons steht die „Handlungstheorie“. Er verbindet in seinem Ansatz die individuellen, psychischen Prozesse mit den gesellschaftlichen Sozialstrukturen (Hurrelmann 1986, S. 41).
Sein Handlungsbegriff tritt immer in spezifischen sozialen Konstellationen auf, die er Systeme nennt.
Systembildung bei Parsons ist ein genereller Problemlösungsmechanismus. „Menschliches Handeln führt zum Aufbau empirischer Handlungssysteme; diese müssen mittels theoretischer Systeme rekonstruierbar sein“ (Jensen 1976, S 28). Diese Handlungssysteme sind nicht konkret, sondern nur empirisch feststellbar. Das zielgerichtete, menschliche Handeln versteht Parsons als eine Spezialform des Verhaltens. Dabei bildet ein verinnerlichtes Außenweltmodell die „Brille“, durch die ein Mensch eine Handlungssituation wahrnimmt. In der Handlungssituation wird, durch die reflexive Betrachtung, dem Menschen seine eigene Identität bewußt.
Um sich der Theorie der sozialen Systeme zu nähern, schlägt Jensen (1976, S. 20) den Umweg über die Handlungstheorie vor, von der er meint, „..., daß Sozialsysteme in erster Linie als Handlungssysteme begriffen werden müssen.“ Die von Parsons entwickelte Theorie wird gemäß ihrer Arbeitsweise auch „strukturell-funktional“ genannt.
3. 3. Voraussetzung der Handlungstheorie
Voraussetzung für diese Handlungstheorie sind die Menschen und ihr sinnvolles Sozialverhalten untereinander. Anthropologisch setzt Parsons, gemäß Jensen (1976, S. 21), die Mängelsituation jeden Individuums voraus (vgl. „Mängelwesen“ bei Herder und Gehlen).
Diesem Mangel in einer, für den Menschen zunächst lebensfeindlichen Umwelt, kann er sich durch aktives Handeln entziehen und eine zweite, künstliche Lebenswelt erschaffen. Dazu hat der Mensch ein überdimensionales Gehirn gegenüber dem Tier, daß jedoch zu einem weiteren Grundproblem führt. „Das Ausgangsproblem liegt also in der `Reizüberflutung`, die mit der anthropologischen Weltoffenheit zusammenhängt. Es gibt keine natürlichen `Filter`, die den Umweltbogen auf einen schmalen Sektor reduzieren; nichts in der Natur sagt dem Menschen mit ausreichender Klarheit, wie er sich verhalten muß.
Das Verhalten des Menschen kann daher keine bloße Reaktion sein. Er ist auf schöpferisches Handeln angewiesen“ (Jensen 1976, S. 20).
Außerdem geht Parsons von einer extremen Plastizität und Sensitivität des menschlichen Organismus aus. Diese sind wiederum wesentliche Bedingungen für die Fähigkeit zu richtigem oder falschem Lernen (Parsons 1968, S. 30). Der Handlungstheorie setzt nach Jensen (1976, S. 29) somit vier Bedingungen voraus.
1. Verhalten ist zielgerichtet, bzw. es orientiert sich an antizipierten Erfüllungszuständen.
2. Es findet in konkreten Situationen statt.
3. Es ist normativ geregelt.
4. Es erfordert einen bestimmten Aufwand an Energie oder Motivation.
3. 4. Handlungstheorie
Die Handlungstheorie untergliedert sich in verschiedene, primäre Subsysteme des Handelns und zwei Umwelten dieser primären Systeme. Die Subsysteme selbst zerfallen in weitere Untersysteme.
Die Umwelten sind einmal die physisch-organische und die transzendente Wirklichkeit. Einmal ist die Materie und die niederen, uns umgebenden Lebewesen gemeint, im anderen Fall eine übernatürliche Göttersphäre. Die primären Subsysteme sind sozialer, kultureller, organischer und persönlicher Natur.
Allen gemeinsam ist ein Funktionsschema aus vier Funktionskategorien, die, in Abhängigkeit von den Funktionserfordernissen der Umwelt, die einzelnen Systeme differenzieren.
3. 4. 1. Das „kulturelle System“
Die höchste Stufe nimmt bei Parsons das kulturelle System ein. Es steht im kybernetischen Sinne an oberster Stelle im Gesamthandlungssystem. Das menschliche Handeln ist immer kulturbezogen, denn ein Sinn in Handlungen entsteht erst durch spezifische, kulturelle Eigenheiten, z.B. das symbolische System der Sprache oder ein Kopfnicken, das in anderen Kulturen als „Nein“ gedeutet wird (Parsons, 1976, S. 121).
Der kulturelle Rahmen bildet einen Selektionsmechanismus, der unsere Wahrnehmung wie ein Filter steuert und zu spezifischem, zielorientiertem Verhalten führt (evaluative Orientierung). Parsons hat zur Verdeutlichung dieses Mechanismus eine Anzahl von binären Wahlmöglichkeiten, eine Art Schablone aus jeweils entgegengesetzten Möglichkeiten (pattern variables), herausgearbeitet (Jensen 1976, S. 35).
Das kulturelle System ist auch der Ort der Normen und Werte. Normen sind hier primär sozial regulativer Bedeutung, z. B. Rechtssystem, während Werte das Mustergültige darstellen (Parsons 1976, S. 140).
Dem kulturellen System kommt es auch zu, die Wertebildung gegenüber der letzten Wirklichkeit zu strukturieren (Religion).
3. 4. 2. Das „soziale System“
Die nächst niedere Schicht in der Regelungs- und Steuerungshirarchie der Systeme nimmt das soziale System ein. Wie bereits in den Voraussetzungen beschrieben, ist der Mensch ein soziales Wesen, das durch interaktive Aspekte gesteuert wird. Interaktionen zwischen Individuen fallen somit in dieses System. Die Gesamtheit aller Interaktionen konstituieren das Sozialsystem (Parsons 1976, S. 123, 124). Das besondere Problem dieses Systems ist es, daß die Individuen, also Elemente, Akteur und Objekt, jeweils wieder Subsysteme anderer, primärer Handlungssysteme sind. So ist eine Person mit einem spezifischen Persönlichkeitssystem und einem Organismussystem, mit einem kulturellen Hintergrund, Element dieses sozialen Systems.
Ein Subsystem ist die Gesellschaft.
„Gesellschaft ist die Klasse von Sozialsystemen, die den höchsten Grad an Autarkie (self-sufficiency) als System im Verhältnis zu ihrer Umwelt erreichen“ (Parsons 1976, S 126).
Der Kern der Gesellschaft ist normativer Natur. Mit dieser normativen Ordnung aus Werten, Normen und Regeln kann im Handlungszusammenhang entschieden werden, wer dazugehört und wer nicht. Im sozialen System ist somit die Mitgliedschaft mit dem Hintergrund des kulturellen Systems entscheidbar. Zur Durchsetzung der Normen ist die Gewalt über Sanktionsmittel gegenüber äußeren und inneren Feinden nötig (gegen äußerliche Feinde => Armee, gegen innere => Polizei).
Die Mitglieder, also das gesellschaftliche Kollektiv, kann hierzu als Einheit oder mit seinen Subsystemen reagieren. Die Gesamteinheit nennt Parsons gesellschaftlich organisiertes Gemeinwesen, in dem die Mitglieder, gemäß eines normativen Ordnungssystems und durch gesellschaftliche Stellung, Rechte und Pflichten inne haben. Um in dieser Gesellschaft ein Gemeinschaftsgefühl, eine Identität, aufkommen zu lassen, muß zumindest über eine Basis einheitlicher, kultureller Orientierung Übereinstimmung herrschen. Außerdem ist ein hinreichender Grad von Integration und Solidarität sowie ein klares Statussystem nötig.
Schließlich muß die Gesellschaft für ihre Mitglieder genügend Rollenmöglichkeiten zur Verfügung stellen, um alle Gesellschaftsmitglieder zufriedenzustellen. Strukturkategorien der Gesellschaft sind hier Werte, Normen, Kollektive und Rollen, die nach Parsons (1976, S. 138, 139) wieder nach dem „AGIL-Schema“ funktionieren und nur gemeinsam auftreten.
Als Wechselbeziehung zum kulturellen System braucht das soziale System die Legitimation der normativen Gesellschaftsordnung. Der Grad der Unabhängigkeit vom kulturellen System ist nach Parsons symptomatisch für den Grad der Entwicklung einer Gesellschaft (z.B. Trennung Staat und Kirche). Die Normen und Werte des kulturellen Systems sind die Verbindung zum sozialen System.
Das soziale System, hier das Subsystem der Gesellschaft, vermittelt seinen Mitgliedern Techniken zur Beeinflussung der physischen Welt (Handwerkerlehre, Ausbildung allgemein etc.). Damit greift das soziale System in die physischorganische Umwelt ein. Weitere Subsysteme im sozialen System sind unter anderem politisch und ökonomisch.
3. 4. 3. Das „Persönlichkeitssystem“
Im Regelkreis unter dem Sozialsystem kommt nun das Persönlichkeitssystem. Es ist der Ort alles Psychischen und der Ort, wo Sozialisation greift. Aufgrund der Auseinandersetzung mit allen anderen Handlungssubsystemen und den Umwelten, entsteht ein jeweils, in seiner Geschichte und seinen Anlagen einmaliges, selbständiges System.
Zur Verdeutlichung führt Parsons (1976, S. 123) an, daß ein Akteur genetisch zur Gattung Mensch gehört, seine Lernprozesse in einem spezifischen Kultursystem ablaufen und sich so ein einzigartiges, spezifisches Persönlichkeitssystem bildet. Dieses einmalige System hat sich durch Lernprozesse gebildet und enthält auch Elemente der anderen Systeme. Es ist jedoch nicht weiter zerlegbar, d. h. die Elemente können nicht mehr eindeutig zurückgeordnet werden. Eine Aussage Heraklits verdeutlicht dies, der bemerkte, daß man nie zweimal in den selben Fluß steigen könne. Die Einmaligkeit der Lebensumstände auf der Zeitachse führen daher zur Selbständigkeit des Persönlichkeitssystems.
Die Verbindungen zum sozialen System sind mannigfaltig. Das Kind muß durch Lernprozesse die adäquate Motivation entwickeln, um im sozialen Kontext von anderen Interaktionspartnern sozial bewertet und gesellschaftlich kontrolliert werden zu können.
In einem Komplex aus Prozessen wird der Status eines Mitgliedes des gesellschaftlichen Gemeinwesens erworben (Sozialisation). Die Gesellschaft verlangt im Sozialisationsprozeß vom Persönlichkeitssystem jedes Individuums eine hinreichende Motivation und die Bereitschaft, Normen zu befolgen. Weiter muß das Individuum zentrale Wertemuster internalisieren, die Notwendigkeit von sozialen Interaktionen und Intimbeziehungen einsehen und außerdem Leistung und Aktivität zeigen. Diese drei Hauptaufgaben sind auch die Orte des „ES“, „ICH“ und „ÜBER-ICH“ im Sozialisationsprozeß, gemäß Freud.
Für erfolgreiche Sozialisation erhält das Individuum vom sozialen System Befriedigung und Belohnung, was wiederum zu Motivation im Persönlichkeitssystem führt (Parsons 1976, S. 131 - 135).
Zum letzten primären Subsystem, dem Organismussystem, hat das Persönlichkeitssystem innige Verbindung. Organische Grundprozesse garantieren die Energieversorgung, Lustmechanismen steigern die Motivation. Umgekehrt übt das Persönlichkeitssystem jedoch Zwang aus.
3. 4. 4. Das „Organismussystem“
Das letzte System, das schon angesprochene Organismussystem, organisiert das Verhalten unter physiologischen Aspekten.
So ist für das Handeln immer auch z. B. der Sättigungs- und Müdigkeitsgrad des Individuums von Bedeutung. Das System ist eingebettet in die physische Umwelt.
3. 4. 5. Funktionskategorien der Systeme - „AGIL“
In der Ausführlichkeit der Behandlung der primären Subsysteme des Handelns ist klar zu erkennen, daß Parsons die Welt aus soziologischer Sicht betrachtet und in diese Weltsicht die psychologische Ebene der Persönlichkeitswerdung mit einzubeziehen versucht. Auch das Anliegen, mit dieser Theorie allen Humanwissenschaften ein Werkzeug an die Hand zu geben, ist meiner Meinung nach ein Ausdruck dieser Subsysteme (Persönlichkeitssystem = Psychologie, soziales System = Soziologie, Organismussystem = Biologie, kulturelles System = Philosophie, physische Umwelt = Physik, transzendente Wirklichkeit = Religionswissenschaften).
Die einzelnen Systeme sind gekennzeichnet durch gegenseitige Durchdringung (Interpenetration) und Abgrenzungsmechanismen. Ihre Funktionsweise beschreibt Parsons mit den „AGIL“ Funktionskategorien.
Das „A“ steht für Adaption, also der Funktion der Anpassung der Systeme. Es ist ein wechselseitiges arrangieren mit anderen Systemen, also Umwelten. Das „G“ steht für Goal Attainment / Selection, der Funktion der Zielorientierung. Es ist eine Zielhierarchie, die das jeweilige System auf Kurs hält, eine „... Diskrepanz zwischen den System Bedürfnissen und den Bedingungen der Umwelt“ (Parsons 1976, S. 174).
„I“ ist Integration. Zur Erreichung der Systemziele müssen einzelne Systemelemente miteinander verbunden werden.
Schließlich meint das „L“, für Latent Pattern, eine Strukturorganisation, die beim Strukturaufbau Systemelemente ausrichtet und die Grundstrukturen bewahrt. Jedes primäre Subsystem funktioniert nach diesen Funktionskategorien und betont eine dieser Kategorien, im Zusammenhang des Handlungssystems, besonders.
So hat das kulturelle System primär die Funktion der Strukturerhaltung, das soziale System die Funktion der Integration der Handlungseinheiten, das Persönlichkeitssystem die der Zielerreichung und das Organismussystem die der Anpassung.
(Parsons 1976, S. 172 - 177)
3. 5. Sozialisationsbegriff bei Parsons
Sozialisation findet im Kontext aller Subsysteme statt und bildet in ihrer Wirkung das Persönlichkeitssystem. Es erfordert die Einbeziehung der Lustmechanismen des Organismus in die sozialen und kulturellen Lernprozesse (Parsons 1976, S. 131).
Voraussetzung ist eine stabile Intimbeziehung zwischen Kleinkind und Erwachsenen, deren eigene erotischen Motive und Beziehungen tief in die Persönlichkeit des Kindes eingehen. Verwandtschaft regelt hier die erotischen Beziehungen der Erwachsenen. Die Verwandtschaft bestimmt auch zunächst den Status des Kindes und somit wieder den Sozialisierungsprozeß. Durch Normen und Werte geschaffene Verhaltenserwartungen der Erwachsenen, müssen durch das Kind internalisiert werden, als Konsensbasis für das gesellschaftliche Gemeinwesen. Durch Interpretation von Verhaltensstrukturen, anderen Persönlichkeiten, Sozialsystemen und physischer Umwelt entsteht ein einmaliges, neues System. Die Belohnung aus dem Sozialsystem geht einher mit einer Statuserhöhung und verstärkt den leistungsbezogenen Aspekt in der Sozialisation. Das Kind erhält unter anderem ein gemeinsames Symbolsystem. Dafür verlangt die Gesellschaft Loyalität und Verpflichtung. (Parsons 1968, S. 30).
Mit den Grundnormen erhält das Kind eine Schablone für das, was Recht und Unrecht ist und kann dieses Wissen generalisierend anwenden, wodurch aktive, eigene Handlungen abgestimmt werden können.
Es entsteht ein neues Mitglied für die Gesellschaft. Ein erster Schritt ist es, eine Rolle zu lernen, der zweite Schritt, sie mit Zielen zu verknüpfen (Parsons 1976, S. 134).
Die sich in der Auseinandersetzung mit dem sozialen und kulturellen System gebildete Persönlichkeitsstruktur ist ,aufgrund der einmaligen Lebenserfahrung und Beziehung zum Organismus, einzigartig (Parsons 1968, S. 3).
Der Begriff der Rolle nimmt bei Parsons einen zentralen Stellenwert im Sozialisierungsprozeß ein.
Das Durchdringen der verschiedenen Systeme während der Interaktion mit anderen, führt zum erlernen von Rollenmustern, und zwar sowohl die von dem Individuum erwarteten, als auch die von seinem Gegenüber. Es werden also immer zwei Rollen gelernt. Die Rollen selber sind wieder Bündelungen aus Werten, Normen, Erwartungen, organischen Voraussetzungen etc., also Teile aus allen Systemen. Somit steht der Begriff der Rolle auch für das gegenseitige Durchdringen.
Im Prozeß der Persönlichkeitsbildung wird das Individuum kulturell geprägt, sozial gesteuert und hat gewisse organische Voraussetzungen.
Wie bereits erläutert, hat das Persönlichkeitssystem, und somit die Persönlichkeitsbildung, eine primär „zielgerichtete“ Funktion (Goal Attainment). Eine Bedürfnisdiskrepanz wird auszugleichen gesucht. Die organische Basis hat gewisse Bedürfnisse, die zunächst noch diffus sind, später aber, mit der Möglichkeit der Objektbesetzung, sozial konkret werden (vgl. Freud „Objektbesetzung“). Objekte werden mit Lust besetzt und geben in der nächsten Stufe Liebe zurück, die beim Individuum wieder zu höherer Motivation führt.
Durch Bestätigung /Belohnung auf der einen und Ablehnung/Bestrafung auf der anderen Seite, werden erlernte, konkrete Verhaltensmuster wahrgenommen und generalisiert.
Dieses generalisierte Muster ist eine Schablone, mit deren Hilfe fortan eigenes und fremdes Handeln beurteilt werden kann.
Die Motivation aus den Bedürfnissen ist die Energiequelle der Sozialisation (vgl. Freud „Trieblehre“). Die Persönlichkeitsbildung kann also auch als eine Strukturierung (patterning) des Motivationssystems verstanden werden, die durch die Internalisierung von Systemen, sozialen Objekten und institutionalisierter Kulturmuster geformt wird (Parsons 1976, S. 171).
„Die Sozialisationsfunktion kann zusammenfassend gekennzeichnet werden als die Entwicklung von Bereitschaften und Fähigkeiten der Individuen als wesentliche Voraussetzung ihrer späteren Rollenerfüllung“ (Parsons 1968, S. 162). Die Identifikation mit der Mutter ist zum Beispiel nötig, um die eigene Rolle des unterlegenen Kindes und die Rolle der Mutter zu lernen. Die Motivation dazu erfährt das Kind zunächst in Form eines diffusen Bedürfnisses nach organischer Befriedigung und später, mit Hilfe der Objektbesetzung, direkt durch Lob und Tadel der Mutter und Anderer.
Mühlbauer (1980, S. 76) teilt den Prozeß in drei Ebenen. Die erste Ebene bildet der „Internalisierungs- und Integrationsprozeß“, die zweite Ebene der „Differenzierungsprozeß“ und die dritte Ebene der „Lernprozeß“.
Die erste Ebene funktioniert gemäß der schon erläuterten Internalisierungsprozesse mit sozialen Objekten. In der zweiten Ebene sind die Differenzierungsprozesse gemeint, die Parsons unter dem Namen pattern variables einführt. Sie sind Orientierungsdimensionen, die ein Akteur in einem Handlungssystem zur Verfügung hat, um in einer Situation eine Auswahl zu treffen (Mühlbauer 1980, S. 80).
Die fünf Orientierungsalternativen werden in den einzelnen Phasen, wenn sie jeweils ausgeprägt werden, im folgenden vorgestellt.
Der „Lernprozeß“ beschreibt den Übergang von einer Stufe des Gleichgewichts zur nächsten. Jede einzelne Phase „funktioniert“ gleich. Gemäß der Systemtheorie ist der Ausgangspunkt immer ein Gleichgewicht, daß durch eine veränderte Situation aus der Umwelt gestört wird.
Um wieder zielorientiert ein neues Gleichgewicht auf höherem Niveau zu erreichen, schraubt sich, in vier Lernstufen, eine Spirale auf die nächste Gleichgewichtsebene. Eine Gleichgewichtsebene ist jeweils eine Phase der Entwicklung.
Die Lernstufen im einzelnen sind (Mühlbauer 1980, S. 82):
1. Permissivität: das Individuum kann seinem Frust Ausdruck verleihen.
2. Unterstützung: die Außenwelt zeigt dem Individuum einen Weg zum Abbau der Frustration
3. Verweigerung der Reziprozität: die Außenwelt verweigert ihre Anpassung und drängt weiter auf die Anpassung des Individuums.
4. Selektive Belohnung: durch Lob und Tadel wird das Individuum in der neuen Richtung bestärkt.
Das entstandene Persönlichkeitssystem funktioniert schließlich wieder nach dem „AGIL“-Schema.
3. 6. Phasen der Sozialisation
Die wesentlichen Elemente oder Triebfedern in den einzelnen Phasen waren bei Freud noch Identifizierung, Objektbesetzung und Verinnerlichung. Freud schrieb jeder Phase einen primären Faktor zu. In der oralen Phase die Identifizierung, in der analen Phase die Objektbesetzung und in der ödipalen Phase die Verinnerlichung. Parsons dagegen sieht alle drei Faktoren in jeder Phase vorliegen.
Für ihn sind Objektbeziehungen durch Identifizierung, Objektbesetzung und Verinnerlichung für die gesamte Sozialisation und vor allem für die Persönlichkeitsbildung entscheidend.
Er übernimmt die Begriffe des „ES“, „ICH“ und „ÜBER-ICH“ und integriert sie in seine Theorie; jedoch sieht er keine klaren Grenzen und Funktionsunterschiede unter ihnen. So geht er zum Beispiel davon aus, daß das „ES“ auf den eigenen Organismus als Objekt ausgerichtet ist und das „ICH“ zum Beispiel, ebenfalls Wertemuster integriert hat.
Auffallend an seiner Systemtheorie ist, daß alle Systeme und Subsysteme stets die gleichen Funktionskategorien aufweisen, wobei die Betonung jeweils auf einer Kategorie liegt. So ist es nicht verwunderlich, daß der von Freud geprägte „psychische Apparat“ und seine Subsysteme ebenfalls alle die gleichen Funktionskategorien aufweisen. Die durchlaufenen Lernstufen jeder Phase können auch jeweils einer Gesamtphase als vorherrschendes Prinzip zugeordnet werden. So zum Beispiel der Phase der oralen Abhängigkeit, die Permissivität, der Phase der Liebesabhänigkeit, die der Unterstützung, der ödipalen Phase, die der Verweigerung von Reziprozität und schließlich der Latenz und Adoleszenz, die der Belohnungsmanipulation (Mühlbauer 1980, S. 92).
Da in der Kindheit immer die erotischen Triebe den Motor der Motivation bilden, ist es nicht verwunderlich, daß Freud bei den Neurosen stets auch auf eine erotische Komponente gestoßen ist. Diesem Punkt stimmt Parsons (1968, S. 130) eindeutig zu.
3. 6. 1. „Orale Abhängigkeit von der Mutter“
Das embryonale Gleichgewicht auf organischer Ebene wird durch die Geburt (orale Krise) gestört. Das Kind muß lernen, daß Triebbefriedigung vom Handeln abhängt. Es bringt dazu angeborene Bedürfnisse und Instinkte mit in die Welt. Der Saugreflex ist angeboren, jedoch muß weiter gelernt werden, um eine optimale Versorgung zu erreichen.
Zunächst richtet sich die Mutter beim Füttern nach dem Säugling. Das Kind wird durch Sättigung in seinem Verhalten unterstützt. Später versucht sie dem Säugling beizubringen, auch eine verzögerte oder alternative Fütterung zu akzeptieren, dazu verweigert sie die alten Muster.
Schließlich setzt sie Sanktionen ein, um das Kind zum erwünschten Verhalten zu führen. Primäres Objekt für die Befriedigung ist die Mutter, die zugleich auch erste soziale Interaktion mit dem Kind eingeht.
Bereits in den ersten Tagen seines Lebens, ist das Baby in ein soziales System integriert. Der Säugling generalisiert spezifische Elemente, aus Sanktion und Belohnung, zu Mustern (Parsons 1968, S. 106, 107). Die Rolle der Mutter wird mit besonderen Erwartungen verbunden. Befriedigung des Hungers wird in das Empfangen von mütterlicher Liebe generalisiert.
Das Kind beginnt, sich mit seiner Mutter zu identifizieren (Objektbesetzung) in ihrer Rolle als Quelle der Befriedigung und Fürsorge (Mühlbauer 1980, S. 80). Parsons (1968, S. 116) bezeichnet die Objektwahl als Motor der Sozialisation. Eine generalisierte Stimulierung führt zur oralen Erotik, die jetzt unabhängig von Nahrung ist.
In dieser Phase wird die Orientierungsalternative „Selbstorientierung“ versus „Kollektivorientierung“ internalisiert. Das Kind beginnt, zwischen seinen eigenen Bedürfnissen und denen, die mit der Mutter zusammenhängen, zu unterscheiden.
3. 6. 2. „Liebesabhängigkeit von der Mutter“
Die Reinlichkeitserziehung und ein erwartetes, höheres Maß an Selbständigkeit stören das alte Gleichgewicht (anale Krise). Die Liebe der Mutter ist nicht mehr selbstverständlich und muß durch spezifische Leistung erworben werden. Eine Differenzierung der Außenwelt ist die Folge.
Die Frustration über die neue Situation wird zunächst toleriert. Dem Kind wird immer wieder erwartetes Verhalten (z.B. Töpfchen) gezeigt. Ein weiteres tolerieren der alten Handlungsmuster (Windeln) wird verweigert und durch Sanktionen verstärkt.
Die Außenwelt beginnt nun, sich für das Kind zu differenzieren; es wird sich seiner Selbst und seiner Rolle bewußt. Das führt zur Internalisierung der Orientierungsalternativen Spezifität versus Diffusität.
Spezifität auf das Selbst bezogen und Diffusität auf die Mutter bezogen, die unspezifischer wird. Selbständiges Handeln kann nun eingeordnet werden.
3. 6. 3. „Ödipale Phase“
Durch einen Erotisierungsschub, wachsender Mobilität und Kommunikation wird das alte Gleichgewicht gestört (ödipale Krise). Dem Kind werden nun vermehrt Normen und Werte (z.B. Tischmanieren) abverlangt. Im ersten Schritt wird Frustration aus Unkenntnis toleriert, dann richtiges Verhalten gezeigt. Eine Änderung der anderen Familienmitglieder kommt nicht in Betracht. Durch Sanktionen und Bestätigung wird das Kind ermutigt, sich dem Rest der Familie anzupassen.
Die vorherrschende Zweierbeziehung zur Mutter wird ergänzt durch weitere Zweierbeziehungen zu den anderen Familienmitgliedern. Diese erlernten Subrollen des Kollektivs führen zur Differenzierung der gesamten Familienstruktur in zwei Kategorien (Parsons 1968, S. 120, 121):
1. Unterscheidung nach dem Geschlecht
2. Trennung nach Generationsunterschied.
Deshalb müssen drei Identifizierungen stattfinden. Mit der Familie als Kollektiv, dem eigenen Geschlecht und der eigenen Generation (Parsons 1968, S. 119).
In den Gesichtskreis des Kindes treten die anderen Mitglieder der Familie und ihre jeweilige Rolle. Das Kind selbst muß sich in dieses Kollektiv einordnen. In diesem Kollektiv, der Kernfamilie, steht die Elternrolle für Macht, die eigene bedeutet Ohnmacht. Die männliche Geschlechterrolle verweist auf instrumentelles Verhalten, die weibliche auf expressives.
Im Bezug auf den gleichgeschlechtlichen Elternteil folgt die Geschlechterrolleninternalisierung. Hierbei muß eine Tochter die Identifikation mit der Mutter nur auf höherem Niveau wiederholen, jedoch durch den Generationsunterschied ohne die Beziehung zum Vater.
Ein Sohn muß alte Identifizierungsmuster aufgeben und sich sowohl mit der eigenen Generation, als auch dem Geschlecht auseinandersetzen, um sich mit dem bedrohlichen Objekt Vater zu identifizieren. (Parsons 1968, S. 120 - 122). Das Kind muß hierbei, in der Beziehung zu seinen Eltern, je nach Geschlecht, zwei unterschiedliche, erotische Beziehungen aufbauen (Parsons 1968, S. 126). Das Geschlecht wird Ansatzpunkt für den eigenen Status und führt zu einer Bindung an den andersgeschlechtlichen Elternteil. Die Solidarität führt jedoch zu Zurückweisung und somit zum Bewußtsein der eigenen Generationsrolle. Diese Generationsrolle verbietet intime Erwachsenenspiele und verschiebt sie in die Phase der Adoleszenz.
Hierbei ist das Inzesttabu der Hauptmechanismus, um Wertemuster auf höherem Niveau zu internalisieren. Es dient als Vorbereitung, um später eine neue Kernfamilie aus zwei voneinander unabhängig sozialisierten Individuen zu bilden. Jetzt wird die Orientierungsalternative Neutralität versus Affektivität verinnerlicht. Der Vater wird hier vom Kind als neutrales Element angesehen. Die Rolle der Mutter ist dagegen für das Kind expressiv, da alle ihren Eigenschaften hinlänglich bekannt sind.
Das normative Muster, daß in der Familie als Kollektiv wirksam war, wird internalisiert und zum „ÜBER-ICH“. Wenn das „ÜBER-ICH“ internalisiert ist und mit höheren Wertemustern durchdrungen, ist eine wesentliche Voraussetzung gegeben, um später selbst Vorbild und Elternteil zu sein.
3. 6. 4. „Latenzphase“
Sowohl bei Freud, als auch bei Parsons ist der psychische Apparat jetzt ausgeprägt. Liegt bei Freud der Schwerpunkt in den ersten drei Phasen, so ist bei Parsons hier nur das Fundament gelegt.
Aus soziologischer Sicht beginnen nun die interessanten Aspekte mit Blick auf die Gesamtgesellschaft. Aus der Sicherheit der Kernfamilie sucht das Kind nun Beziehungen in der Schule und in der peer group.
Die Generationsdifferenz wird in der Schule weiter ausdefiniert und universelle Standards beigebracht. Die peer group dagegen trägt zur Ausdifferenzierung der Geschlechterrollen bei. Hierbei beginnt eine offener Wettstreit auf der Leistungsachse und im Bereich des Sozialstatus. Geschriebene Sprache und abstraktes Denken treten in den Vordergrund. Es gibt weiterhin Zweierbeziehungen, die jedoch diesmal in größeren Kollektiven eingebettet sind. Ein erheblich größerer Rollenkomplex erschließt sich dem Kind und es identifiziert sich mit Gemeinschaftsformen.
Es gibt somit eine größere Vielfalt im Gegensatz zur Kernfamilie, Voraussetzung für ein höheres Niveau der Werteverinnerlichung. Eine erotische Beziehung ist nicht mehr erforderlich, Befriedigung wird auf einer höheren Ebene erreicht (Lob des Lehrers, Statuserhöhung in der peer group etc.). Die Familie verliert nicht gänzlich an Bedeutung, sie tritt nur in den Hintergrund und schafft Sicherheit für die Ausflüge in die weitere Außenwelt (Parsons 1968, S. 131, 132).
Die Orientierungsalternative Universalismus versus Partikularismus schafft die Voraussetzung, um die einzelnen Rollen allgemeingültig im Gesamtkollektiv zu verstehen.
3. 6. 5. „Adoleszenzphase“
In der letzten Phase sind vier Gemeinschaftstypen außerhalb der Familie verinnerlicht.
1. die gesellschaftliche Gruppe der Gleichaltrigen (Jugendkultur)
2. die Schule, als Prototyp einer Organisation (Leistungsprinzip)
3. die Gruppe der Gleichaltrigen, als Prototyp gemeinschaftlicher Organe (gegenseitige Interessenvereinbarungen)
4. die Zweierbeziehung (erotische Faktoren)
Aus der ersten Ebene kann das Individuum Werte auf die Gesamtgesellschaft generalisieren. In der zweiten Ebene ist das für das berufliche Leben entscheidende Leistungsprinzip internalisiert worden.
Die dritte Ebene ermöglicht es, als mündiger, gesellschaftsfähiger Bürger, eigene Interessen mit anderen abzugleichen und Kompromisse zu finden, um sich so in Vereinen, Parteien etc. einzubringen.
Als letztes gibt es nun die Möglichkeit, in der einzig tolerierten Art und Weise die Sexualität in einer Zweierbeziehung auszuleben und somit eine neue Kernfamilie zu bilden (Parsons 1968, S. 133 - 135).
Mit dem Hintergrund eines höheren Werteniveaus, kann nun die in der Latenzphase ruhende Sexualität wieder aufgenommen werden und selbst eine Vorbildfunktion eingenommen werden, um ein neues Gesellschaftsmitglied zu sozialisieren. Die eigene Sozialisation ist jedoch noch nicht beendet. Sie geht weiter und tritt in drei Rollenbereichen in den Vordergrund; in der Zeugungsfamilie, im Berufssystem und in der Gesellschaft (Gemeinde, Nachbarn, Staat).
Als letzte Orientierungsalternative wird hierzu Zuschreibung versus Leistung internalisiert. Die libidinöse Energie tritt wieder in den Vordergrund und wird zum entscheidenden Motor für Partnersuche und Kindererziehung.
3. 7. Kritik und Ausblick
Die schon angesprochene Komplexität des Werkes von Parsons, führt auch fast zwangsläufig zu Mißverständnissen, aufgrund von Unkenntnis des Gesamtwerkes. Viele Aspekte, die in einer Arbeit offen zu sein scheinen, sind in Wirklichkeit schon Jahre vorher aufgearbeitet worden.
Folgende Hauptkritikpunkte führen Hurrelmann (1986, S. 44, 45) und Geißler (1979, S. 267 - 281) an:
1. Parsons betone einseitig den Sozialisationsprozeßals Vergesellschaftung. Persönlichkeit sei nur ein Spiegelbild der Sozialstruktur der Gesellschaft. Der Grund sei eine Fixierung auf Rolleninternalisierung ( Übersozialisation) und ein nur eingefügter, psychoanalytischer Anteil.
Daß der Interessenschwerpunkt auf dem sozialen System liegt, begründet sich fast zwangsläufig aus der soziologischen Betrachtungsweise Parsons. Der Punkt, daß er hierbei psychoanalytische Elemente additiv integriere, kann meiner Ansicht nach jedoch klar widerlegt werden. So betont er doch mehrfach selbst die Einmaligkeit des Persönlichkeitssystems und widmet sich der kritischen Weiterentwicklung Freudscher Gedanken in mehreren Aufsätzen. So hebt er die Trennungslinien im „psychischen Apparat“ auf und wandelt, in der Sozialisation, das Phasenmodell Freuds, ergänzt mit eigenen Teilen, zu einem systemischen Modell um.
In diesem Zusammenhang wird ihm auch vorgeworfen, der Gesellschaft eineübermächtige Rolle einzuräumen und das Individuum zu vernachlässigen.
Hier kann ebenfalls auf Parsons selbst verwiesen werden, der immer wieder betont, daß das Individuum im wesentlichen seine Persönlichkeitsstruktur aus der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt bildet, jedoch durch den Zeitaspekt und den eigenen Organismus eine Einzigartigkeit, ein unabhängiges System, entsteht. Weiterhin wirkt der Einfluß des kulturellen Systems nicht direkt, sondern wird im Rahmen des sozialen Systems, durch Rollenträger, vermittelt.
2. Die Tendenz des Gleichgewichts in Parsons Systemtheorie klammere Konflikte und abweichendes Verhalten völlig aus, ist ein weiterer Vorwurf.
Hier ist, nach Meinung Geißlers, Parsons Gesamtmodell falsch verstanden worden. Er setzt das Modell nicht dem Ist-Zustand gleich, sondern entwirft eine Metatheorie, die einen Idealtypus darstellt.
„Die Realität ist eine Mischung aus Gleichgewicht und Ungleichgewicht, aus Integration und Desintegration, aus harmonischer Abstimmung und Konflikt“ (Geißler 1979, S. 269).
Hier wird ihm ebenfalls vorgeworfen, daßer unterschwellig eine Abweichung vom Systemgleichgewicht als „ pathologische Erscheinung “ abtut. Die Kreativität und sozialer Wandel würden somit negativ besetzt.
Laut Geißler (1979, S. 276, 277) läßt sich dieser Kritikpunkt nicht völlig ausräumen. Die durchaus positive, zerstörerische Kraft sozialen Wandels wird nicht hinreichend in die Theorie integriert. Dies liegt vermutlich an der absolut bejahenden Grundhaltung gegenüber dem Ist-Zustand in der amerikanischen Gesellschaft bei Parsons.
Deshalb wird ihm auch vorgeworfen, auf bestehende Ä nderungsprozesse in der Werte- und Rollenstruktur nicht einzugehen und insbesondere die schichtspezifischen Eigenheiten zu vernachlässigen.
Hier sprechen die Werke Parsons eine deutlich andere Sprache. So beschäftigte er sich stets mit neuen Lehrmeinungen, anderen Theorien und insbesondere der Wandlungsprozeß in der amerikanischen Gesellschaft ist Gegenstand vieler Untersuchungen (z.B. „Über den Zusammenhang von Charakter und Gesellschaft“ oder „Die Schulklasse als soziales System“, „Jugend im Gefüge der amerikanischen Gesellschaft“ etc.).
Die Schwierigkeit im Umgang bei untersuchten Phänomenen erklärt wohl auch, warum an der Weiterentwicklung der Theorie nicht gerade viele Wissenschaftler arbeiten, sondern einen neuen Ansatz versuchen, um der Unverständlichkeit aus dem Wege zu gehen. Trotzdem haben Wurzbacher (1968) und Goffmann (1973) versucht, den Schwachpunkt in der Individualisierung auszugleichen. Dieser Versuch ist, nach Meinung Hurrelmanns (1986, S. 45, 46), nicht erfolgreich verlaufen, da nun Individualität nur gegen die Gesellschaft erklärt werden konnte und somit eine neue Trennlinie zwischen Vergesellschaftung und Individualisierung auftrat. Seiner Meinung nach muß an der Durchdringung und dem Austausch zwischen den Systemen noch gearbeitet und damit das Konfliktpotential aufgearbeitet und verdeutlicht werden.
4. Schluß
4. 1. Schlußbetrachtung
„Die Brauchbarkeit von Sozialisationstheorien wird also danach zu bemessen sein, ob es gelingt, das ineinander von Vergesellschaftung und Individuierung so darzustellen, daß die Möglichkeit eigenständigen, reflexiven und verantwortlichen Handelns ebenso verstehbar wird wie die Tatsache gesellschaftlich determinierten Handelns“ (Mühlbauer 1980, S. 26).
Der Freudsche Ansatz betont meiner Meinung nach die individuelle Seite, was naturgemäß auch mit der psychologischen Betrachtungsweise zusammenhängt. Parsons dagegen versucht diesen Mangel der Einseitigkeit auszugleichen, was ihm, meiner Meinung nach, im Persönlichkeitssystem und sozialen System auch gelingt, jedoch ist zum Beispiel die biologische Seite weiterhin vernachlässigt. Das verdeutlicht, denke ich, daß eine interdisziplinäre Betrachtung aus allen Humanwissenschaften nötig wäre, um diesem unglaublich komplexen Objekt Mensch gerecht zu werden. Die Betonung auch der organischen Seite scheint in der Psychologie vorangetrieben worden zu sein, so ist in der Psychoanalyse von Schülern C. C. Jungs (selbst ein Schüler Freuds) die körperliche Seite weiter in den Vordergrund getreten. Dies versicherte mir jedenfalls ein praktizierender Psychologe dieser Schule in einer Unterhaltung.
Sozialisiert wurde zu allen Zeiten in der Menschheit und wohl auch in der Zukunft. Die Sozialisation ist wohl das wesentlichste Moment, das die Menschheit antreibt, weiterentwickelt und somit zukunftsfähig macht. Diese Eigenschaft macht den Menschen so erfolgreich und gleicht die Mängelsituation mehr als aus. Die hieraus resultierende Annahme der Erziehungsbedüftigkeit des Menschen ist Grundlage der Pädagogik. Sozialisierungstheorien sind somit Grundvoraussetzung aller weiteren Betrachtungen. Über die Brauchbarkeit entscheidet meiner Meinung nach die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen und ein systematischer Vergleich mit der aktuellen Wirklichkeit.
Das Objekt der Betrachtung all dieser Theorien ist der Mensch, der in der Auseinandersetzung mit der älteren Generation und aktuellen, individuellen Ereignissen, ein einmaliges, neues Modell der Welt in seinem Kopf entstehen läßt. Die von mir vorgestellten beiden Ansätze sind auch Spiegelbilder ihrer Zeit und können somit in Zeiten des Wandels nicht als Paradigma stehen bleiben, sondern müssen sich , wie die Menschen, die sie beschreiben, stets weiterentwickeln.
In diesem Sinne stellt auch diese Seminararbeit, die Auseinandersetzung mit den klassischen Theorien und meine Interpretation und einmalige Wahrnehmung ein Stück meiner eigenen Sozialisation dar und wird hoffentlich Motor und Anregung für mich und andere sein, daran weiter zu arbeiten.
Anhang:
Literaturverzeichnis:
Primärliteratur:
Freud, Sigmund. (1972). Abriß der Psychoanalyse/Das Unbehagen in der Kultur. Frankfurt/Main: Fischer Taschenbuch Verlag GmbH
Parsons, Talcott. (1968). Sozialstruktur und Persönlichkeit. Frankfurt/Main: Europäische Verlagsanstalt
Parsons, Talcott. (1976). Zur Theorie sozialer Systeme. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH. Hrsg. von Jensen, Stefan
Sekundärliteratur:
Brenner, Charles. (1967). Grundzüge der Psychoanalyse. Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag GmbH
Geißler, Rainer. (1979). Die Sozialisationstheorie von Talcott Parsons. Köln: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 31
Hurrelmann, Klaus. (1976). Sozialisation und Lebenslauf. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
Hurrelmann, Klaus. (1986). Einführung in die Sozialisationstheorie. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
Jensen, Stefan. (1976). Einleitung zu „Zur Theorie sozialer Systeme“. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH
Jensen, Stefan. (1980). Talcott Parsons - Eine Einführung. Stuttgart: B. G. Teubner
Mühlbauer, Karl-Reinhold. (1980). Sozialisation - Eine Einführung in Theorien und Modelle. München: Fink Verlag
Häufig gestellte Fragen
Was ist der zentrale Begriff, der in der Einleitung der Arbeit definiert wird?
Der zentrale Begriff ist Sozialisation, als Basis aller weiteren Betrachtungen.
Welche Theorien werden in der Arbeit hauptsächlich behandelt?
Die Arbeit behandelt hauptsächlich die Sozialisationstheorien von Sigmund Freud und Talcott Parsons.
Was sind die drei Instanzen des "psychischen Apparates" nach Freud?
Die drei Instanzen sind das "ES", das "ICH" und das "ÜBER-ICH".
Welche Phasen der psychosexuellen Entwicklung werden nach Freud unterschieden?
Es werden die orale Phase, die sadistisch-anale Phase, die phallische Phase, die Latenzzeit und die genitale Phase unterschieden.
Was ist der "Ödipuskomplex"?
Der "Ödipuskomplex" ist ein Konzept Freuds, das den unbewussten Wunsch des Kindes beschreibt, den gleichgeschlechtlichen Elternteil zu beseitigen und den andersgeschlechtlichen Elternteil zu besitzen.
Was sind die Hauptkritikpunkte an Freuds Theorie?
Hauptkritikpunkte sind seine Frauenfeindlichkeit, das Ausgehen von der Kleinfamilie und die mechanische Sicht der Triebe.
Wer war Talcott Parsons?
Talcott Parsons war ein Soziologe, der ein umfassendes Theoriegebäude zur Erklärung der Humanwissenschaften entwickelte.
Was ist die Handlungstheorie nach Parsons?
Die Handlungstheorie untergliedert sich in verschiedene, primäre Subsysteme des Handelns (sozialer, kultureller, organischer und persönlicher Natur) und zwei Umwelten (physisch-organische und transzendente Wirklichkeit).
Was bedeutet das "AGIL-Schema" bei Parsons?
Das "AGIL-Schema" steht für Adaption, Goal Attainment (Zielerreichung), Integration und Latent Pattern (Strukturerhaltung). Es beschreibt die Funktionskategorien der Systeme.
Welche Phasen der Sozialisation werden nach Parsons unterschieden?
Es werden die orale Abhängigkeit von der Mutter, die Liebesabhängigkeit von der Mutter, die ödipale Phase, die Latenzphase und die Adoleszenzphase unterschieden.
Was ist die Rolle nach Parsons?
Das Durchdringen der verschiedenen Systeme während der Interaktion mit anderen, führt zum erlernen von Rollenmustern, und zwar sowohl die von dem Individuum erwarteten, als auch die von seinem Gegenüber.
Was sind die Hauptkritikpunkte an Parsons' Theorie?
Hauptkritikpunkte sind die einseitige Betonung des Sozialisationsprozesses als Vergesellschaftung, die Tendenz zum Gleichgewicht, die Konflikte und abweichendes Verhalten ausklammert, und die Vernachlässigung schichtspezifischer Eigenheiten.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Die Brauchbarkeit von Sozialisationstheorien wird danach zu bemessen sein, ob es gelingt, das Ineinander von Vergesellschaftung und Individuierung so darzustellen, dass die Möglichkeit eigenständigen, reflexiven und verantwortlichen Handelns ebenso verstehbar wird wie die Tatsache gesellschaftlich determinierten Handelns.
- Quote paper
- Holger Schmitt (Author), 2000, Sozialisationstheorien von Sigmund Freud und Talcott Parsons, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96071