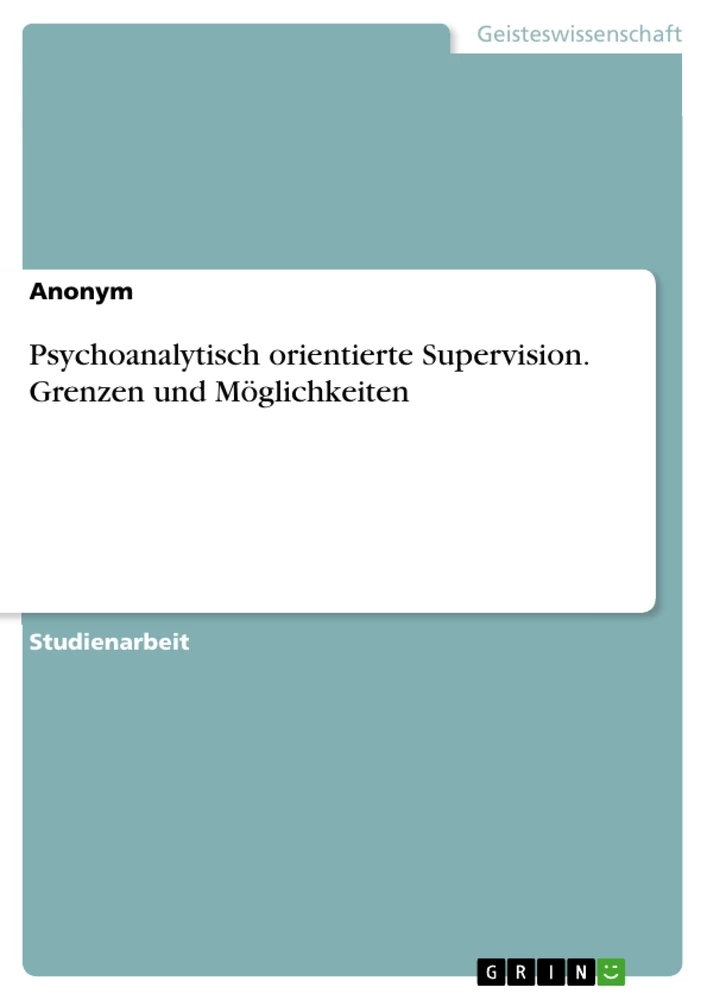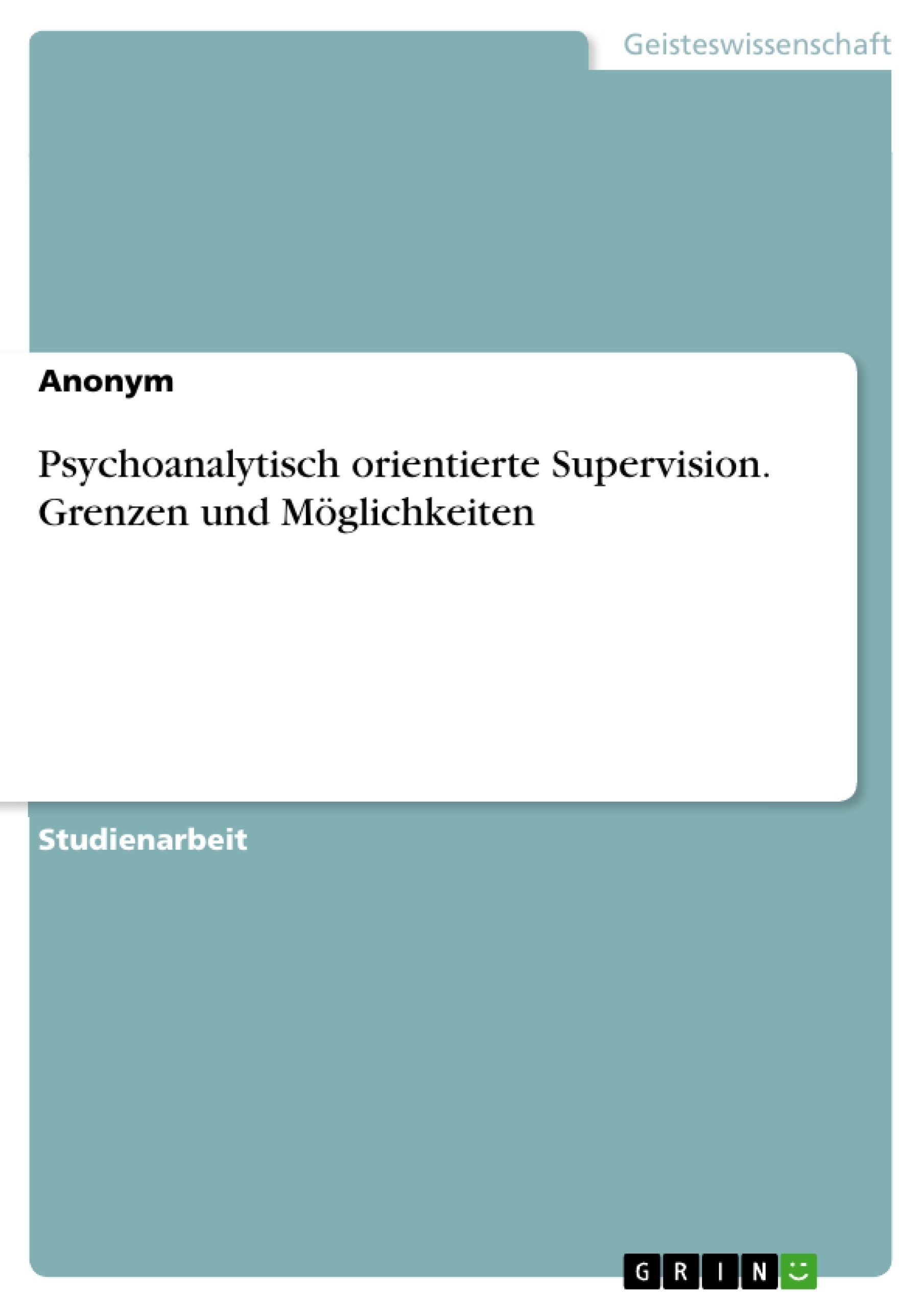Der Autor geht in der Hausarbeit auf die psychoanalytisch orientierte Supervision ein. Zunächst werden die klassischen Grundlagen der Psychoanalyse nach Freud vorgestellt und danach wird dargestellt, wie die psychoanalytischen Ansätze in der Supervision umgesetzt werden. Anschließend werden verschiedene psychoanalytische Methoden und deren Auswirkungen auf die Supervision erläutert und zwei Formen der psychoanalytischen Supervision vorgestellt - die psychoanalytische Teamsupervision und die Arbeit mit Lehrern nach psychoanalytischen Supervisionsansätzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen der Psychoanalyse
- Warum Psychoanalyse in der Supervision?
- Psychoanalytisches Vorgehen in der Supervision
- Umgang mit Widerstand in Supervision
- Errungenschaften aus der Psychoanalyse für die Supervision
- Kontrollanalyse
- Casework
- Die Balint-Methode
- Formen der psychoanalytisch orientierten Supervision
- Psychoanalytische Teamsupervision
- Die Arbeit mit Lehrern in der psychoanalytischen Supervision
- Grenzen und Möglichkeiten der psychoanalytischen Ansätze in der Supervision
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der psychoanalytisch orientierten Supervision. Der Fokus liegt auf der Vorstellung der psychoanalytischen Grundlagen, ihrer Anwendung in der Supervision und der Erörterung von wichtigen Methoden und Formen der psychoanalytischen Supervision. Die Arbeit beleuchtet die Relevanz psychoanalytischer Ansätze im Kontext der Supervision und zeigt, wie diese helfen können, die Arbeit von Fachkräften im sozialen Bereich zu verbessern und die Herausforderungen der professionellen Praxis zu bewältigen.
- Grundlagen der Psychoanalyse nach Freud
- Anwendung psychoanalytischer Ansätze in der Supervision
- Methoden der psychoanalytischen Supervision
- Formen der psychoanalytischen Supervision
- Bedeutung und Nutzen der psychoanalytischen Supervision für den professionellen Umgang mit Klienten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über das Thema der Hausarbeit und die behandelten Aspekte der psychoanalytisch orientierten Supervision.
- Grundlagen der Psychoanalyse: Dieses Kapitel erläutert die klassischen psychoanalytischen Grundlagen nach Freud, insbesondere die Unterscheidung zwischen Bewusstem und Unbewusstem, die Instanzenmodell (Ich, Es, Über-Ich) und das Konzept des Widerstands.
- Warum Psychoanalyse in der Supervision?: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz psychoanalytischer Ansätze in der Supervision und argumentiert, dass diese helfen können, die Herausforderungen und Belastungen im sozialen Arbeitsfeld zu bewältigen und die berufliche Entwicklung von Fachkräften zu fördern.
- Psychoanalytisches Vorgehen in der Supervision: Hier werden wichtige Methoden der psychoanalytischen Supervision vorgestellt, wie z. B. die Arbeit mit der Gegenübertragung des Supervisors und die Nutzung des "Spiegelphänomens" in der Teamsupervision.
- Umgang mit Widerstand in Supervision: Dieses Kapitel behandelt das Thema Widerstand und seine Bedeutung in der Supervision. Es wird darauf hingewiesen, dass die Supervision nicht nur auf den Widerstand fokussieren sollte, sondern auch das soziale Umfeld des Klienten berücksichtigen muss.
- Errungenschaften aus der Psychoanalyse für die Supervision: Dieses Kapitel beleuchtet die Vorteile der psychoanalytischen Supervision, wie die Förderung der Arbeitsbeziehung zwischen Klient und Fachkraft sowie die Bewältigung von psychischen Störungen.
- Kontrollanalyse: Dieses Kapitel erklärt das Verfahren der Kontrollanalyse, welches ein wichtiger Bestandteil der psychoanalytischen Supervision sein kann.
- Casework: Hier werden die Prinzipien und Methoden des Casework vorgestellt, die in der psychoanalytischen Supervision eingesetzt werden können.
- Die Balint-Methode: Dieses Kapitel erklärt die Balint-Methode und ihre Relevanz für die psychoanalytische Supervision.
- Formen der psychoanalytisch orientierten Supervision: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Formen der psychoanalytischen Supervision, darunter die Teamsupervision und die Arbeit mit Lehrern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe dieser Arbeit sind Psychoanalyse, Supervision, Bewusstsein, Unbewusstes, Ich, Es, Über-Ich, Widerstand, Übertragung, Gegenübertragung, Balint-Methode, Teamsupervision, Entwicklungspsychologie, psychische Störungen, soziales Handeln, professionelle Entwicklung, Arbeitsbeziehung, Klient, Fachkraft, soziales Arbeitsfeld.
Häufig gestellte Fragen
Was ist psychoanalytisch orientierte Supervision?
Eine Form der beruflichen Beratung, die Konzepte der Psychoanalyse (wie das Unbewusste oder Übertragung) nutzt, um berufliches Handeln zu reflektieren.
Welche Rolle spielt das "Unbewusste" in der Supervision?
Es hilft dabei, verborgene Motive, Widerstände und emotionale Verstrickungen in der Beziehung zwischen Fachkraft und Klient zu verstehen.
Was ist die Balint-Methode?
Eine spezifische Form der Fallbesprechung in Gruppen, die sich auf die emotionale Beziehung zwischen Behandler und Patient konzentriert.
Wie wird mit "Widerstand" in der Supervision umgegangen?
Widerstand wird als wertvoller Hinweis auf tieferliegende Konflikte gesehen und nicht als Hindernis, sondern als Material für die Reflexion genutzt.
Was bedeutet "Gegenübertragung" für den Supervisor?
Der Supervisor nutzt seine eigenen emotionalen Reaktionen auf den Supervisanden, um Dynamiken innerhalb des Arbeitsteams oder zum Klienten zu verstehen.
Warum ist diese Methode für Lehrer relevant?
Sie hilft Lehrkräften, schwierige Schüler-Lehrer-Beziehungen zu analysieren und die eigene psychische Belastung im Schulalltag zu reduzieren.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Psychoanalytisch orientierte Supervision. Grenzen und Möglichkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/960864