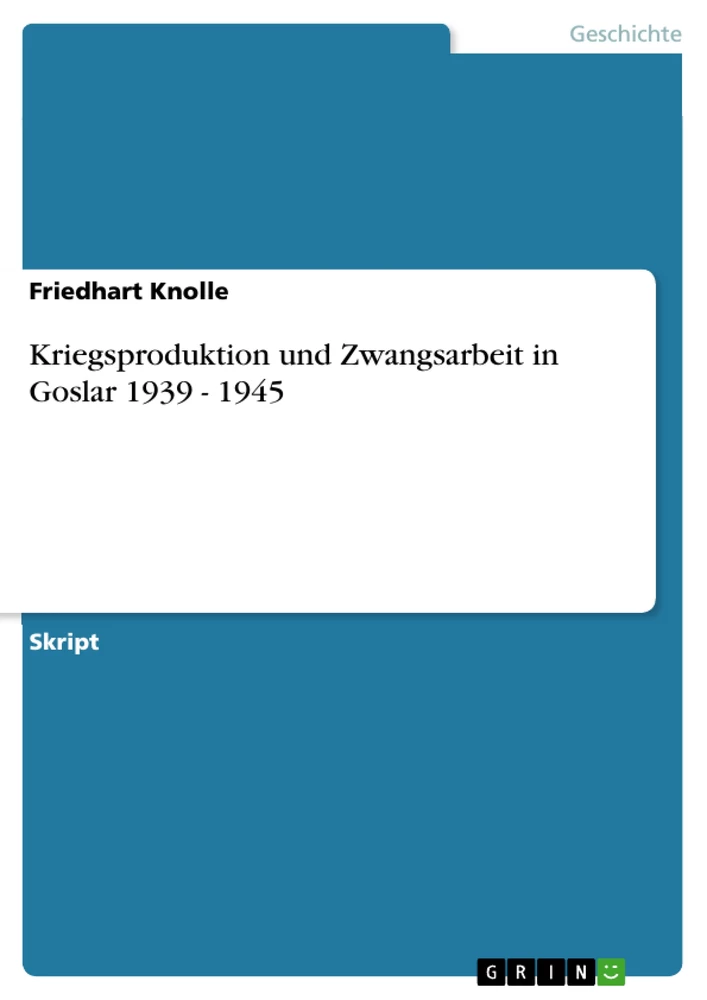Am 2. Juni 1945 übersandte das Erzbergwerk Rammelsberg der provisorischen Nachkriegs-Stadtverwaltung Goslar eine Liste der im „Ostarbeiterlager“ im Bergtal unterhalb des Herzberger Teiches untergebrachten ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Ukraine.
„Displaced Persons“, kurz DPs, wurden diese Menschen nun genannt, die das Naziregime von 1939 bis 1945 aus ganz Europa zusammengetrieben hatte, um für die deutsche Kriegswirtschaft zu arbeiteten. Viele der DPs wußten nicht wohin. Sie waren seit Jahren fern ihrer Heimat, insbesondere diejenigen, die aus dem Osten Europas ins Reich zwangsverschleppt worden waren. Viele hatten Angst zurückzukehren, denn in der Sowjetunion wurden sie, so zynisch es auch war, als Verräter angesehen und oft genug in Stalins GULAG gesteckt. So wurden sie von den Alliierten zusammengefasst und kamen in ehemaligen Zwangsarbeiterlagern unter. Nach der genannten Liste war die älteste Arbeiterin 69 Jahre alt, das jüngste Kind gerade ein Jahr.
Nach einer amtlichen Statistik des Gauarbeitsamtes Südhannover-Braunschweig vom Juni 1944 waren im Gau bei einer Anzahl von insgesamt 868.000 Beschäftigten knapp 300.000 Ausländer tätig, davon 227.000 „Zivilarbeiter“ und 70.500 Kriegsgefangene. Sie arbeiteten in großen und kleinen Fabriken, in der Landwirtschaft, bei Handwerkern, bei der Reichsbahn und in städtischen Betrieben. In Goslar waren es nach Mitteilung an die Gestapo Braunschweig im Juni 1944 2.300 Ausländerinnen und Ausländer. Insgesamt arbeiteten während des Krieges etwa 5.000 Menschen aus dem europäischen Ausland in der Stadt und ihrer Umgebung. 61 Betriebe bedienten sich in diesem Zeitraum ihrer Arbeitskraft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das,,Rammelsbergprojekt\" und seine historische Aufarbeitung
- ,,Gebt uns unsere Würde wieder“ – was will die Ausstellung?
- Die Preussag und der Rammelsberg - ein Stück Industriegeschichte der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Begleitbroschüre zur Ausstellung „Zwangsarbeit in Goslar 1939-1945“ befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Kriegsvorbereitung, verbrecherischem Raubkrieg und Zwangsarbeit des NS-Regimes in Goslar. Sie will die Geschichte der Zwangsarbeit in Goslar beleuchten und einen Beitrag zum besseren historischen Verständnis der Stadt liefern.
- Die Geschichte der Zwangsarbeit im Kontext der Kriegswirtschaft des NS-Regimes
- Die Rolle des Erzbergwerks Rammelsberg in der Kriegsmaschinerie des Dritten Reichs
- Die Lebensbedingungen der Zwangsarbeiter in Goslar
- Die Folgen der Zwangsarbeit für die Betroffenen
- Die Bedeutung der Erinnerung an die Opfer der Zwangsarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung schildert die Situation der Zwangsarbeiter in Goslar nach dem Zweiten Weltkrieg und die Bedeutung des Rammelsbergs für die Kriegswirtschaft des NS-Regimes.
Das,,Rammelsbergprojekt\" und seine historische Aufarbeitung
Dieses Kapitel befasst sich mit der Ausweitung des Bergbaus am Rammelsberg im Rahmen des "Rammelsbergprojekts" in den 1930er Jahren. Es werden die Beweggründe für den Ausbau des Bergwerks und die Rolle der Kriegswirtschaft bei der Finanzierung des Projekts erläutert.
,,Gebt uns unsere Würde wieder“ – was will die Ausstellung?
Dieses Kapitel beleuchtet die Ziele und die Motivation des Vereins Spurensuche Goslar e.V., die Erinnerungsstätte für die ehemaligen Zwangsarbeiter am Rammelsberg zu errichten.
Die Preussag und der Rammelsberg - ein Stück Industriegeschichte der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts
Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Preussag und ihre Rolle beim Betrieb des Erzbergwerks Rammelsberg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Schlüsselwörter
Zwangsarbeit, Rammelsberg, NS-Regime, Kriegswirtschaft, Erinnerungskultur, Goslar, Preussag, Unterharzer Berg- und Hüttenwerke, Weltkulturerbe
- Quote paper
- Friedhart Knolle (Author), 1999, Kriegsproduktion und Zwangsarbeit in Goslar 1939 - 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96110