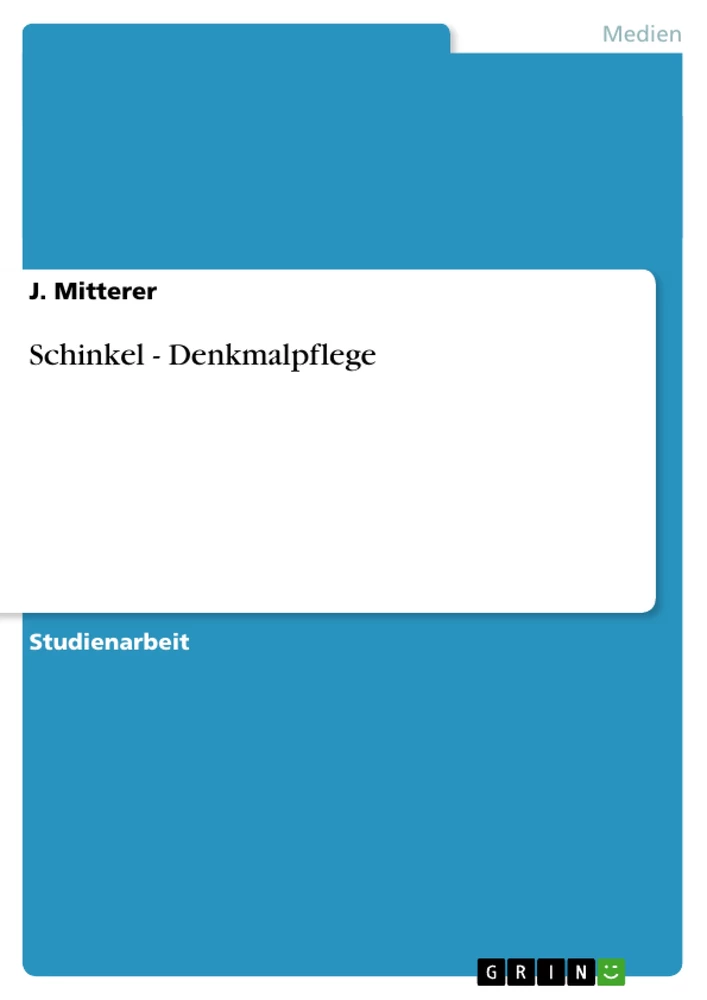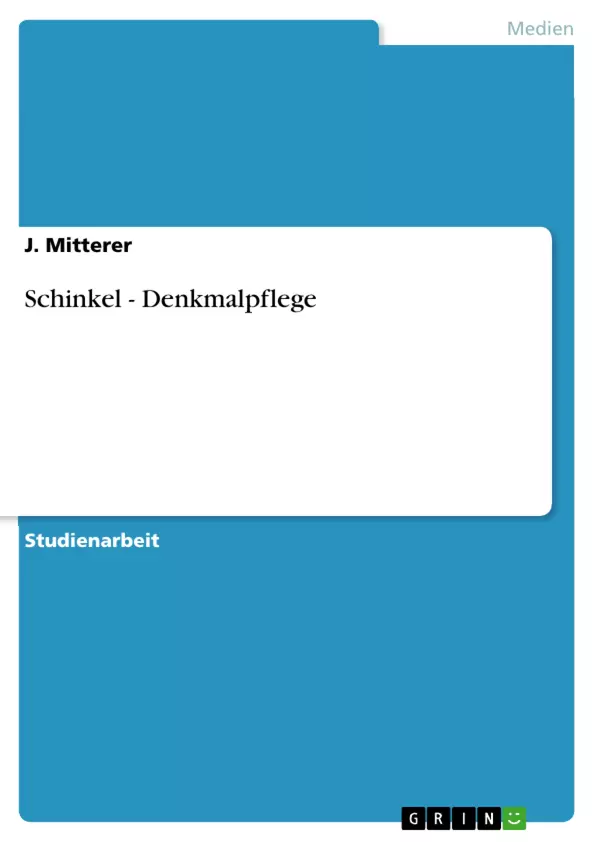Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Zeit, in der das kulturelle Erbe achtlos zerstört wird, historische Bauten dem Verfall preisgegeben sind und das Bewusstsein für den Wert vergangener Epochen schwindet. In dieser Epoche des Umbruchs, geprägt von Kriegen und Enteignungen, wagte es ein Visionär, sich dem entgegenzustellen: Karl Friedrich Schinkel. Weit mehr als nur ein Architekt, entwarf Schinkel ein revolutionäres Konzept für die Denkmalpflege, das seiner Zeit weit voraus war. Diese tiefgründige Analyse beleuchtet Schinkels innovative Ideen zur Verwaltung, Definition und Restaurierung von Denkmälern. Es zeigt, wie er unermüdlich für die Erhaltung historischer Bauten kämpfte und dabei auf taube Ohren bei den Behörden stieß. Entdecken Sie, wie Schinkel eine Struktur für eine Denkmalbehörde vorschlug, die bis heute relevant ist, und wie er den Grundstein für eine systematische Inventarisierung historischer Objekte legte. Erfahren Sie mehr über seine differenzierte Denkmaldefinition, die nicht nur monumentale Bauwerke, sondern auch vermeintlich unbedeutende Details umfasste. Tauchen Sie ein in Schinkels Restaurierungsprinzipien, die darauf abzielten, den ursprünglichen Charakter der Bauten zu bewahren und gleichzeitig die Spuren der Zeit zu respektieren. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch Schinkels Schriften und Gutachten, die ein leidenschaftliches Plädoyer für den Schutz unseres kulturellen Erbes darstellen. Dieses Buch ist ein Muss für alle, die sich für Architekturgeschichte, Denkmalpflege und die Visionen eines Mannes interessieren, der die Bedeutung des Bewahrens für zukünftige Generationen erkannte. Es enthüllt, wie Schinkels Ideen, obwohl zu seinen Lebzeiten oft unbeachtet, bis heute in der Denkmalpflege fortwirken und uns daran erinnern, dass die Achtung vor der Vergangenheit der Schlüssel zur Gestaltung einer lebenswerten Zukunft ist. Lassen Sie sich inspirieren von Schinkels unermüdlichem Einsatz für den Erhalt unserer Geschichte und entdecken Sie die zeitlose Relevanz seiner Konzepte für die Denkmalpflege im 21. Jahrhundert. Dieses Buch bietet nicht nur einen Einblick in die historische Entwicklung der Denkmalpflege, sondern auch wertvolle Impulse für die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Schutz unseres kulturellen Erbes. Es ist eine Hommage an einen Pionier, dessen Weitsicht und Engagement die Denkmalpflege nachhaltig geprägt haben.
Inhalt
Vorwort
1. Historische Situation
1.1. Zerstörung des Denkmalbestandes
1.2. Handlungsbedarf
1.3. Untätigkeit der Behörden
2. Schinkels Konzept für eine Denkmalpflege
2.1. Verwaltung
2.2. Denkmaldefinition
2.3. Restaurierung
3. Wirkung und Erfolge
3.1. Ämter
3.2. Königlicher Erlaß
Ausblick
Literatur
Vorwort
Karl Friedrich Schinkel kann als einer der bedeutendsten Architekten seiner Zeit angesehen werden. Weniger bekannt ist, daß Schinkels Gedanken zur Denkmalpflege vorbildlich und richtungsweisend bis weit über seine Zeit hinaus waren. Aus vielen seiner Schriften geht hervor, daß er laufend mit den Behörden verhandelte, um eine Erhaltung und Pflege historischer Bauten zu bewirken.
1. Historische Situation
1.1. Zerstörung des Denkmalbestands
Die Idee von Denkmalschutz gab es damals noch nicht, und so mußte Schinkel erleben, wie wertvolle historische Gebäude der Zerstörung, dem Verfall oder der Demontage preisgegeben wurden. Allein in Köln wurden zum Beispiel während der Kriegswirren 47 Kirchen vom französischen Heer zerstört. Durch den Reichsdeputationshauptschluß wurden 1803 alle geistlichen Fürstentümer, Zisterzienserorden und geistliche Ritterorden aufgelöst. Mit der Aufhebung und der anschließenden Enteignung mußten die Orden ihre Gebäude meist sofort verlassen. Die nun leerstehenden Bauten verfielen meist ungenutzt oder wurden zum Teil sogar als Baumaterial abgetragen. Die Zerstörung vollzog sich ohne ein Bewußtsein für den Wert der Gebäude als kulturhistorisches Erbe für die nachfolgenden Generationen. Für Schinkel waren Denkmäler Zeugen der Vergangenheit, die die Entwicklung zu unserem heute belegen.
1.2. Handlungsbedarf
In Anbetracht der entstandenen Verluste erkannte Schinkel die Schutzbedürftigkeit auch solcher Bauwerke, die dem aktuellen Geschmack und den Ansprüchen der Zeit nicht genügten. In seinem Gutachten, in dem er für die Erhaltung der als unmodern angesehenen Barockfiguren auf dem Berliner Stadtschloß plädierte, schrieb er "...unm ö glich kann es in einer Hauptstadt Prinzip werden, ausgezeichnete ö ffentliche Geb ä ude auf diese Weise zu zerst ö ren, wir w ü rden auf diesem Wege bald dahin kommen, auch das Zeughaus und alle ü berigen Geb ä ude des Schmuckes beraubt zu sehen, der an eine sch ö ne Vorzeit erinnert und das Wahre Interesse bei der Architektur einer Stadt gew ä hrt."1 Da für Schinkel Kunstdenkmäler ein öffentliches Gut darstellten, sollte ihre Erhaltung deshalb auch von öffentlichem Interesse sein, für einen preußischen Beamten wie Schinkel war diese Öffentlichkeit gleichzusetzen mit dem Staat. Somit stellte sich für den Staat eine neuartige Aufgabe, die nicht mit Einzelaktionen zu leisten war, sondern an der kontinuierlich gearbeitet werden mußte.
Denn Denkmalpflege ist "ein Gegenstand des allgemeinen Interesses und ein Gegenstand der Ehre des Staates, weil sich darin die beste Bildung unserer Zeit aussprechen kann und eben dadurch werden diese Gegenst ä nde auch eine F ö rderung der allgemeinen Verbreitung dieser h ö heren Bildungsstufe im ganzen Land."2
1.3. Untätigkeit der Behörden
Die Entscheidungen über Veräderung oder Erhalt von Bauwerken wurden teilweise bisher schon behördlich getroffen, doch häufig wurden die Anordnungen bereits innerhalb der Behörde oder später dann von Privatleuten ignoriert, da kein öffentliches Bewußtsein den Schutz der Denkmäler forderte. "So geschah es, da ß unser Vaterland von seinem sch ö nsten Schmuck so unendlich viel verlor, was wir bedauern m üß en, und wenn jetzt nicht ganz allgemeine und durchgreifende Ma ß regeln angewendet werden, so werden wir in kurzer Zeit unheimlich nackt und kahl wie eine neue Colonie in einem fr ü her nicht bewohnten Lande dastehen"3
2. Schinkels Konzept für eine Denkmalpflege
2.1. Verwaltung
Schinkel wünschte sich für eine Denkmalbehörde eine Struktur, die bis heute aktuell geblieben ist. Sie sollte sich zusammensetzen aus einem Ministerium als Entscheidungsträger und den zugeordneten Fachausschüssen als Gutachter. In diesen Ausschüssen sollten hauptamtliche Konservatoren in dem nun neu entstandenen Beruf des Denkmalpflegers arbeiten.
Auch die Inventarisierung der historischen Objekte sollte von diesen staatlichen Stellen durchgeführt werden. Darüber hinaus wünschte er sich ein starkes Engagement von Museen, Kirchen und Privatsammlungen. Denn nur eine breit angelegte Inventarisierung bietet überhaupt erst die Voraussetzung für eine Pflege der Denkmäler.
2.2. Denkmaldefinition
Unter Denkmälern verstand er Bauten und Ruinen aller Gattungen, einschließlich ihrer Außen- und Innendekoration. Schinkel definiert sie als "Bauwerke, sowohl in vollkommenden erhaltenen Zustande, als in Ruinen liegend, von allen Gattungen, als Kirchen, Capellen, Kreuzg ä nge und Klostergeb ä ude, Schl ö sser, einzelne Wahrten, Tore, Stadtmauern, Denks ä ulen, ö ffentliche Brunnen, Grabmale, Rath ä user, Hallen usw. (...) N achdem man durch diese Verzeichnisse eine Ü bersicht erlangt lie ß e sich nun ein Plan machen, wie diese Monumente gehalten werden k ö nnten, um dem Volke anzusprechen"4 Schinkels Denkmalbegriff zeigte sich erstaunlich differenziert, so setzte er sich auch ein für den Erhalt kleinerer Ausbauten, nur weil sie einzigartig oder selten zu finden waren.
In einer Korrespondenz von 1815 mit dem Ministerium wehrte er sich vehement gegen den Abriß eines Lettners in der Kirche von Kalkar, da bereits in vielen Kirchen solche Zeugnisse der Vergangenheit vernichtet wären. Doch auch städtebauliche Situationen konnten schützenswerte historische Zeitzeugen sein. Er kam dem modernen Ensemble-Begriff schon sehr nahe, als er sagte: "S elbst das Fehlerhafte, wenn es aus dem besonderen Geschmack einer Zeit hervorgegangen ist, wird in der historischen Reihe ein interessantes Glied sein und, an seinem Platze manchen Wink und Aufschlu ß geben." 5
2.3. Restaurierung
Um den ursprünglichen reinen Charakter der Bauten und Denkmäler zu erhalten, sollte eine Restaurierung nur an den notwendigen Stellen vorgenommen werden. Herabgefallene Teile sollten gesichert werden und anschließend mit geeigneten Mitteln wieder an Ort und Stelle gebracht werden. Restaurierung sollten dem Bau keinesfalls ein neues Aussehen geben, die Spuren der vergangenen Jahrhunderte sollten erhalten bleiben. Bei Ergänzungen sollte das Neue dem Originalmaterial möglichst genau angeglichen werden. So forderte er für neuzuputzende Teile eine vorherige Untersuchung der Färbung des ursprünglichen Gemäuers und der Zusammensetzung des Verwendeten Mörtels. Die beste Restaurierung wäre demnach eine, die im Wesentlichen gar nicht zu bemerken ist. Es kam aber auch wegen der wiederherzustellenden Reinheit und Werkgetreue dazu, daß barocke Ausstattungen durch neugotische ersetzt wurden.
3. Wirkung und Erfolge
3.1. Ämter
Leider konnte sich Schinkel mit seinen Forderungen nicht durchsetzen, zu oft blieben seine Eingaben im Dickicht der zuständigen Behörden stecken. Das höchste an Reaktionen waren einige königliche Kabinettsordern, die sich auf die Erhaltung einzelner Objekte bezogen.
Doch selbst deren Ausführung verzögerte und verhinderte oft der unvermeidliche Weg durch Preußens Baubehörden.
Erst 1835 ging die Denkmalpflege, soweit sie überhaupt existierte, an das preußische Kultusministerium über. Damit wurden zwar die Kompetenzen über den Schutz der Objekte erweitert, einen festen Etat gab es für die neuen Aufgaben jedoch noch nicht. Die Geldmittel mußten für einzelne Projekte beantragt werden und wurden dabei auf ihre Notwendigkeit hin beurteilt. Förderungswürdig waren Überreste der Baukunst aus der Vorzeit und solche, die einen Wert für die Geschichte von Wissenschaft und Technik hatten.
3.2 . Königlicher Erlaß
Im Jahr 1843 griff sogar König Friedrich Wilhelm IV. die Überlegungen Schinkels zur Restaurierung auf. Durch einen ministeriellen Runderlaß ließ er verlauten, daß es bei der Restauration darauf ankäme, nur die entstandenen Schäden zu beseitigen, aber den Charakter des Gebäudes so zu erhalten, daß das Wesentliche der Entstehungszeit weiterhin zum Ausdruck käme. Weiterhin wurde angeordnet, alle Baubeamten davon in Kenntnis zu setzen, damit die neue Verfügung eingehalten und überwacht werde.
Verfasser dieses Erlasses im königlichen Namen war vermutlich der Freund und spätere Biograph von Schinkel Franz Theodor Kugler, der wenige Monate zuvor als Zuständiger für Kunstangelegenheiten in das Kultusministerium gerufen wurde. Kugler fehlte jedoch ein ausreichender Stab an hauptamtlichen Mitarbeitern, um damit erwähnungswürdige Erfolge in der Denkmalpflege zu erzielen, wie sie in Frankreich bereits üblich waren. Sein Nachfolger Ferdinand von Quast schuf sich durch die Organisation von Kunstvereinen einen weiteren Kreis von Mitarbeitern.
Ausblick
Schinkels Bestreben, Denkmalpflege als feste Größe in der staatlichen Verwaltung zu installieren, ist heute als Selbstverständlichkeit in unserer Verwaltung gegeben. Die Ämter für Denkmalpflege haben heute die Aufgabe pflegebedürftige Objekte aufzuspüren, sie zu inventarisieren und sie vor dem unwiederbringlichen Verlust zu retten.
Literatur
Deiters, Ludwig: K. F. Schinkel und die Denkmalpflege. In: Karl Friedrich Schinkel. Tradition und Denkmalpflege. Hrsg: Institut für Denkmalpflege. Berlin, 1982.
Huse, Norbert (Hrsg.): Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten. München, 1984.
Neumann, Frank Günther: Von der vormoralischen Geschichte der Kunst zur Denkmalpflege. In: Internationales Karl-Friedrich-Schinkel-Symposium 1995 Zittau. Hrsg: Organisationskomitee Schinkel-Symposium Zittau 1995. Zittau, 1996.
Rave, Paul Ortwin: Karl Friedrich Schinkel. Lebenswerk. Erster Teil. Bauten für die Kunst, Kirchen und Denkmalpflege. Berlin, 1941. Erw. Nachdr. Berlin, 1981.
Semino, Gian Paolo: Karl Friedrich Schinkel. Zürich, 1993.
[...]
1 K. F. Schinkel, 02. 09. 1817. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Berlin: Rep. 93 D Lit. G. c XI Nr. 17. Zitiert nach: Rave, S. 377
2 K. F. Schinkel zitiert nach: Huse S.63, ohne nähere Angabe zitiert nach: Grundmannn, Günther, Die Bedeutung Schinkels für die Denkmalpflege, in: Deutsche Kunst und Denkmalpflege 14 (1940/41), S. 128.
3 K. F. Schinkel: "Erhaltung aller Denkmäler und Alterthümer unseres Landes". 17.08.1815. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin. I. HA Rep. 93 D Lit. E Nr. 68 Bd. 1 Bl. 11-16. Zitert nach: Neumann, S. 98.
4 A.a.O.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über Schinkels Konzept für Denkmalpflege?
Der Text befasst sich mit Karl Friedrich Schinkels Ideen und Beiträgen zur Denkmalpflege. Er beleuchtet die historische Situation, die Schinkel vorfand, sein Konzept für eine systematische Denkmalpflege, seine Wirkung und die Erfolge, die er trotz Widerstände erzielen konnte. Es geht darum, wie er angesichts der Zerstörung historischer Bauten ein Bewusstsein für den Wert von Denkmälern als kulturelles Erbe schuf und versuchte, eine staatliche Denkmalpflege zu etablieren.
Welche historische Situation wird im Text beschrieben?
Der Text beschreibt die Zeit um 1800, in der es noch kein ausgeprägtes Bewusstsein für Denkmalschutz gab. Viele wertvolle historische Gebäude wurden zerstört, verfielen oder wurden demontiert, insbesondere durch Kriegswirren und die Auflösung geistlicher Institutionen. Schinkel erkannte den Handlungsbedarf, um diese Verluste zu stoppen.
Was war Schinkels Konzept für eine Denkmalpflege?
Schinkel schlug eine staatliche Denkmalpflege mit einer klaren Verwaltungsstruktur vor. Diese sollte aus einem Ministerium als Entscheidungsträger und Fachausschüssen mit hauptamtlichen Konservatoren bestehen. Er forderte eine umfassende Inventarisierung historischer Objekte und definierte den Denkmalbegriff sehr differenziert. Seine Restaurierungsprinzipien zielten darauf ab, den ursprünglichen Charakter der Bauten zu erhalten und nur notwendige Ergänzungen vorzunehmen.
Was verstand Schinkel unter Denkmälern?
Schinkel verstand unter Denkmälern Bauwerke und Ruinen aller Gattungen, einschließlich ihrer Außen- und Innendekoration. Dazu zählten Kirchen, Kapellen, Klöster, Schlösser, Tore, Stadtmauern, Denksäulen, Brunnen, Grabmale, Rathäuser usw. Er berücksichtigte auch kleinere Ausbauten und städtebauliche Situationen, die Zeugnisse der Vergangenheit waren.
Wie gestaltete sich Schinkels Erfolg in der Denkmalpflege?
Obwohl Schinkel wichtige Impulse gab und seine Überlegungen später von König Friedrich Wilhelm IV. aufgegriffen wurden, konnte er sich mit seinen Forderungen nach einer festen staatlichen Denkmalpflege zu Lebzeiten nicht vollständig durchsetzen. Seine Eingaben blieben oft in den Behörden stecken, und erst später wurde die Denkmalpflege dem Kultusministerium unterstellt.
Welche Literatur wird im Text erwähnt?
Der Text verweist auf verschiedene Werke von und über Karl Friedrich Schinkel sowie zur Denkmalpflege im Allgemeinen, darunter: Werke von Deiters, Huse, Neumann, Rave und Semino.
Welche Bedeutung hat Schinkels Arbeit für die heutige Denkmalpflege?
Schinkels Ideen und sein Engagement für die Denkmalpflege gelten als wegweisend. Seine Konzepte zur Organisation, Inventarisierung und Restaurierung haben die moderne Denkmalpflege maßgeblich beeinflusst und sind heute in der staatlichen Verwaltung verankert.
- Quote paper
- J. Mitterer (Author), 1996, Schinkel - Denkmalpflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96132