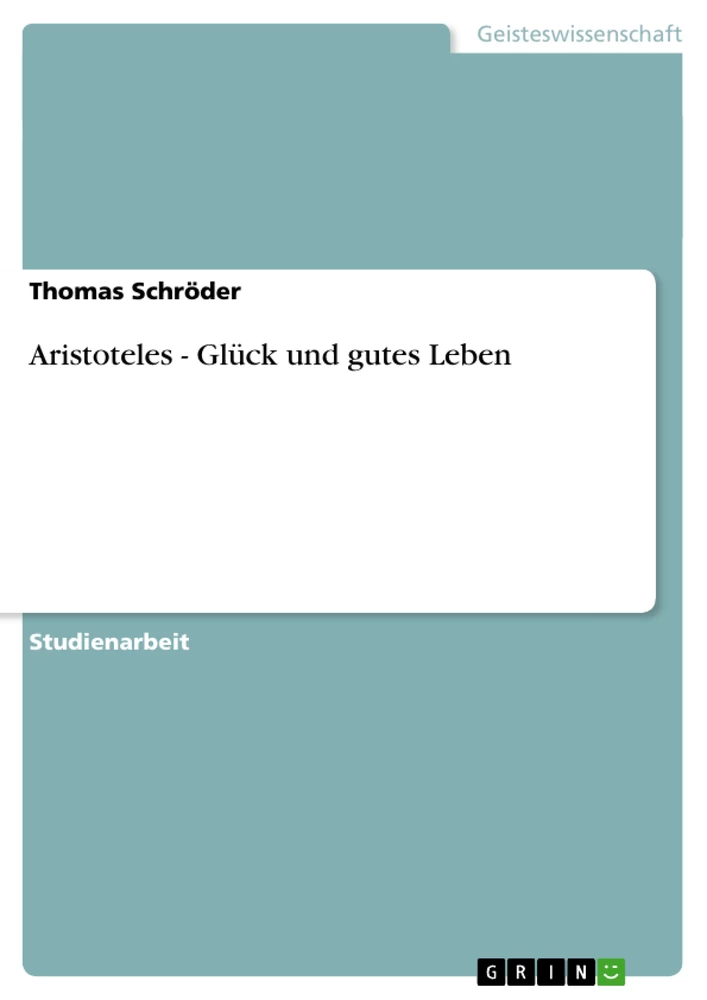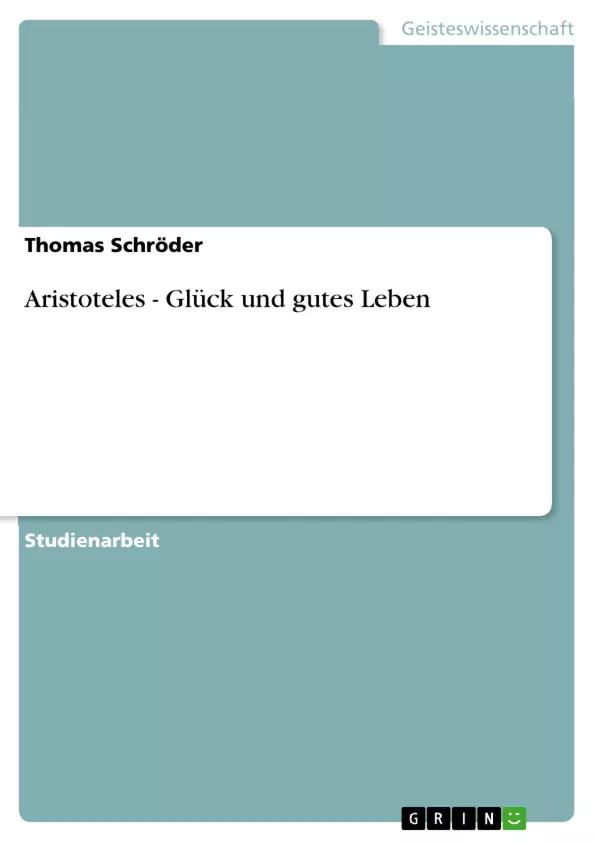Der Begriff vom guten und glücklichen Leben ist keine neuzeitliche oder gar moderne Erfindung. Er ist bereits im antiken Griechenland diskutiert und vielseitig geprägt worden. Wenn auch die antiken Positionen in dieser Frage sich deutlich durch den kaum vorhandenen Gedanken des Pluralismus beziehungsweise Relativismus von den heutigen Standpunkten abgrenzen, so ist doch unbestritten, dass sich viele der Ideen und Teilkonzepte von damals noch in den aktuellen Vorschlägen zum guten Leben wiederfinden.
Die von der an dieser Stelle hypothetisch angenommenen postmodernen Grundlosigkeit gekennzeichnete Fülle an Glückskonzepten findet in den Überlegungen des Aristoteles eine klare Vorgabe, die das glückliche Leben vor allem rational im Gegensatz zu den intuitionalen Varianten der ‚Jede/r-muss-sein-Glück-selbst-finden-Attitüde’ bestimmbar macht.
Die nachfolgende knappe Ausarbeitung macht sich zum Ziel, das aristotelische Konzept des guten und glücklichen Lebens, so wie es heute im Buch X in der Nikomachischen Ethik, Kapitel 6 bis 9, zu finden ist, schlaglichtartig zu erhellen und in seinen Grundgedanken zu erläutern. Es zeigt sich, dass Überlegungen zum menschlichen Glücklichsein schon in der frühen griechischen Philosophie etabliert waren. Für Aristoteles bedeutet Glückseligkeit nichts Geringeres als „Ziel und Ende alles menschlichen Tuns“, was eine gründliche Beschäftigung mit dem Begriffen und Formen des Konzepts vom guten Leben nahe legt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Glückseligkeit
- Kapitel VI. Selbstgenügsame Tätigkeit und Selbstzweck
- Kapitel VII. Das vollendete Glück der Denktätigkeit
- Kapitel VIII. Das Glück des praktischen Lebens
- Kapitel IX. Äußere Verhältnisse
- Resümee
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text beleuchtet das aristotelische Konzept des guten und glücklichen Lebens, wie es im 10. Buch der Nikomachischen Ethik, Kapitel 6 bis 9, dargestellt wird. Ziel ist es, das Konzept zu erläutern und seine Grundgedanken aufzuzeigen. Der Text verdeutlicht, dass Überlegungen zum menschlichen Glücklichsein bereits in der frühen griechischen Philosophie etabliert waren.
- Definition und Eigenschaften von Glückseligkeit
- Die Rolle von Tätigkeit und Tugend
- Die Bedeutung des Verstandes und der Vernunft
- Die Unterscheidung von Glückseligkeit und sinnlicher Freude
- Die Beziehung von Glückseligkeit zu Macht und äußeren Verhältnissen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel VI. Selbstgenügsame Tätigkeit und Selbstzweck
Aristoteles stellt verschiedene Formen von Glückseligkeit vor, wobei er die Präferenz für ein Leben in tugendhaften Tätigkeiten und der Freude an der Tätigkeit selbst betont. Er argumentiert, dass Glückseligkeit nicht ein Habitus ist, sondern eine innere Tätigkeit. Er grenzt Glückseligkeit von Ehre und sinnlichen Freuden ab, die als oberflächlich und zerstörerisch betrachtet werden. Er kritisiert die Ansicht, dass Glückseligkeit mit Macht und Besitz verbunden sei.
Kapitel VII. Das vollendete Glück der Denktätigkeit
Aristoteles argumentiert, dass die höchste Form von Glückseligkeit mit der Tätigkeit des Verstandes verbunden ist. Diese Tätigkeit, die als Weisheit verstanden wird, ist die genussreichste und seligste aller tugendmäßigen Tätigkeiten. Weisheit wird als die göttliche Tätigkeit betrachtet, da sie am ähnlichsten dem reinen, vernunftgemäßen Handeln ist.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Glückseligkeit (Eudaimonia) nach Aristoteles?
Glückseligkeit ist für Aristoteles das höchste Ziel des menschlichen Lebens und besteht in einer tätigen Lebensführung gemäß der Vernunft und Tugend.
Warum ist Denktätigkeit die höchste Form des Glücks?
Weil die Vernunft der göttlichste Teil im Menschen ist. Die reine Betrachtung (Theoria) ist autark und wird um ihrer selbst willen geliebt.
Welche Rolle spielen äußere Güter für das Glück?
Aristoteles erkennt an, dass ein gewisses Maß an äußeren Gütern (Wohlstand, Freunde, Gesundheit) notwendig ist, um tugendhaft handeln zu können, auch wenn sie nicht das Wesen des Glücks ausmachen.
Was unterscheidet Glück von sinnlicher Freude?
Sinnliche Freuden sind oft oberflächlich und flüchtig. Wahres Glück hingegen ist eine dauerhafte, selbstgenügsame Tätigkeit der Seele.
Was ist das Ziel der Nikomachischen Ethik?
Das Werk soll aufzeigen, wie der Mensch durch die Ausbildung von Tugenden ein gutes und gelungenes Leben innerhalb der Gemeinschaft führen kann.
- Quote paper
- Thomas Schröder (Author), 2002, Aristoteles - Glück und gutes Leben, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9614