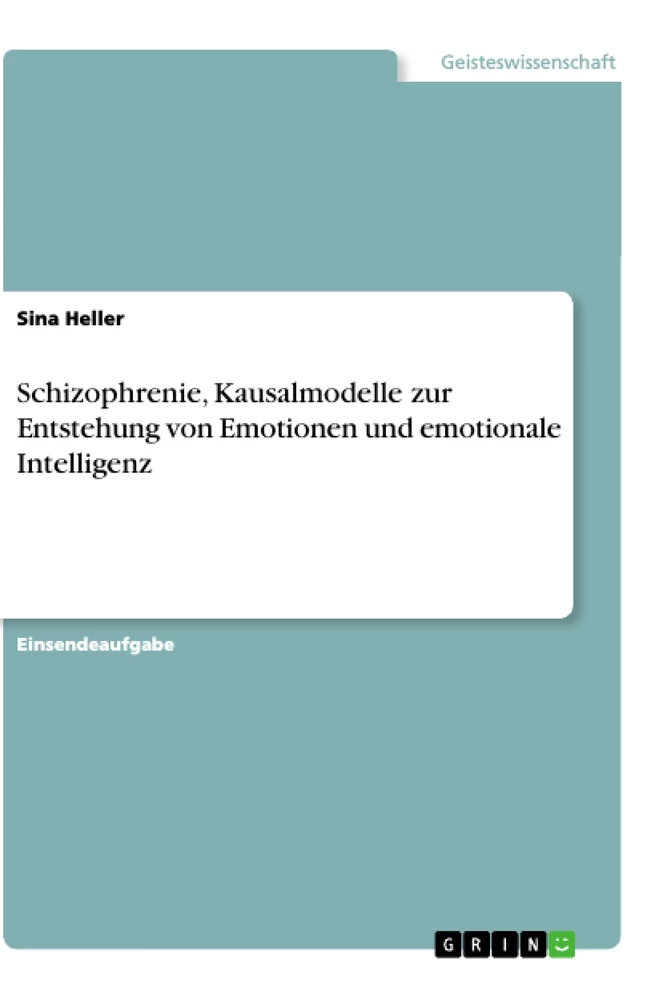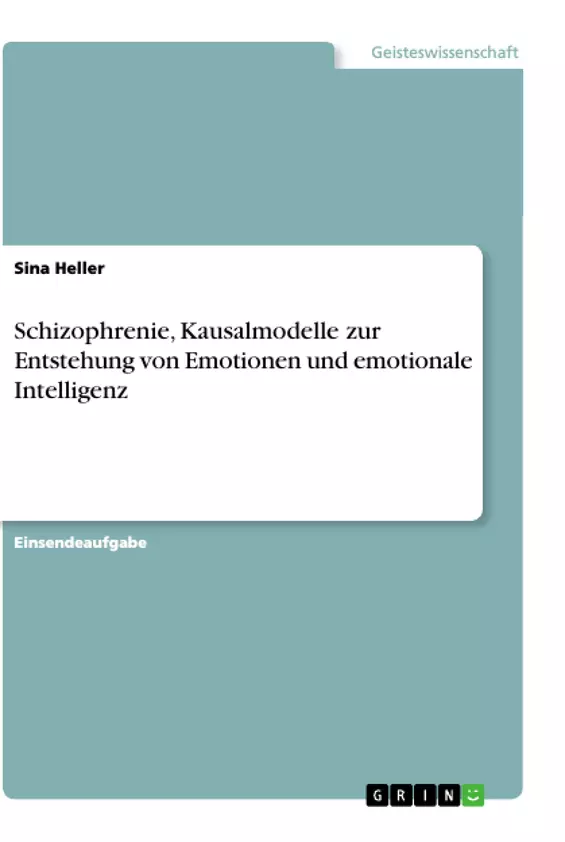Die folgende Arbeit setzt sich im Rahmen von drei Abschnitten mit den drei Unterthemen Schizophrenie, Kausalmodellen zur Entstehung von Emotionen und der emotionalen Intelligenz auseinander.
Zunächst wird dafür das Krankheitsbild der Schizophrenie erläutert und auf die Voraussetzungen einer Beschäftigung für Patienten mit diagnostizierter Schizophrenie auf dem ersten Arbeitsmarkt und eine Beschäftigung in Behindertenwerkstätten als mögliche geeignete Beschäftigungsform eingegangen.
Im nächsten Abschnitte werden verschieden Modelle zu Entstehung der Emotionen vorgestellt, insbesondere das transaktionale Stressmodell von Lazarus. Außerdem werden Formen des Copings angesprochen. Im dritten Abschnitt wird dann auf das Thema der emotionalen Intelligenz, speziell auf Ihre Bedeutung für den Teambildungsprozess eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Das Krankheitsbild der Schizophrenie, der schizotypen und wahnhaften Störung
- Schizophrenie
- Schizotype Störungen
- Wahnhafte Störung
- Berufliche Perspektiven schizophrener Menschen
- Aufgabe 2
- Kausalmodelle zur Rolle der Bewertung bei der Entstehung von Emotionen
- Transaktionales Stressmodell von Lazarus
- Coping
- Aufgabe 3
- Definition Emotionaler Intelligenz
- El in Teams
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept der El
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem Krankheitsbild der Schizophrenie und verwandten Störungen. Es werden die verschiedenen Symptome und Verlaufsformen der Schizophrenie sowie die Ursachen und die Rolle von Stresssituationen bei der Entstehung der Krankheit beleuchtet. Des Weiteren wird die Bedeutung der emotionalen Intelligenz im Kontext von Teams untersucht und kritisch betrachtet.
- Das Krankheitsbild der Schizophrenie und die Entstehung der Störung
- Die Rolle von Stresssituationen und genetischen Faktoren bei der Entstehung der Schizophrenie
- Berufliche Perspektiven schizophrener Menschen
- Kausalmodelle zur Entstehung von Emotionen
- Emotionale Intelligenz und ihre Bedeutung in Teams
Zusammenfassung der Kapitel
Das Krankheitsbild der Schizophrenie, der schizotypen und wahnhaften Störung
Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Schizophrenie und verwandte Störungen. Es werden die historischen Entwicklungen der Krankheitsdefinition sowie die unterschiedlichen Symptome und Verlaufsformen der Schizophrenie erläutert. Auch die Bedeutung von Stresssituationen bei der Entstehung der Krankheit wird hier beleuchtet.
Aufgabe 2
In diesem Kapitel werden verschiedene Modelle zur Rolle der Bewertung bei der Entstehung von Emotionen vorgestellt. Es wird insbesondere das transaktionale Stressmodell von Lazarus erläutert, das die Interaktion von Bewertungsprozessen und Stressreaktionen beschreibt.
Aufgabe 3
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept der emotionalen Intelligenz. Es wird die Definition der emotionalen Intelligenz erläutert und deren Bedeutung in Teams betrachtet. Abschließend werden kritische Punkte und Einschränkungen des Konzepts der emotionalen Intelligenz diskutiert.
Schlüsselwörter
Schizophrenie, schizotype Störungen, wahnhafte Störung, Stress, Emotionen, Bewertung, transaktionales Stressmodell, Lazarus, Coping, emotionale Intelligenz, Teams, kritische Auseinandersetzung.
- Quote paper
- Sina Heller (Author), 2020, Allgemeine Psychologie. Schizophrenie, Kausalmodelle zur Entstehung von Emotionen und emotionale Intelligenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962104