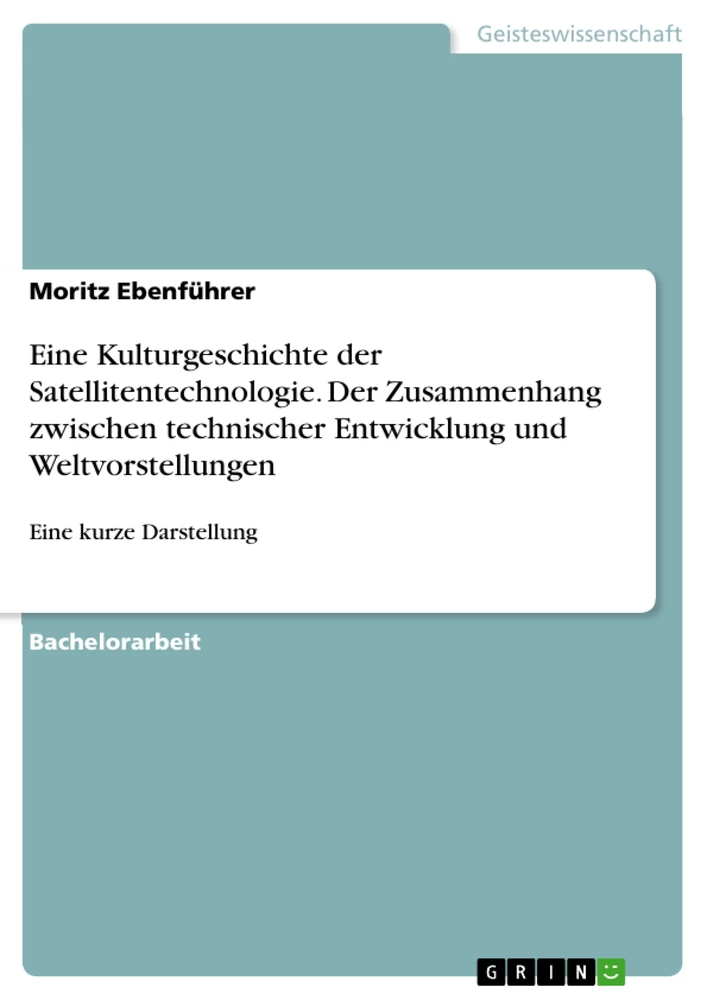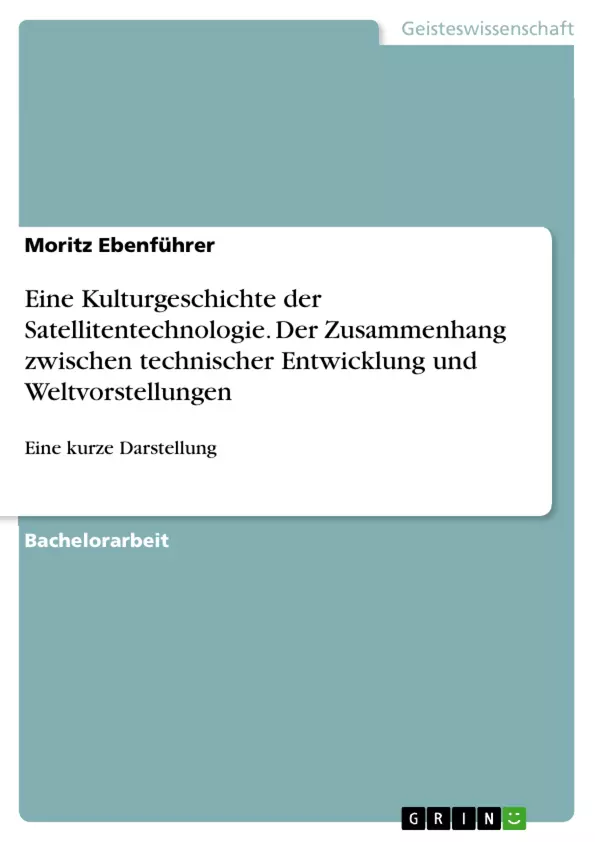Diese Arbeit stellt einen Versuch dar, Spuren zu finden, die auf eine grundlegende Einflussnahme von Satellitentechnologie auf menschliches Denken und Handeln hindeuten und eventuelle, dadurch hervorgerufene Veränderungen (Paradigmen) aufzuzeigen.
Um diese Frage(n) sinnvoll einzugrenzen, wird sich diese Arbeit auf die drei dominanten Marktsegmente der zivilen Satellitentechnologie: Erdbeobachtung, Telekommunikation und Navigation beschränken. Diese drei Bereiche werden jeweils in ihrer historischen Entwicklung überblicksmäßig beschrieben und auf die Frage untersucht: Was ermöglicht diese Technologie, was bisherige, erdgebundene Technologie nicht ermöglichte und welchen Einfluss hat diese Technologie auf das menschliche Leben?
Bevor im Hauptteil der Arbeit die einzelnen Einsatzgebiete von Satellitentechnologie abgehandelt werden soll zuerst der theoretische Rahmen, in dem Fragen gestellt und beantwortet werden, dargelegt werden. Ziel ist es, die enge Verbundenheit der technischen- mit der sozialen Umwelt des Menschen aufzuzeigen. Dies soll mit einer systematischen (Luhmann), problembasierten (Grundmann 1994) und kulturgeschichtlichen (Sachs 1994) sowie medientheoretischen (McLuhan 1995) Erklärung gelingen.
Es soll gezeigt werden, wie die Ausweitung der Einsatzgebiete und die enorme technische Entwicklung in diesem Bereich Weltvorstellungen forcieren, die vom Glauben an technische Machbarkeit, Prozessoptimierung und Objektivitätsansprüchen getragen werden. Die Vorstellungen von menschlicher Omnipotenz und Selbstvergrößerung auf der einen Seite werden jedoch dadurch kontrastiert, dass durch den Perspektivenwechsel, die Erde als verwundbares System mit vielschichtigen Interdependenzen gesehen wird, was wiederum der Ökologiebewegung Aufschub gab.
Der Untersuchungsbereich Navigation soll vor allem die Entstehung von globalen Satellitennavigationssystemen und deren zivile Nutzbarmachung thematisieren. Gemeinsam mit dem Untersuchungsbereich Telekommunikation, soll ein Blick darauf gerichtet werden, wie diese Technologien zentrale menschliche Kulturtechniken, nämlich das Navigieren (Orientieren) und das Kommunizieren, weiterentwickeln und verändern. Es sollen Rückschlüsse darüber gezogen werden, wie sich diese Technologien auf das Wahrnehmen räumlicher Distanz und Zeit (Virilio 1989, Schivelbusch 1977), der alltäglichen Orientierung im Raum und dem Erleben sozialer Beschleunigung (Rosa 2005) auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Verbundenheit technischer und sozialer Systeme
- Sozio-technische Systeme als Problemlöser
- Kulturgeschichte aus der Perspektive einer technischen Kultur
- Die zweite Kopernikanische Wende
- Erdbeobachtung
- Grundlagen der Erdbeobachtung
- Einsatzgebiete
- Geschichtliche Meilensteine
- Laufende Programme und laufende Bedenken
- Kommunikation
- Rechtlicher Rahmen
- Dynamischer Fortschritt durch Liberalisierung und Privatisierung
- Navigation
- Meilensteine
- Funktionsweise
- Vorteile
- Der Satellit als Medium der räumlichen und zeitlichen Distanz Überwindung
- Die Botschaft der Satelliten
- Soziale Beschleunigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die kulturellen Auswirkungen der Satellitentechnologie und analysiert, wie diese Technologie die menschliche Wahrnehmung und Interaktion mit der Welt verändert. Sie konzentriert sich auf die drei Hauptbereiche der zivilen Satellitentechnologie: Erdbeobachtung, Telekommunikation und Navigation.
- Die enge Verbundenheit technischer und sozialer Systeme
- Die Einflüsse der Satellitentechnologie auf menschliche Denk- und Handlungsweisen
- Die Bedeutung der Satellitentechnologie für die Weiterentwicklung der menschlichen Kulturtechniken
- Die Rolle der Satellitentechnologie in der Gestaltung von Weltvorstellungen und Wahrnehmung der Erde
- Die Auswirkungen der Satellitentechnologie auf die menschliche Wahrnehmung von räumlicher Distanz und Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die zentrale Forschungsfrage nach den kulturellen Auswirkungen der Satellitentechnologie und erläutert den theoretischen Rahmen der Untersuchung. Sie definiert die drei Hauptbereiche der zivilen Satellitentechnologie (Erdbeobachtung, Telekommunikation und Navigation), die im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert werden.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel erörtert die enge Verbundenheit zwischen technischen und sozialen Systemen und beleuchtet die wechselseitige Beeinflussung. Es stellt die Systemtheorie von Luhmann und Grundmann vor und beschreibt, wie technische Systeme auf soziale Belange und Lebensweisen von Menschen wirken.
- Erdbeobachtung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Einsatzgebieten der Erdbeobachtung und beleuchtet die Auswirkungen dieser Technologie auf Weltvorstellungen. Es analysiert, wie die Satellitentechnologie die Wahrnehmung der Erde als verwundbares System mit vielschichtigen Interdependenzen beeinflusst.
- Kommunikation: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen der Satellitentechnologie auf die Kommunikation und die Entwicklung des Telekommunikationsmarktes. Es betrachtet den Einfluss der Satellitentechnologie auf den rechtlichen Rahmen und den dynamischen Fortschritt durch Liberalisierung und Privatisierung.
- Navigation: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung von globalen Satellitennavigationssystemen und deren zivile Nutzbarmachung. Es untersucht, wie diese Technologien das Navigieren und Kommunizieren als zentrale menschliche Kulturtechniken weiterentwickeln und verändern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den kulturellen Auswirkungen von Satellitentechnologie, insbesondere mit den drei Bereichen Erdbeobachtung, Telekommunikation und Navigation. Wichtige Themen sind die Verbundenheit technischer und sozialer Systeme, die Auswirkungen der Technologie auf menschliche Denk- und Handlungsweisen, die Entwicklung von Weltvorstellungen und die Wahrnehmung räumlicher Distanz und Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Satellitentechnologie unser Weltbild?
Sie fördert Vorstellungen von technischer Machbarkeit und Omnipotenz, zeigt aber gleichzeitig die Erde durch den Perspektivenwechsel als verwundbares, vernetztes System.
Was sind die drei Hauptbereiche der zivilen Satellitentechnologie?
Die drei dominanten Segmente sind Erdbeobachtung, Telekommunikation und Navigation.
Was versteht man unter der „zweiten Kopernikanischen Wende“?
Es beschreibt den radikalen Perspektivenwechsel durch Satellitenbilder, die es dem Menschen erstmals erlaubten, die Erde als Ganzes von außen zu betrachten.
Wie verändert Satellitennavigation unsere Kulturtechniken?
Sie verändert grundlegend, wie wir uns im Raum orientieren und navigieren, was zu einer sozialen Beschleunigung und einer veränderten Wahrnehmung von Distanz führt.
Welchen Einfluss hat die Technologie auf die Wahrnehmung von Zeit?
Durch Echtzeit-Kommunikation und globale Vernetzung werden räumliche Distanzen scheinbar aufgehoben, was das Erleben von Zeit verdichtet und beschleunigt.
Was ist die „Botschaft der Satelliten“ laut Medientheorie?
In Anlehnung an McLuhan ist der Satellit selbst das Medium, dessen „Botschaft“ in der globalen Vernetzung und der Überwindung physischer Grenzen liegt.
- Quote paper
- Moritz Ebenführer (Author), 2020, Eine Kulturgeschichte der Satellitentechnologie. Der Zusammenhang zwischen technischer Entwicklung und Weltvorstellungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962226