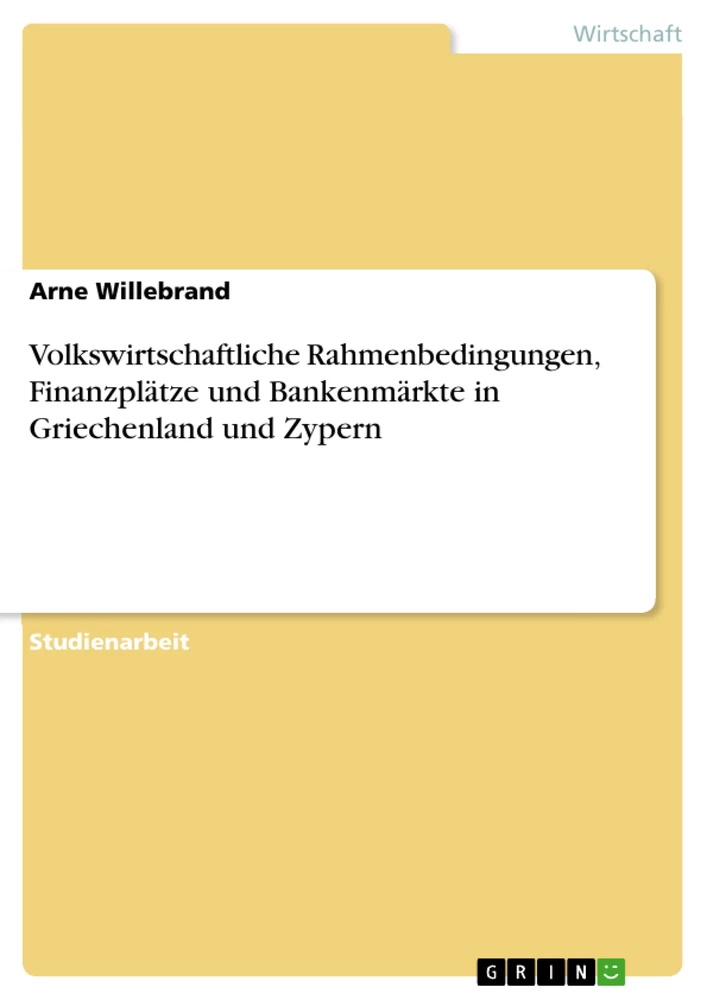Ziel dieser Arbeit ist es, einen quantitativen Überblick über volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte in Griechenland und Zypern zu geben. Zu diesem Zweck werden zentrale makroökonomische Indikatoren aufgezeigt, Entwicklungen veranschaulicht und in den jeweiligen Zusammenhängen interpretiert. Außerdem wird das vorherrschende geldpolitische Umfeld dargestellt und seine Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Griechenlands und Zyperns diskutiert. Vor diesem Hintergrund werden insbesondere die Wirtschaftsbilanzen der Mittelmeerstaaten untersucht und ihre jeweiligen Zusammenhänge mit der Eurokrise erklärt. Im Anschluss werden die länderspezifischen Krisenursachen skizziert und mögliche Lösungsszenarien erörtert. Darüber hinaus werden die Finanzplätze beider Länder in den internationalen Kontext eingeordnet. Vor dem Hintergrund der Regulierung werden die Bankenmärkte in Bezug auf die Wettbewerbssituation sowie einschlägige Erfolgs- und Risikoparameter analysiert. Abschließend erfolgen ein Fazit sowie ein Ausblick in die Zukunft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Fundamentale volkswirtschaftliche Daten und Entwicklungen
- Geld-, Kapital- und Devisenmärkte im Kontext Geldpolitik
- Wirtschaftsbilanzen
- Griechenland und Zypern: Zentrale Ursachen der Eurokrise
- Finanzplätze
- Der Bankenmarkt
- Regulatorische Rahmenbedingungen, Wettbewerbssituation und Auslandsbanken
- Erfolgs- und Risikobetrachtung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Finanzplätzen und Bankenmärkten in Griechenland und Zypern. Sie analysiert die Entwicklungen in diesen beiden Ländern im Kontext der Eurokrise und untersucht die Auswirkungen der Krise auf die Finanzmärkte.
- Volkswirtschaftliche Daten und Entwicklungen in Griechenland und Zypern
- Die Rolle der Geldpolitik und der Finanzmärkte in der Eurokrise
- Die Bedeutung der Finanzplätze und Bankenmärkte für die wirtschaftliche Entwicklung
- Die Auswirkungen der Eurokrise auf die Bankenmärkte in Griechenland und Zypern
- Die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Wettbewerbssituation im Bankenmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Seminararbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Gegenstand der Arbeit sowie die Forschungsfrage einführt. Im zweiten Kapitel werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Griechenland und Zypern analysiert. Es werden fundamentale Daten, wie das BIP, die Staatsverschuldung und die Inflationsrate, untersucht, um die wirtschaftliche Entwicklung der beiden Länder zu beleuchten. Zudem wird der Einfluss der Geldpolitik auf die Finanzmärkte betrachtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit den Finanzplätzen in Griechenland und Zypern. Im vierten Kapitel wird der Bankenmarkt in den beiden Ländern im Detail beleuchtet. Es werden die regulatorischen Rahmenbedingungen, die Wettbewerbssituation und die Bedeutung von Auslandsbanken analysiert. Außerdem wird die Erfolgs- und Risikobetrachtung der Bankenmärkte untersucht.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit beschäftigt sich mit den Themen Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze, Bankenmärkte, Eurokrise, Griechenland, Zypern, Geldpolitik, Finanzmärkte, Staatsverschuldung, Inflationsrate, Regulatorische Rahmenbedingungen, Wettbewerbssituation, Auslandsbanken, Erfolgs- und Risikobetrachtung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen dieser Arbeit über Griechenland und Zypern?
Die Arbeit analysiert die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte beider Länder im Kontext der Eurokrise.
Welche makroökonomischen Indikatoren werden untersucht?
Zentrale Daten wie das BIP, die Staatsverschuldung und die Inflationsrate werden herangezogen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beurteilen.
Wie hängen die Wirtschaftsbilanzen mit der Eurokrise zusammen?
Die Arbeit erklärt die länderspezifischen Krisenursachen und wie das geldpolitische Umfeld die Bilanzen der Mittelmeerstaaten beeinflusst hat.
Welche Rolle spielen Auslandsbanken in diesen Märkten?
Die Wettbewerbssituation und die Bedeutung von Auslandsbanken werden im Rahmen der regulatorischen Bedingungen analysiert.
Bietet die Arbeit Lösungsszenarien für die Krisenländer an?
Ja, nach der Skizzierung der Krisenursachen werden mögliche Lösungsszenarien und ein Ausblick in die Zukunft erörtert.
- Arbeit zitieren
- Arne Willebrand (Autor:in), 2017, Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, Finanzplätze und Bankenmärkte in Griechenland und Zypern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962232