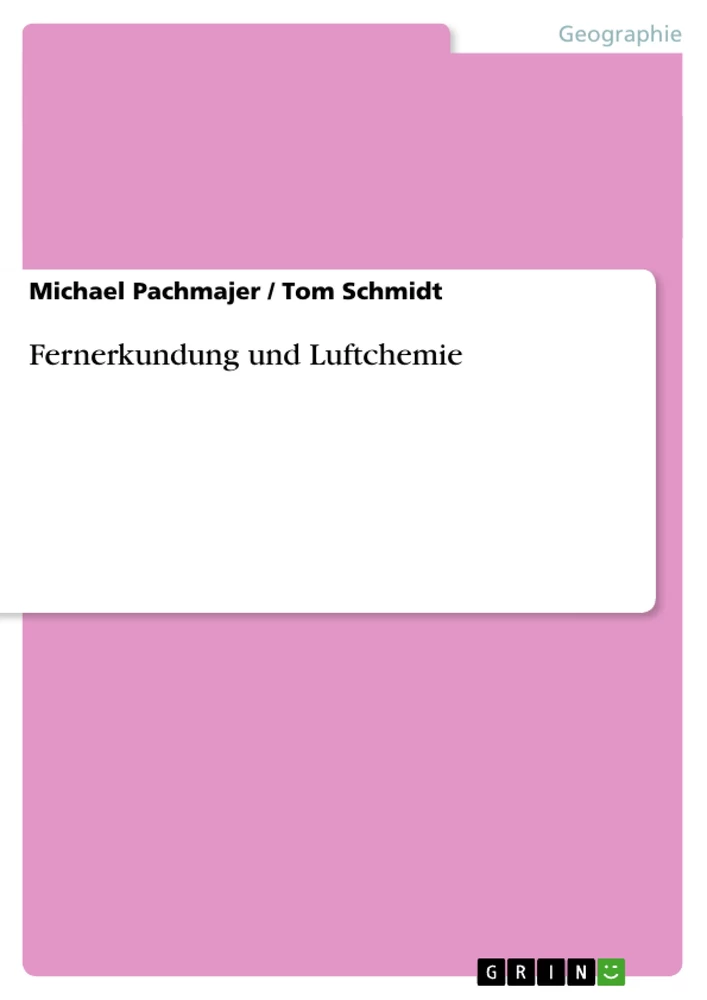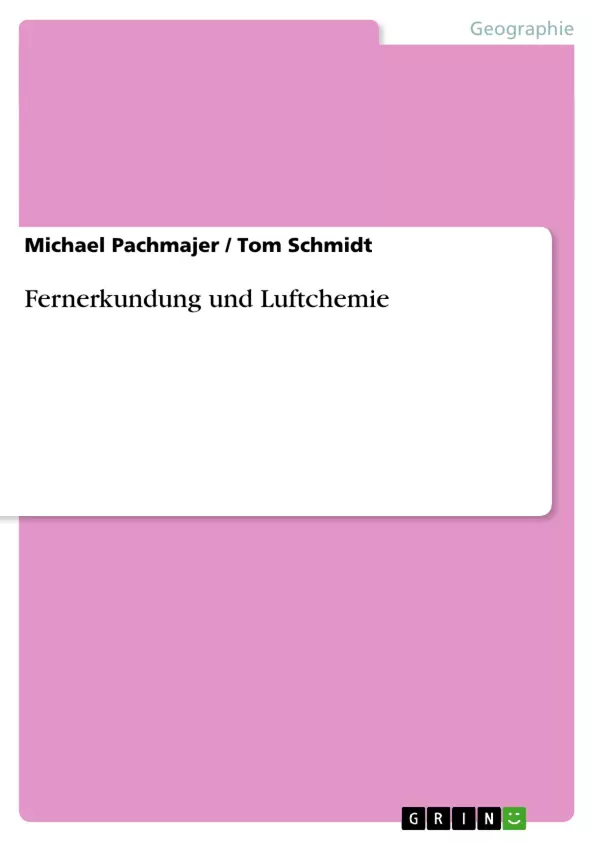Fernerkundung und Luftchemie
Die Messungen von Luftverunreinigungen werden in Schichten weit oberhalb des Erdbodens durchgeführt, weil dort die Hauptmasse der Luftverunreinigungen hin transportiert werden.
Mit gut ausgerüsteten Meßflugzeugen ist es möglich vertikale Profile anzulegen und Schadstoffahnen räumlich zu erfassen; sie in ihrer Bewegung nachzuvollziehen.
Das Interesse an den klassischen Schadstoffen (Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid) verschiebt sich z.Z. zu anderen Schadgasen kleinerer Konzentration (Methan), die photochemisch gebildet werden oder zur Bildung anderer Schadgase beitragen. Für das Messen von Luftverunreinigungen gilt die Regel: je niedriger die Konzentration des Schadgases ist, desto schwieriger ist es, das Spurengas zu messen (wenigere Moleküle, Querempfindlichkeiten wahrscheinlicher).
Die Luftqualität bestimmenden Stoffe sind Emissionen der Erdoberfläche.
Gemessen werden u.a. folgende Stoffe:
- Schwefeldioxid
- Kohlenwasserstoff
- FCKW
- Stickoxide
- Ozon
und meteorologische Parameter wie Windfeld, Temperatur, Feuchte.
Schwefeldioxid
Ü ber den Landgebieten werden höhere SO2 -Werte gemessen, da sich hier die anthropogenen Quellen für SO2 befinden (Kraftwerke, Industrie, Hausbrand, Kraftfahrzeugverkehr). Das SO2 ist ein Oxidationsprodukt des in organischen Brennstoffen vorkommenden Schwefels.
Der Abbau von SO2:
- durch die Oxidation mittels OH-Radikalen in der Gasphase (homogene Reaktion)
- heterogene Oxidation in Nebel und -Wolkentröpfchen (Oxidationsmittel h2O2 ). Dabei entstehen Sulfite und Sulfate, die mit dem Regen ausgewaschen werden (saurer Regen)
- das gasförmige SO2 lagert sich an den Erdboden und die Vegetation an
Stickstoffoxide
Die Hauptquellen für natürliche Stickstoffoxide sind Blitze, die Oxidation von natürlichem Ammonium in der Atmosphäre und die Abgase aus Böden und die stratospärische N2O- Oxidation. Die wichtigsten anthropogenen Quellen für Stickstoffoxide sind alle Verbrennungsvorgänge bei höheren Temperaturen.
Der Abbau von NOx:
- Reaktion von NO2 mit dem OH-Radikal zu HNO3 , die wegen der photochemischen
Erzeugung von OH nur am Tage abläuft und in der Nacht die Oxidation des NO2 durch Ozon zu NO3 .
Ozon
Ozon tritt entweder als stratospärische Ozonschicht auf oder als bodennahes Ozon an der Erdoberfläche. Am Tag findet an der Erdoberfläche eine Ozonerzeugung statt: NO2 + UV-Strahlung à NO + O
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In der Nacht findet dann allerdings der Ozonabbau, bei geringerer Lichtintensität, statt: NO + O 3 à NO 2 + O 2
Meßmethoden:
für Ozon UV-Absorptionsmethode oder Chemoluminiszenzmethode für Schwefel Flammenphotometer oder UV-Meßmethode
bei Stickstoff wird sowohl die Summe aller Stickstoffoxidverbindungen als auch NO, NO2 und NOx gemessen.
Darüber hinaus breitet sich die Erkenntnis aus, das der dreidimensionale Transport und die chemische Umwandlung allein durch bodengestützte Messungen nicht mehr ausreicht und durch fluggestützte Messungen und Messungen von Satelliten ergänzt werden müssen.
Die areodynamischen Probleme der Lufteinlässe für die Meßgase am Flugzeug, die ständigen Druck- und Temperaturänderungen mit der Höhe und die elektromagnetische
Beeinflussungen zwischen Meßinstrumentarium und Flugzeugsystem berechtigen zu der
Aussage.
Je nach Fluggeschwindigkeit wird eine Aufzeichnung verschiedener Stoffe entweder als eine räumliche Verteilung zu einem festen Zeitpunkt oder die Darstellung der räumlichen Verteilung als Trend zeitlicher Entwicklungen erreicht.
Anwendungen einer für Bodenstationen konzipierten Meßtechnik im Flugzeug ist ohne erhebliche Modifikationen nicht möglich.
Hauptkomponenten eines modernen Flugzeugmeßsystems
- das geeignete Flugzeug
- Probenahmesysteme und Meßgasführung
- luftchemisches Meßinstrumentarium
- meteorologisches Meßinstrumentarium
- Navigations- und Flugführungssysteme
- Prozeßsteuerung
- Datenverarbeitungssysteme
- Eichsysteme, Kalibriersysteme und Qualitätssicherung
Anforderungen von fluggestützten Messungen.
- höherer Empfindlichkeit
- größere Spezifizität
- größtmögliche Universität
- bei niedrigem Druck noch empfindlich messen (Verdichtung der Luftprobe führt zur Veränderung der Zusammensetzung)
- Eichung der Geräte (Instrumente, die während des Meßflugs keine Eichung benötigen)
Verunreinigungen der Meßleitungen können zur Reaktion mit den Meßgasen führen und somit zu Verfälschung der Meßergebnisse.
Bei Flugzeugmessungen sind folgende wissenschaftliche Ziele zu erreichen:
- die Erfassung der wichtigsten Ausbreitungsschneisen für die Emissionen aus intensiven Quellen in stark industriell genutzten Gebieten
- die Bilanzierung der Massen einzelner Stoffgruppen aus den Messungen
- die Bereitstellung von Eingabedaten und Verifikationsdaten für Modellsimulationen
Planung der Flugpfade:
1. Simulationsrechnung ergibt eine erste Übersicht über die zu erwartenden Bedingungen
2. Naturmessung
Anforderungen an Flugzeugmeßaufgaben für den Umweltschutz und Umweltforschung Aufgabenstellungen im lokalen, mesoskaligen und globalen Bereich.
Im lokalen Bereich sind wegen der hohen räumlichen und zeitlichen Auflösung sehr schnelle Meßgeräte und sehr langsam fliegende Flugzeuge erforderlich. Es kann genau erforscht werden wie sich die Transportvorgänge von Abgasen bei unterschiedlichen Wetterlagen verändern. Im mesoskaligen Bereich wird die Erforschung der vertikalen Schichtungen der luftchemischen Komponenten und die in diesen Schichtungen herrschenden meteorologischen Ausbreitungsbedingungen vorgenommen. Dabei werden hauptsächlich grenzüberschreitende Einträge untersucht und nachgewiesen. Im globalen Bereich sind niedrige Nachweisgrenzen, wegen der geringen Konzentration, notwendig. Meßflügeüber den Meeren benötigen wegen der relativ geringen aber homogenen Verteilung von Schadstoffen weniger schnelle als vielmehr extrem genaue Geräte.
Literatur:
SCHUFMANN, G. & GIEHL, H. (1989): Anforderungen an die Meßsysteme und die
Flugleistungen von Umweltmeßflugzeugen in Abhängigkeit von der Aufgabenstellung.- VDIKommission Reinhaltung der Luft, 15: 1-33; Garmisch-Partenkirchen.
SLEMR, F. (1989): Anwendung der Adsorptionsspektroskopie mit abstimmbaren Dioden- Lasern vom Flugzeug aus - Vergleich mit herkömmlichen Verfahren der Spurengasmessungen.- VDI-Kommission Reinhaltung der Luft, 15: 89-102; Garmisch- Partenkirchen.
FIEDLER, F. (1989): Analyse luftchemischer Flugzeugmessungen während des TULLA-
Experiments.- VDI-Kommission Reinhaltung der Luft, 15: 103-112; Garmisch-Partenkirchen.
PAFFRATH, D. & W. PETERS (1987): Untersuchung großräumiger
Luftschadstoffbelastungen im Zusammenhang mit den Waldschäden in Bayern.- Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt FB87-17: 38-42; Oberpfaffenhofen.
Übung: Luftbildauswertung und Fernerkundung 23.01.1995 Tom Schmidt
Michael Pachmajer
ALTLASTEN
Definition
"Als Altlasten im Sinne dieser Richtlinien gelten Altablagerungen und Altstandorte, sofern von diesen nach den Erkenntnissen einer im einzelnen Falle vorausgegangenen Gefährdungsabschätzung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht." (Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, NRW)
Klassifikationsschema für Altlasten
Gliederung in folgende Kategorien:
- Altablagerungen
- Altstandorte
- militärische Anlagen
Die wichtigsten Informationsquellen zur beprobungslosen Erfassung von Altlastenverdachtsflächen sind
- Luftbilder (M 1:6000 bis 1:40000)
- Topographische Karten (TK 25, DGK 5)
- Akten (von Behörden, Betrieben)
Sie sollten eine zeitliche Kontinuität aufweisen, flächendeckend und objektiv sein.
Multitemporale Analyseverfahren
Die Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen erfordert eine chronologisch und lückenlose Zusammenstellung von Karten und Luftbildern.
Altlastverdachtsflächen werden heute in die DGK 5 bei Bekanntwerden aufgenommen.
Zur Identifizieren und Erfassung von Altlastenverdachtsflächen dienen Kartenlesehilfen und Fotoschlüssel.
Literatur
Borries:, Hans-Walter (1991): Altlastenerfassung und -Erstbewertung durch die multitemporale Karten- und Luftbildauswertung. Würzburg.
Borries, Hans-Walter und Heinz Hüttl (1990):Beprobungsfreie Erfassung und Erstbewertung von Rüstungsaltlasten - Einsatz und Effizienz der multitemporalen Karten-, Luftbild- und Altlastenauswertung - In: Spyra, W. (Hrsg.): Rüstungsaltlasten in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Sachstand Über die Diskussion zur Erfassung, Gefährdungsabschätzung und Entsorgung von Rüstungsaltlasten. S. 137-170. Berlin.
Huber, E. und P. Volk (1986): Deponie- und Altlasterkundung mit Hilfe von Fernerkundungsdaten. In: Wasser und Boden, Jg. 38. Heft 10. S. 509-515
Böden allgemein.
Die Schwierigkeit der Aufnahme von Böden durch die Fernerkundung besteht darin, daß sich die Bodenprofile unter der Geländeoberfläche befinden. daher ist nur eine kombinierte Aufnahme von Gländearbeit und Luftbildinterpretation sinnvoll.
Infrarotfarbfilme bilden unbewachsene, organogene Böden differenziert ab. Radaraufnahmen sowie konventionelle Luftbilder zeigen die extremen Unterschiede in der Bodenfeuchtigkeit oder -struktur bzw. Pflanzenfeuchtigkeit oder -struktur auf. Mit Hilfe von Infrarotdetektoren gelingt aufgrund von Wärmeemission die Identifizierung der Bodeneigenschaften unter Geländeoberfläche. Die folgende Formel verdeutlicht dies:
A = S - R - E
A = von der Erde zrückbehaltende Strahlung
S = gesamte Sonneneinstrahlung
R = reflektierte Sonneneinstrahlung
E = von der Erde ausgehende wirksame Strahlung
A ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit und von der volumetrischen Wärmekapazität und wird beeinflußt durch die Eigenschaften unter der Geländeoberfläche (z.B. Bodenfeuchtigkeit und bodennahe Luftfeuchtigkeit). Daher ist die günstigste Aufnahmezeit bei gleichmäßiger Vegetation und Bodenfeuchtigkeit im Spätherbst und im Frühwinter.
Begriff ALTLASTEN tritt erstmals 1978 im "Umweltgutachten 1978" des Rates von
Sachverständigen für Umweltfragen auf und meint die Bezeichnung von umweltgefährdenden alten Abfallablagerungen vornehmlich aus der Zeit vor Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes von 1972.
1980 bezeichnet der MURL NRW als ALTLASTEN neben den Ablagerungsplätzen werden jetzt auch Schadstoffanreicherungen auf dem Gelände stillgelegter oder noch betriebener Anlagen angenommen. Bei dieser vorgenommenen Definition werden die Anlagen jedoch nicht nach Idustrie- und Gewerbezweigen differenziert. Insgesamt wird von ALTLASTEN gesprochen, wenn eine Gefährdungsabschätzung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit attestiert. Liegt für eine Fläche noch keine solche Untersuchung vor, dann handelt es sich um eine Altlastverdachtsfläche; Synonyme sind Kontaminationen oder kontaminierte Standorte oder schadstoffverdächtige Flächen.
Erweiterung der Definition mit dem Ziel einer systematischen Atlastenerkundung (das erfassen sämtlicher Verdachtsflächen). Die Erweiterung erfordert eine stärkere
Differenzierung der Kategorien "Altablagerungen" und "Altstandorte", sowie Hinweise über potentielle Verursacher von Altlasten. Darunter werden auch Standorte verstanden, auf denen Stoffe transportiert, zwischen- und endgelagert oder behandelt werden. Altablagerungen umfaßt alle unkontrollierten Flächen, auf denen es durch menschliches Handeln zur Verfüllung mit und Aufschüttung von umweltgefährdenden Stoffen kommt.
Altlasten gibt es bereits seit den Anfängen der Industrialisierung. Die Informationsquellen sollten eine zeitliche Kontinuität aufweisen, den Erfordernissen einer flächendeckenden Altlastenermittlung gerecht werden und objektiv sein. Besonders geeignet sind deshalb großmaßstäbige topographische Karten (DGK 5, TK 25), Luftbilder (panchromatische Reihenmeßbilder entweder als Stereobildpaare M 1:6000 bis 1:40000 oder als deren
Verkleinerungen bzw. deren Vergrößerungen) und Satellitenaufnahmen.
Durch die bei Luftbildern gegebene Momentaufnahme wird der Objektivität des
Sachverhaltes Rechnung getragen. Sie geben die Realität inhaltlich richtig und vollständig wieder. Dagegen sind Karten wirkllichkeitsnahe Informationsträger. Die Auswertung von Luftbildern geschieht durch stereoskopische Betrachtungs- und Umzeichengeräte.
Luftbildinformationen sind ausschließlich über die Analyse von Bildmerkmalen und über
Indikatoren zu ermitteln.Die Objektansprache weist einen höheren Grad der Unsicherheit und Ungenauigkeit auf. Für die Verdachtsflächen müssen nach Dodt (1984) alle jene Bildinhalte zusammengestellt werden, die durch ihr Vorhandensein und/oder ihre Erscheinungsform und Ausprägung die gesuchten nicht sichtbaren Objekte und Tatbestände anzeigen. Die Genauigkeit der Ergebnisse der Karten- und Luftbildauswertung hängen vom altlastenrelevanten Fachwissen des Auswertungspersonals ab.
Zur systematischen Verdachtsflächenerkundung ist die Erarbeitung von
Klassifikationsschemata unabdingbar. Diese Schemata für Altlasten sollten möglichst viele umweltgefährdende Flächennutzungen berücktigen. Dabei werden die Hauptkategorien "Altablagerungen", "Altstandorte" und "Militärische Anlagen" nach Sachkategorien stufenweise in Unterklassen verschiedener Ordnung untergliedert. Dadurch werden neben Aussagen zu Indusrie- und Gewerbezweige auch eingrenzende Hinweise zu speziellen Produktionsanlagen aufgeführt, bei denen ein Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen stattgefunden hat bzw. nicht auszuschließen ist. Diese Klassifikationsschemata sind ein erster Schritt zur Ansprache von Kontaminationskategorien.
Indikator für Verdachtsflächen sind industriegewerbliche Flächennutzen, d.h. Betribsfläche und einzelne Anlagteile, Deponien, Aufhaldungen, Geländeverfüllungen und Abgrabungen. Bei der systematisch-flächendeckenden Erfassung von Verdachtsflächen (Altlastenerkundung)steht die Rekonstruktion ehemaliger Flächennutzungen im Mittelpunkt. Es reicht bei weitem nicht aus Karten eines Fortführungsstandes und Luftbilder eines Aufnahmedatums als Informationsquelle heranzuziehen (monotemporale Auswertungsmethode), weil altlastenrelevante Veränderungen des Flächennutzungsgefüges eines Raumes nicht erfast werden. Nur eine Untersuchung von Karten und Luftbildern zeitlich unterschiedlicher Aufnahme- und Ausgabestände ermöglicht eine annähernd vollständige Erfassung aller Verdachtsflächen (multitemporale Analyseverfahren). Die Karten- und Luftbildanalyse muß sich auf alle verfügbaren Zeiträume beziehen. Das erfordert eine chronologische und lückenlose Zusammenstellung der Informationsquellen.
Zwei Vorgehensweisen der multitemporalen Auswertung:
- die progressiv-forschreibende und
- die retrogressiv-rückschreibende Vorgehensweise.
Erstere geht von der frühsten Vergangenheit aus und analysiert die Raumentwicklung zur Gegenwart. Zweitere geht davon aus, daß in bestimmten Zeitabschnitten ermittelte Verdachtsflächen nicht nur in ihrer Entwicklung bis zur Gegenwart verfolgt werden, sondern auch ihr Entstehungszeitpunkt nachträglich bestimmt werden muß.
Kartierung von Altlastverdachtsflächen
Einheitliche Kartierungsgrundlage ist die DGK 5 N (Normalausgabe) oder die DGK 5 G (Grundriß, ohne Höhenlinien) oder die DGK 5 L (Luftbildkarte). Als Kartierungsmethode wird die Realnutzungskartierung verwendet. Dieses Verfahren basiert auf der Kartierung des realen Grenzlinienverlaufs der altlastrelevanten Flächennutzung aus verschiedenen Informationsträgern in die Basiskarte (DGK 5). Aus den verschiedenen Ausgabebeständen der TK 25 und der DGK 5 werden die betreffenden Areale über eine eventuelle Maßstabsanpassung in die Basiskarte hochgezeichnet. Danach werden die maximale Ausdehnung des Betriebsgeländes, Gebäundegrundrisse (Gebäundesignaturen) und Umgrenzungslinien von Aufschüttungen und Gruben kartiert. Bei der Verwendung von Luftbildern, im Maßstab 1:12000 bis 1:13000 ist ebenfalls eine maßstabsanpassung erforderlich. In Anlehnung an das Klassifikationsschemata der Altlasten ist zur Karteirung der Verdachtsflächen ein Katalog von Nutzungskategorien zu erarbeiten, um die Suchinhalte bzw. Erfassungskategorien darzustellen.
Da aufgrund der Datenfülle nicht alle Hinweise auf Verdachtsflächen kartographisch festgehalten werden können, bedarf es zusätzlich eines Erfassungsbogens (Erfassungstammblatt) zur Datensammlung. Grundsätzlich erfolgt die Eintragung in das Stammblatt jeweils für eine Verdachtsfläche durch Ankreuzen der entsprechenden Hinweise parallel zur Kartierung.
Kartelesehilfen und Fotoschlüssel
Häufig gestellte Fragen zu Fernerkundung und Luftchemie
Was sind die Hauptgründe für die Messung von Luftverunreinigungen in höheren Luftschichten?
Die Hauptmasse der Luftverunreinigungen wird in diese Schichten transportiert.
Welche Vorteile bieten Messflugzeuge bei der Erfassung von Luftverunreinigungen?
Mit gut ausgerüsteten Meßflugzeugen ist es möglich, vertikale Profile anzulegen und Schadstoffahnen räumlich zu erfassen und ihre Bewegung nachzuvollziehen.
Welche Schadstoffe stehen derzeit im Fokus der Luftqualitätsforschung?
Das Interesse verschiebt sich von klassischen Schadstoffen wie Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid zu Schadgasen in kleineren Konzentrationen (Methan), die photochemisch gebildet werden oder zur Bildung anderer Schadgase beitragen.
Welche Regel gilt für das Messen von Luftverunreinigungen bezüglich ihrer Konzentration?
Je niedriger die Konzentration des Schadgases ist, desto schwieriger ist es, das Spurengas zu messen.
Welche Stoffe werden unter anderem bei der Bestimmung der Luftqualität gemessen?
Schwefeldioxid, Kohlenwasserstoff, FCKW, Stickoxide und Ozon sowie meteorologische Parameter wie Windfeld, Temperatur und Feuchte.
Warum werden über Landgebieten höhere SO2 -Werte gemessen?
Hier befinden sich die anthropogenen Quellen für SO2 (Kraftwerke, Industrie, Hausbrand, Kraftfahrzeugverkehr). Das SO2 ist ein Oxidationsprodukt des in organischen Brennstoffen vorkommenden Schwefels.
Wie erfolgt der Abbau von SO2?
Durch Oxidation mittels OH-Radikalen in der Gasphase, heterogene Oxidation in Nebel und Wolkentröpfchen sowie Anlagerung des gasförmigen SO2 an den Erdboden und die Vegetation.
Was sind die Hauptquellen für natürliche Stickstoffoxide?
Blitze, die Oxidation von natürlichem Ammonium in der Atmosphäre, Abgase aus Böden und die stratosphärische N2O- Oxidation.
Welche anthropogenen Quellen sind für Stickstoffoxide verantwortlich?
Alle Verbrennungsvorgänge bei höheren Temperaturen.
Wie werden Stickstoffoxide abgebaut (NOx)?
Durch Reaktion von NO2 mit dem OH-Radikal zu HNO3 oder durch Oxidation des NO2 durch Ozon zu NO3.
Wie entsteht und wie wird Ozon abgebaut?
Am Tag findet an der Erdoberfläche eine Ozonerzeugung statt: NO2 + UV-Strahlung à NO + O. In der Nacht findet der Ozonabbau statt: NO + O 3 à NO 2 + O 2
Welche Messmethoden gibt es für Ozon?
UV-Absorptionsmethode oder Chemoluminiszenzmethode.
Welche Messmethoden gibt es für Schwefel?
Flammenphotometer oder UV-Meßmethode.
Welche Erkenntnis breitet sich in Bezug auf Messungen aus?
Das der dreidimensionale Transport und die chemische Umwandlung allein durch bodengestützte Messungen nicht mehr ausreicht und durch fluggestützte Messungen und Messungen von Satelliten ergänzt werden müssen.
Welche Herausforderungen gibt es bei flugzeuggestützten Messungen?
Areodynamische Probleme der Lufteinlässe, ständige Druck- und Temperaturänderungen mit der Höhe und elektromagnetische Beeinflussungen.
Welche Komponenten gehören zu einem modernen Flugzeugmeßsystem?
Das geeignete Flugzeug, Probenahmesysteme und Meßgasführung, luftchemisches Meßinstrumentarium, meteorologisches Meßinstrumentarium, Navigations- und Flugführungssysteme, Prozeßsteuerung, Datenverarbeitungssysteme, Eichsysteme, Kalibriersysteme und Qualitätssicherung.
Welche Anforderungen werden an fluggestützte Messungen gestellt?
Höhere Empfindlichkeit, größere Spezifizität, größtmögliche Universität, empfindliches Messen bei niedrigem Druck und Eichung der Geräte während des Meßflugs.
Was sind die wissenschaftlichen Ziele von Flugzeugmessungen?
Die Erfassung der wichtigsten Ausbreitungsschneisen, die Bilanzierung der Massen einzelner Stoffgruppen und die Bereitstellung von Eingabedaten und Verifikationsdaten für Modellsimulationen.
Was ist bei der Planung von Flugpfaden zu beachten?
Simulationsrechnung für eine erste Übersicht und Naturmessung.
Welche Aufgabenstellungen gibt es im Umweltschutz und der Umweltforschung im lokalen, mesoskaligen und globalen Bereich?
Im lokalen Bereich sind sehr schnelle Meßgeräte und langsam fliegende Flugzeuge erforderlich. Im mesoskaligen Bereich wird die Erforschung der vertikalen Schichtungen und Ausbreitungsbedingungen vorgenommen. Im globalen Bereich sind niedrige Nachweisgrenzen notwendig.
Was gilt als Altlast im Sinne der Richtlinien?
Altablagerungen und Altstandorte, sofern von diesen nach den Erkenntnissen einer im einzelnen Falle vorausgegangenen Gefährdungsabschätzung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht.
In welche Kategorien werden Altlasten gegliedert?
Altablagerungen, Altstandorte und militärische Anlagen.
Welche Informationsquellen dienen zur beprobungslosen Erfassung von Altlastenverdachtsflächen?
Luftbilder, topographische Karten und Akten.
Was ist bei Informationsquellen zur Erfassung von Altlasten zu beachten?
Sie sollten eine zeitliche Kontinuität aufweisen, flächendeckend und objektiv sein.
Was sind Multitemporale Analyseverfahren?
Die Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen erfordert eine chronologisch und lückenlose Zusammenstellung von Karten und Luftbildern.
Wie erfolgt die Aufnahme von Böden durch die Fernerkundung?
Durch eine kombinierte Aufnahme von Gländearbeit und Luftbildinterpretation, da sich die Bodenprofile unter der Geländeoberfläche befinden.
Was ist die Bedeutung des Begriffs ALTLASTEN im "Umweltgutachten 1978"?
Die Bezeichnung von umweltgefährdenden alten Abfallablagerungen vornehmlich aus der Zeit vor Inkrafttreten des Abfallbeseitigungsgesetzes von 1972.
Was umfaßt der Begriff ALTLASTEN laut MURL NRW im Jahr 1980?
Neben den Ablagerungsplätzen werden jetzt auch Schadstoffanreicherungen auf dem Gelände stillgelegter oder noch betriebener Anlagen angenommen.
Wann spricht man von ALTLASTEN und wann von Altlastverdachtsflächen?
Von ALTLASTEN wird gesprochen, wenn eine Gefährdungsabschätzung eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit attestiert. Liegt für eine Fläche noch keine solche Untersuchung vor, dann handelt es sich um eine Altlastverdachtsfläche.
Was sind typische Indikatoren für Verdachtsflächen?
Industriegewerbliche Flächennutzen, Deponien, Aufhaldungen, Geländeverfüllungen und Abgrabungen.
Was steht bei der systematisch-flächendeckenden Erfassung von Verdachtsflächen im Mittelpunkt?
Die Rekonstruktion ehemaliger Flächennutzungen.
Welche Analyseverfahren gibt es bei der Auswertung des zeitlichen Verlaufes?
Zwei Vorgehensweisen der multitemporalen Auswertung: die progressiv-forschreibende und die retrogressiv-rückschreibende Vorgehensweise.
Was sind Kartelesehilfen und Fotoschlüssel?
Hilfsmittel zur Identifizierung und Erfassung von Altlastenverdachtsflächen.
- Quote paper
- Michael Pachmajer (Author), Tom Schmidt (Author), 1995, Fernerkundung und Luftchemie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96233