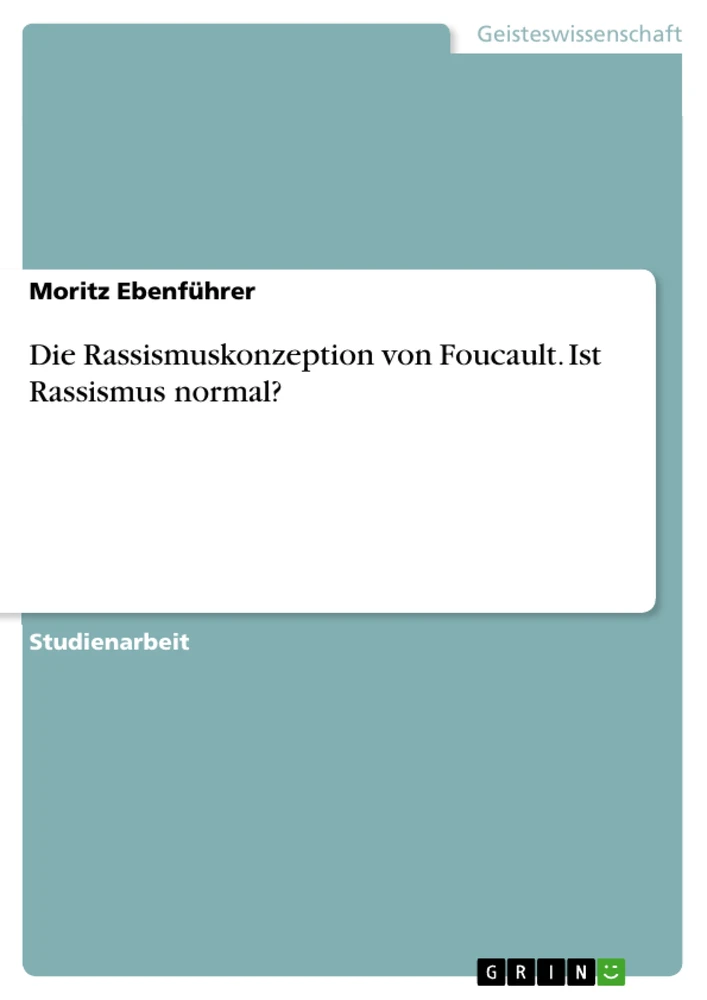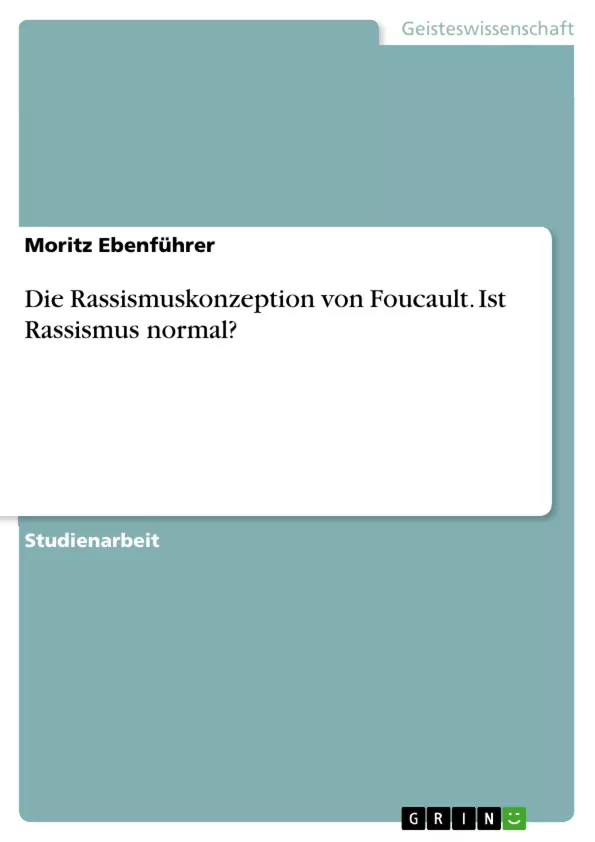Kapitelübersicht
1. Versuch einer Definition von Rassismus und seine Veranschaulichung anhand von historischen Transformationen Transformation der Differenzkonstruktionen Rasse und Kultur
2. Transformation des religiösen Rassismus
3. Die vier Momente von Rassismus
4. Normalität und Rassismus
5. Produktion von Ungleichheit am Beispiel der Überweisungspraxis in Sonderschulen
6. Normalität als Imagination von Ordnung
7. „Woher kommst du?“
8. Ordnen, Trennen, Messen – Kontrollierende und regulierende Ausschlusstechniken und ihre Entstehung unter dem Aspekt der Herausbildung von modernen Nationalstaaten
9. Leben machen, sterben lassen - Foucaults Rassismuskonzeption im Hinblick auf moderne Biopolitik
10. Medien und Symbolik
11. Strategien zur Festlegung von Normalitätsgrenzen
12. „Das Boot ist voll“
13. Schlussbemerkung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein möglichst umfassendes Bild vom Rassismus zu zeichnen und den LeserInnen die Entstehungsbedingungen und Wirkungsweisen von Rassismus in modernen, westlichen Nationalstaaten zu veranschaulichen. Ich möchte darüber informieren, durch welche Faktoren sich Rassismus im Allgemeinen kennzeichnet, und erörtern, wodurch sich der moderne Rassismus von früheren Erscheinungsformen unterscheidet. Dazu werde ich an Michelle Foucaults Rassismuskonzeption anschließen und Rassismus als Normalität erzeugendes, diskursiv hervorgebrachtes Dispositiv beschreiben.
Als Dispositiv gedacht ist Rassismus ein Tragpfeiler der Normalisierungsgesellschaft, deren Machtstrukturen die Subjekte in qualifizierender, messender und abschätzender Form an der Norm ausrichten und davon Abweichende als Bedrohung für das Gemeinwohl kennzeichnen und schließlich ausschließen (Foucault). Um Rassismus in dieser umfassenden Form zu kontrastieren, werde ich die historische Verschiebung der Machtstrukturen, die in einer auf das Leben gerichteten, wohlfahrtsstaatlichen Bio- Politik gipfeln, genauer beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Versuch einer Definition von Rassismus und seine Veranschaulichung anhand von historischen Transformationen
- Transformation der Differenzkonstruktionen Rasse und Kultur
- Transformation des religiösen Rassismus
- Normalität und Rassismus
- Produktion von Ungleichheit am Beispiel der Überweisungspraxis in Sonderschulen
- Normalität als Imagination von Ordnung
- ,,Woher kommst du?\" - Ordnen, Trennen, Messen - Kontrollierende und regulierende Ausschlusstechniken und ihre Entstehung unter dem Aspekt der Herausbildung von modernen Nationalstaaten
- Leben machen, sterben lassen
- Medien und Symbolik
- Strategien zur Festlegung von Normalitätsgrenzen
- ,,Das Boot ist voll\"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie sich Rassismus auf Normalitätsvorstellungen auswirkt und ob man von einer Alltäglichkeit des Rassismus sprechen kann. Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Bild von Rassismus zu zeichnen und die Entstehungsbedingungen und Wirkungsweisen von Rassismus in modernen, westlichen Nationalstaaten zu veranschaulichen. Es werden die Faktoren, die Rassismus charakterisieren, erörtert und die Unterschiede zwischen modernem Rassismus und früheren Erscheinungsformen analysiert.
- Die Wirkungsweise von Rassismus anhand historischer Transformationsprozesse
- Die Transformation von kolonialem Rassismus zum kulturellen Rassismus
- Die Transformation von religiösem Rassismus zu rassistischem Antisemitismus
- Die Rolle von Normalität in der Konstruktion und Reproduktion von Rassismus
- Die Verankerung von Rassismus in gesellschaftlichen Strukturen und Praxen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung legt die Motivation und Zielsetzung der Arbeit dar und stellt die zentrale These auf, dass Rassismus Normalität prägt und zugleich voraussetzt. Es wird die These aufgezeigt, dass Rassismus als Strukturierungsgröße gesellschaftlicher Realität gewissermaßen uns alle betrifft.
- Das Kapitel "Versuch einer Definition von Rassismus und seine Veranschaulichung anhand von historischen Transformationen" beschreibt Rassismus als soziale Praxis und beleuchtet verschiedene historische Transformationsprozesse, die die Entwicklung und Funktion von Rassismus prägten.
- Im Kapitel "Transformation der Differenzkonstruktionen Rasse und Kultur" wird der Ursprung der Rasse-Konstruktion im Kolonialismus analysiert. Es wird die Legitimationsfunktion der Rasse-Konstruktion in Bezug auf die Deklaration der Menschenrechte erläutert und der Übergang vom kolonialen Rassismus zum kulturellen Rassismus beschrieben.
- Das Kapitel "Transformation des religiösen Rassismus" beleuchtet die Transformation des christlichen Antijudaismus zu einem rassistischen Antisemitismus. Es wird die Entstehung von antiislamischem Rassismus als aktuelles Beispiel für die Perpetuierung von religiös basierten Differenzierungen diskutiert.
- Das Kapitel "Normalität und Rassismus" betrachtet die Rolle von Normalität in der Konstruktion und Reproduktion von Rassismus. Es wird diskutiert, wie Normalität als Imagination von Ordnung, als kontrollierende und regulierende Ausschlusstechnik und als Mittel zur Festlegung von Normalitätsgrenzen funktioniert.
Schlüsselwörter
Rassismus, Normalität, Transformation, Kolonialismus, kultureller Rassismus, religiöser Rassismus, Antisemitismus, antiislamischer Rassismus, Normalitätsgrenzen, Ausschlusstechniken, soziale Praxen, gesellschaftliche Strukturen, Machtstrukturen, Bio-Politik.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Michel Foucault Rassismus?
Foucault sieht Rassismus als ein Dispositiv der Macht, das in einer Normalisierungsgesellschaft zur Abgrenzung und zum Ausschluss von "Abweichungen" dient.
Was bedeutet "Biopolitik" in Bezug auf Rassismus?
Es ist eine Machtform, die auf das "Leben-machen" der eigenen Bevölkerung abzielt und den Tod der "Anderen" (Rassismus) als biologische Notwendigkeit rechtfertigt.
Was ist der Unterschied zwischen biologischem und kulturellem Rassismus?
Der biologische Rassismus nutzt physische Merkmale; der kulturelle Rassismus (Neo-Rassismus) nutzt die "Unvereinbarkeit von Kulturen" als Ausschlussgrund.
Warum wird Rassismus als "Normalität erzeugend" beschrieben?
Weil er festlegt, was als "normal" und zugehörig gilt, und dadurch Machtstrukturen im Alltag unsichtbar verankert.
Wie hängen Sonderschul-Überweisungen mit Rassismus zusammen?
Die Arbeit nutzt dies als Beispiel für institutionellen Rassismus, bei dem messende und regulierende Techniken Ungleichheit produzieren.
- Quote paper
- Moritz Ebenführer (Author), 2017, Die Rassismuskonzeption von Foucault. Ist Rassismus normal?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962445