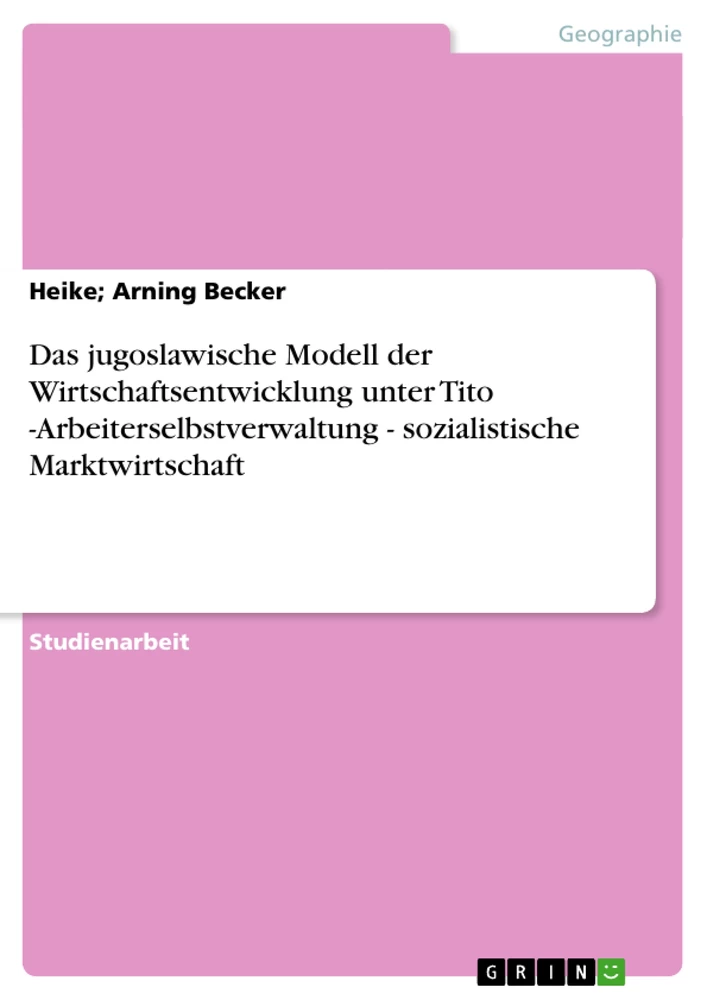Was, wenn ein Staat versucht, den Sozialismus neu zu definieren, indem er die Macht direkt den Arbeitern übergibt? Diese Frage steht im Zentrum einer fesselnden Analyse der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung unter Tito. Ab 1950 experimentierte Jugoslawien mit einem Wirtschaftsmodell, das die Prinzipien der sozialistischen Marktwirtschaft mit der direkten Kontrolle der Produktionsmittel durch die Arbeiter verbinden sollte. Ziel war es, die Entfremdung des Arbeiters, wie sie sowohl im Kapitalismus als auch in der sowjetischen Planwirtschaft beobachtet wurde, zu überwinden. Das Buch beleuchtet die ideologischen Grundlagen dieses einzigartigen Experiments, von der Loslösung von Moskau und der Kominform bis zur Verankerung der Selbstverwaltung in der Verfassung von 1974. Es werden die Funktionsweise und Organisation der Arbeiterselbstverwaltung detailliert beschrieben, von den "Grundorganisationen der frei vereinten Arbeit" bis hin zu den komplexen Planungsmechanismen, die den Unternehmen Autonomie gewährten. Doch das Buch scheut sich nicht, die Probleme und Kritikpunkte zu beleuchten: Bildungsmängel, die zur Dominanz von Managern führten, kurzfristiges Denken der Arbeiter, Ineffizienzen, Inflation und regionale Ungleichheiten. War die jugoslawische Arbeiterselbstverwaltung ein gescheitertes Experiment, das zu Überschuldung und regionalen Konflikten führte, oder bot sie wertvolle Einsichten für alternative Wirtschaftsmodelle? Eine umfassende Bilanz zieht die komplexen Fäden dieses faszinierenden Kapitels der Wirtschaftsgeschichte zusammen und bietet dem Leser eine differenzierte Perspektive auf die Herausforderungen und Widersprüche bei der Verwirklichung einer sozialistischen Marktwirtschaft mit Arbeiterselbstverwaltung. Das Buch ist ein Muss für alle, die sich für Wirtschaftsgeschichte, sozialistische Theorie und die Suche nach alternativen Wirtschaftsmodellen interessieren. Es wirft ein Schlaglicht auf ein vergessenes Experiment, das bis heute relevant ist und zum Nachdenken über die Zukunft der Arbeit und die Gestaltung von Wirtschaftssystemen anregt, die sowohl effizient als auch gerecht sind. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Arbeiter zu Unternehmern wurden, und entdecken Sie die Lehren, die wir aus Jugoslawiens einzigartigem Weg lernen können. Dieses Werk ist eine unentbehrliche Ressource für Studenten, Forscher und alle, die die komplexen Zusammenhänge zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verstehen wollen.
Gliederung :
1. Entwicklung der jugoslawischen Wirtschaft unter Tito :
- Einführung der Arbeiterselbstverwaltung ab 1950.
- 1963 Namensänderung FNRJ -> SFRJ
- erst ab 1965: "Jugoslawien erhält ein der Eigenverwaltung entsprechendes Gesicht"( Liebe)
- in der neuen Verfassung von 1974 rechtlich verankert
- davor fast jährlich Reformen (wichtigste: 1964/65 : Freigabe der Rohstoffpreise)
Grundlage und Voraussetzung für die Entwicklung der Arbeiterselbstverwaltung war der Kominformkonflikt 1948
Folgen : (1) Befreiung aus der Vormundschaft Moskaus
(2) Minimalste Wirtschaftsbeziehungen zu den sowjetsozialistischen Staaten
2. Ziel und Ideologie der Arbeiterselbstverwaltung bzw. sozialistischen Marktwirtschaft
"Die Fabriken den Arbeitern - die Leitung der Produktion den Produzenten "
- Man hatte erkannt das durch das Modell der sowjet. Planwirtschaft der Arbeiter genauso
von seiner Arbeit entfremdet wird wie im Kapitalismus ; Abhilfe durch Mitbestimmung
- jugoslawische Gesetzgeber:
"In frei vereinter Arbeit organisieren und erweitern die Werktätigen in den Unternehmen
auf der Grundlage gesellschaftlicher Mittel und Selbstverwaltung ständig Produktion, Umsatz und andere wirtschaftliche Tätigkeiten und befriedigen dabei ihr Einzel und gemeinschaftliches Interesse "
- "Delegation der Verantwortung von unten nach oben " (Gumpel) (entspr. Demokratie)
- 3. Grundprinzipien zum Aufbau des Sozialismus
(1) Der Prozeß des Absterbens des Staates kann nicht in die Zukunft verschoben
werden. Er soll sofort beginnen.
(2) Die KPJ muß sich vom Staatsapparat distanzieren, wenn sie nicht die
Wesensmerkmale einer Klassenpartei verlieren und Teil des Machtapparates werden will
(3) Das Staatseigentum muß Gesellschaftsbesitz werden und ist der Verwaltung der
unmittelbaren Produzenten, d.h. der Arbeiter zu übergeben.
=> Verknüpfung von Demokratie und Sozialismus
Übertragung des Prinzips der Arbeiterselbstverwaltung auf alle Bereiche des Staates führt zur "sozialistischen Marktwirtschaft"
3. Funktionsweise und Organisation, Struktur der Arbeiterselbstverwaltung
Funktionsweise
- Zur Verwirklichung des Kommunismus wird das Kollektiv dem Markt ausgesetzt um einen "Ü berflußan Waren zu erlangen, so daßdie Erzeugnisse des Massenverbrauchs nicht mehr ihren eigenen Wert besitzen" (vgl. Gumpel)
Voraussetzungen :
(1) Produktionsmittel und Konsumgüter müssen frei erwerbbar sein
(2) Gewinnmaximierung, d.h. der Arbeiter erhält die Möglichkeit sich ein möglichst hohes Einkommen zu sichern
(3) Existenz eines Arbeitsmarktes
(4) Gestaltung der Produktionspolitik (durch Produzenten) frei von staatlicher Bevormundung u.a.
- selbständige Aufteilung des erwirtschafteten Gewinns
- selbständige Außenwirtschaftsbeziehungen
Finanzierung:
- vor allem durch Eigenmittel der selbstverwalteten Wirtschaft und Krediten, die sich aber an Rentabilitätskriterien orientieren
- durch Ausländer (Beteiligung bis 49 % erlaubt)
Organisation & Struktur
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- "Grundorganisation der frei vereinten / assoziierten Arbeit" als Basisstruktur
- bei größerer Stärke Unterteilung in "ökonomische Einheiten"
- Zusammenschlüsse mehrere "Grundorganisationen der frei vereinten / assoziierten Arbeit" bilden Unternehmen
Rotationsprinzip :
-Wechsel des Arbeiter- und Verwaltungsratesrates alle zwei Jahre (jedes Jahr eine Hälfte)
- "Niemand kann in zwei aufeinanderfolgenden Perioden in den Arbeiterrat oder in dasselbe Vollzugsorgan gewählt werden " (Art. 102, Abs.3 der Verfassung)
Planung
"An die Stelle des allmächtigen Staates traten nun die selbständigen Unternehmen, die in einem vom Staat gesetzten Rahmen ihre Produktionspläne selbst erstellten" (Gumpel)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
- "Plan" wird als Richtlinie / "informelle Prognose" und nicht als verpflichtende Auflage aufgefaßt ; ist damit variabel und kann an geänderte Bedingungen angepaßt werden
4. Probleme und Kritik :
- Bildungsmangel der Arbeiter => Hervorhebung von Managern und Technokraten
- Arbeiter sind tendentiell an Gewinnausschüttung (= mehr Lohn) interessiert, statt an Investitionen
- oktroyierte Demokratie ; nicht von den Arbeiter erkämpft sonder von oben diktiert
- Konsumbürger ; gesättigter Markt
- negative Außenhandelsbilanzen
=> hohe Inflation ; Erhöhung der Lebenshaltungskosten um 15-18 % durchschnittlich "Es ist auf längere Zeit nicht tragbar, daß wir viel mehr verbrauchen, als wir produzieren. Wir müssen
uns damit abfinden, unbedingt Verbrauch und Produktion in ein richtiges Verhältnis zueinander zu bringen " Edvard Kordelj - slow. Sozialismustheoretiker 1971
- staatlich geförderte Kartell- und Monopolbildung obwohl dezentralisiert werden sollte
- Bindung der einzelnen Industriezweige an regionale Gegebenheiten
- Förderung schwach entwickelter Gebiete als Widerspruch zur Arbeiterselbstverwaltung
- Bürokratie und Koordinierungsprobleme
- Was kann man in einer Marktwirtschaft planen ???
5. Bilanz:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Fazit 1: Das Land lebte über seine Verhältnisse ; der erreichte Lebensstandard beruhte vor allem auf geliehenem Geld
Fazit 2: Es bildete sich trotz allem eine Technokratenschicht
Fazit 3: Das System trug nicht zur Einigung des Landes bei, es stärkte eher regionale Disparitäten
" ... Tito's decentralization had given it not one national economy but eight. None of the republics traded with each other."(Bondi)
Quellenangaben :
Literatur :
LIENAU , Cay : "Materalien zum HS Südosteuropa" , Münster 1997 ; GUMPEL, Werner : "Das Wirtschaftssystem" aus :GROTHUSEN, K.-D., Hrsg : "Südosteuropa-Handbuch : Jugoslawien" ; Vandenhoeck&Ruprecht ; Götingen ; HILDEBRANDT, Walter : "Die innenpolitische Abwendung vom Stalinismus nach dem Kominformkonflikt " aus :"Osteuropa-Handuch : Jugoslawien " Böhlau-Verlag 1954 ;
LIEBE, Klaus "6mal Jugoslawien, 1 mal Albanien" ; Piper&Co. Verlag, München ; EGER, Thomas : "Das regionale Entwicklungsgefälle in Jugoslawien" aus "Schriften der Gesamthochschule Paderborn, Reihe Wirtschaftswissenschaften ; Schöningh, München, 1980 ;
BÜSCHENFELD, Herbert : "Jugoslawien" ; Klett-Länderprofile ; SOERGEL, W. : "Arbeiterselbstverwaltung oder Managersozialismus", München 1979 ; Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim 1975 ; ROGGEMANN, Herwig ; "Das Modell der Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien" ; europ. Verlagsgesellschaft 1970 Internet :
http://www.xs4all.nl/%7etank/radikal/balkan ("Jugoslawien nach dem zweiten Weltkrieg" ; u.a. Texte zu Jugoslawien)
http://www.stud.uni..hann ( "Bundesrepublik Jugoslawien" ; Wirtschaftsinfos) http://lgm.fri.uni-lj/tito (Titos-Homepage)
http://wsvv.clas.virginia.edu/2rsbbc/yugos ("What is going on in (Ex-) Yugoslavia, Anyway ?! "; Zeitungsartkel aus Carlotteville,
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes?
Der Text behandelt die Entwicklung der jugoslawischen Wirtschaft unter Tito, insbesondere die Einführung und Funktionsweise der Arbeiterselbstverwaltung bzw. der sozialistischen Marktwirtschaft.
Wann wurde die Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien eingeführt?
Die Arbeiterselbstverwaltung wurde ab 1950 in Jugoslawien eingeführt.
Was war die Grundlage für die Entwicklung der Arbeiterselbstverwaltung?
Grundlage und Voraussetzung für die Entwicklung der Arbeiterselbstverwaltung war der Kominformkonflikt im Jahr 1948.
Was waren die Ziele und die Ideologie der Arbeiterselbstverwaltung?
Das Ziel war, die Fabriken den Arbeitern und die Leitung der Produktion den Produzenten zu übergeben, um eine Entfremdung der Arbeiter von ihrer Arbeit zu verhindern. Es ging um Mitbestimmung und die Delegation der Verantwortung von unten nach oben.
Wie funktionierte die Arbeiterselbstverwaltung?
Die Arbeiterselbstverwaltung basierte auf der Idee, dass das Kollektiv dem Markt ausgesetzt wird, um einen Überfluss an Waren zu erlangen. Wichtige Voraussetzungen waren die freie Erwerbbarkeit von Produktionsmitteln und Konsumgütern, Gewinnmaximierung, ein Arbeitsmarkt und die freie Gestaltung der Produktionspolitik ohne staatliche Bevormundung.
Wie war die Arbeiterselbstverwaltung organisiert?
Die Basisstruktur bildeten die "Grundorganisationen der frei vereinten / assoziierten Arbeit". Mehrere dieser Grundorganisationen bildeten Unternehmen. Es gab ein Rotationsprinzip für Arbeiter- und Verwaltungsräte.
Welche Probleme und Kritikpunkte gab es an der Arbeiterselbstverwaltung?
Es gab Probleme wie Bildungsmangel der Arbeiter, Tendenz zur Gewinnausschüttung statt Investitionen, oktroyierte Demokratie, Konsumbürgertum, negative Außenhandelsbilanzen, hohe Inflation, staatlich geförderte Kartell- und Monopolbildung, Bindung der Industriezweige an regionale Gegebenheiten, Bürokratie und Koordinierungsprobleme.
Was war die Bilanz der Arbeiterselbstverwaltung?
Die Bilanz zeigt, dass das Land über seine Verhältnisse lebte und der erreichte Lebensstandard hauptsächlich auf geliehenem Geld beruhte. Es bildete sich eine Technokratenschicht, und das System trug nicht zur Einigung des Landes bei, sondern verstärkte eher regionale Disparitäten.
Welche Quellen wurden für den Text verwendet?
Es wurden verschiedene Bücher und Internetquellen verwendet, darunter Werke von LIENAU, GUMPEL, HILDEBRANDT, LIEBE, EGER, BÜSCHENFELD, SOERGEL, ROGGEMANN sowie Artikel von Richard Bondi.
- Quote paper
- Heike; Arning Becker (Author), 1997, Das jugoslawische Modell der Wirtschaftsentwicklung unter Tito -Arbeiterselbstverwaltung - sozialistische Marktwirtschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96246