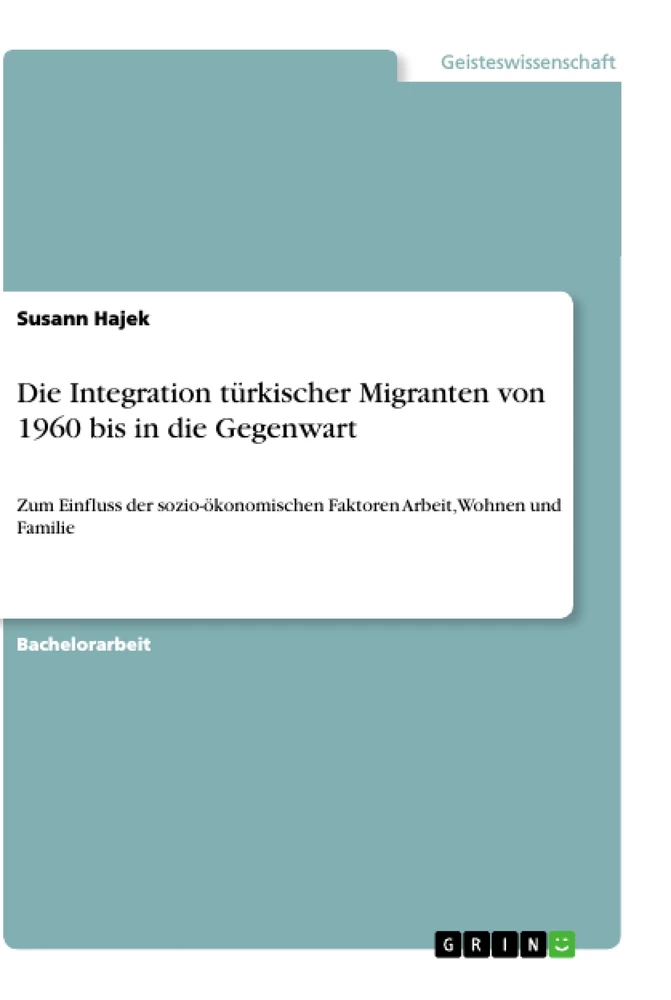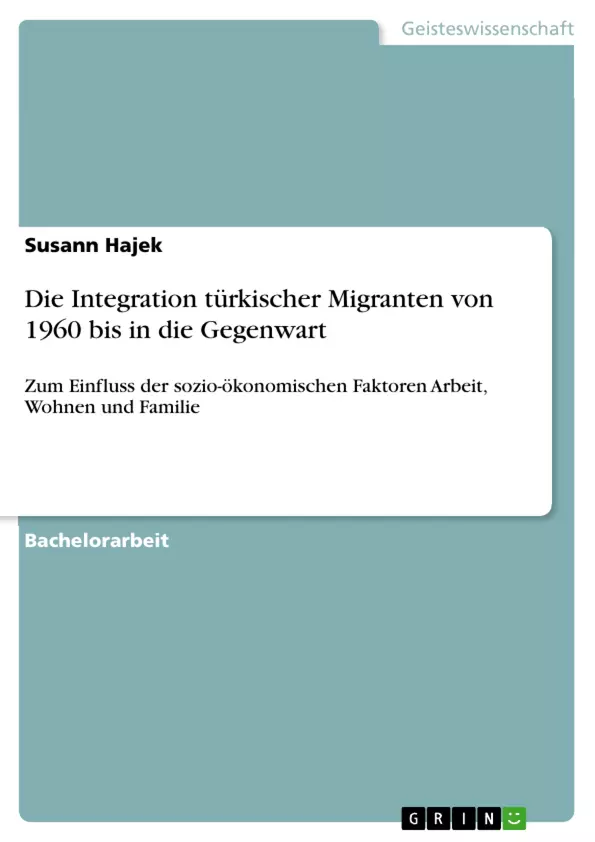Mit dem Anwerbevertrag im Jahr 1961 kamen die ersten „Gastarbeiter“ aus der Türkei. Die Arbeit beleuchtet ihre Wohn-, Arbeits- und Familiensituation und stellt heraus, ob ein Zusammenhang zwischen diesen sozioökonomischen Faktoren und der Integration in die deutsche Gesellschaft besteht. Die bis in die Gegenwart reichenden Schwierigkeiten und Herausforderungen für die deutsche Gesellschaft und die türkischen Migranten stehen im Mittelpunkt.
Das erste Kapitel beginnt mit einer geschichtlichen Übersicht, über die damaligen politischen Regelungen sowie gesellschaftlichen Zusammenhänge, vom Beginn der staatlichen Anwerbeverträge 1955 bis zum Rückkehrförderungsgesetz 1983, um die darauf folgenden Probleme und Ereignisse nachvollziehen zu können. Wie bereits beschrieben, beschäftigt sich diese Arbeit mit drei Faktoren – Arbeit, Wohnen und Familie – und der Frage, welchen Einfluss diese auf die Integration der türkischen „Gastarbeiter“ hatten: Der erste Teil der vorliegenden Arbeit stellt die Arbeitsbedingungen und -voraussetzungen der türkischen Migranten sowie ihr Verhältnis zu Arbeitgebern und Gewerkschaften dar. Im zweiten Teil wird die Wohnsituation der türkischen Migranten und die damit verbundenen Ängste der deutschen Gesellschaft und Probleme der türkischen Bewohner betrachtet.
Der dritte Teil beschäftigt sich mit den familiären und kulturellen Besonderheiten (soziale und gesellschaftliche Ausmaße) der türkischen Migranten, die in ihrer meist ländlichen Herkunft und den, im Vergleich zur deutschen Kultur, konträren Traditionen und Lebensweisen begründet liegen. Außerdem werden die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der ausländischen Kinder und Jugendlichen im Schul- und Ausbildungsbereich näher betrachtet. Der Bereich der Berufsausbildung wird nur am Rande beleuchtet, da sich dieses Kapitel der Arbeit vor allem auf den Komplex Schule konzentrieren soll. Der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsstellen betraf sowohl deutsche als auch ausländische Jugendliche, letztere jedoch durch verschiedenste Faktoren stärker. Da in der Schule der Grundstein für den weiteren Lebensweg gelegt wird, ist für diese Arbeit das Feld „Schule“ von größerer Bedeutung.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 ANFÄNGE EINES GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS
- 1.1 WIRTSCHAFTSSTABILISATOR – „GASTARBEITER“
- 1.2 POLITIK DER WIDERSPRÜCHE
- 2 ARBEITEN IN DEUTSCHLAND
- 2.1 ARBEITSBEDINGUNGEN
- 2.2 TÜRKISCHE ARBEITSMIGRANTEN UND Ihr VerhältnIS ZUM ARBEITGEBER
- 2.3 TÜRKISCHE ARBEITSMIGRANTEN UND DIE GEWERKSCHAFTEN
- 3 WOHNSITUATION UND WOHNPROBLEME IN DEUTSCHLAND
- 3.1 ERSTE BLEIBE: SAMMELUNTERKUNFT
- 3.2 ERSTE WOHNUNG: SANIERUNGSBEDÜRFTIGER ALTBAU
- 3.3 KONKRETE ZUSTÄNDE DER WOHNUNGEN
- 3.4 GEFAHR DER GETTOISIERUNG
- 3.5 DAS BEISPIEL BERLIN-KREUZBERG
- 4 DIE FAMILIE IN DEUTSCHLAND
- 4.1 KULTURELLE DISPARITÄTEN
- 4.2 BILDUNGSMODALITÄTEN DER ZWEITEN GENERATION
- 5 PARALLELGESELLSCHAFT ODER MISCHKULTUR – GEGENWÄRTIGE INTEGRATIONSBEDINGUNGEN
- 5.1 AKTUELLE BEISPIELE EINER ERFOLGREICHEN INTEGRATION
- 5.1.1 Gegenwärtige Bildungschancen für Jugendliche mit Migrationshintergrund
- 5.1.2 Cem Özdemir
- 5.1.3 Kaya Yanar
- 5.1.4 Feridun Zaimoglu
- 5.1.5 Fatih Akin
- 5.1.6 Selbsthilfe
- 5.1.7 Ümit Bayam - Stadtplanung in Berlin-Kreuzberg
- 5.1 AKTUELLE BEISPIELE EINER ERFOLGREICHEN INTEGRATION
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss sozio-ökonomischer Faktoren – Arbeit, Wohnen und Familie – auf die Integration türkischer Migranten in Deutschland von 1960 bis heute. Sie beleuchtet die Herausforderungen und Schwierigkeiten bei der Integration, die sowohl für die deutsche Gesellschaft als auch für die türkischen Migranten bestanden. Die Arbeit analysiert, wie Arbeitsbedingungen, Wohnverhältnisse und familiäre Strukturen die Integration beeinflusst haben und welche Rolle die Politik dabei gespielt hat.
- Die Arbeitsbedingungen türkischer Migranten in Deutschland und deren Verhältnis zu Arbeitgebern und Gewerkschaften.
- Die Wohnverhältnisse türkischer Migranten, von Sammelunterkünften bis hin zu Wohnproblemen und Ghettoisierung.
- Die Rolle der Familie und kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Integration.
- Die Entwicklung der Integrationsbedingungen von den Anfängen bis zur Gegenwart.
- Beispiele gelungener Integration türkischer Migranten in verschiedenen Bereichen.
Zusammenfassung der Kapitel
EINLEITUNG: Die Einleitung stellt anhand des Beispiels des Ehepaares Akdeniz den Kontext der Arbeit dar. Sie beschreibt die Motivation der türkischen Gastarbeiter, ihre Ankunft in Deutschland und die anfänglichen Hoffnungen und Herausforderungen. Die Einleitung skizziert die Problematik der Integration türkischer Migranten und die Zielsetzung der Arbeit, die sozioökonomischen Faktoren – Arbeit, Wohnen und Familie – im Hinblick auf die Integrationserfahrungen zu untersuchen.
1 ANFÄNGE EINES GESELLSCHAFTLICHEN WANDELS: Dieses Kapitel beschreibt den Beginn der Gastarbeiterwerbung in den 1950er und 1960er Jahren, den Hintergrund des Arbeitskräftemangels in Deutschland und die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Abkommen mit der Türkei. Es werden sowohl die Hoffnungen der Migranten als auch die widersprüchlichen Integrationspolitik der Bundesregierung analysiert.
2 ARBEITEN IN DEUTSCHLAND: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit den Arbeitsbedingungen, die türkische Migranten in Deutschland vorfanden. Es analysiert das Verhältnis der türkischen Arbeitsmigranten zu ihren Arbeitgebern und die Rolle, die Gewerkschaften bei der Integration und Vertretung der Interessen der türkischen Arbeiter spielten. Die Kapitel beleuchtet die Herausforderungen im Arbeitsmarkt und die Diskriminierungserfahrungen.
3 WOHNSITUATION UND WOHNPROBLEME IN DEUTSCHLAND: Dieses Kapitel untersucht die Wohnbedingungen türkischer Migranten, beginnend mit den ersten Unterkünften in Sammelunterkünften und prekären Wohnungen in Altbauten. Es beschreibt die konkreten Zustände der Wohnungen, die Gefahr der Ghettobildung und analysiert das Beispiel Berlin-Kreuzberg als Fallstudie für die Herausforderungen der Wohnungspolitik und ihre Auswirkungen auf die Integration.
4 DIE FAMILIE IN DEUTSCHLAND: Dieses Kapitel behandelt die Herausforderungen und Veränderungen, denen die Familien türkischer Migranten in Deutschland begegneten. Es analysiert die kulturellen Disparitäten zwischen den Kulturen und die Bildungschancen der zweiten Generation türkischer Migranten. Es wird untersucht, wie die familiäre Struktur und die kulturellen Werte die Integration beeinflussten.
5 PARALLELGESELLSCHAFT ODER MISCHKULTUR – GEGENWÄRTIGE INTEGRATIONSBEDINGUNGEN: Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Situation der Integration. Es analysiert die Entwicklung der Integrationsbedingungen und bietet Beispiele für gelungene Integrationen, um den vielschichtigen Prozess der Integration türkischer Migranten in Deutschland zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Türkische Migranten, Integration, Sozio-ökonomische Faktoren, Arbeit, Wohnen, Familie, Gastarbeiter, Deutschland, Migrationshintergrund, Ghettoisierung, Interkulturelle Beziehungen, Arbeitsbedingungen, Wohnverhältnisse, Bildung, Gleichberechtigung, Integrationspolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Integration Türkischer Migranten in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss sozio-ökonomischer Faktoren (Arbeit, Wohnen, Familie) auf die Integration türkischer Migranten in Deutschland von 1960 bis heute. Sie beleuchtet Herausforderungen und Schwierigkeiten der Integration für beide Seiten – die deutsche Gesellschaft und die türkischen Migranten – und analysiert den Einfluss von Arbeitsbedingungen, Wohnverhältnissen und familiären Strukturen sowie die Rolle der Politik.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Arbeitsbedingungen türkischer Migranten, ihr Verhältnis zu Arbeitgebern und Gewerkschaften, ihre Wohnverhältnisse (von Sammelunterkünften bis zu Ghettoisierung), die Rolle der Familie und kulturelle Unterschiede, die Entwicklung der Integrationsbedingungen und Beispiele gelungener Integration.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, fünf Hauptkapitel und ein Kapitel mit Schlüsselwörtern. Die Kapitel behandeln nacheinander die Anfänge des gesellschaftlichen Wandels mit der Gastarbeiterwerbung, die Arbeitssituation der türkischen Migranten, ihre Wohnsituation und -probleme, die Rolle der Familie und schließlich die gegenwärtigen Integrationsbedingungen mit Beispielen gelungener Integration.
Was wird in der Einleitung dargestellt?
Die Einleitung beschreibt anhand eines Beispiels den Kontext der Arbeit, die Motivation der türkischen Gastarbeiter, ihre Ankunft in Deutschland, anfängliche Hoffnungen und Herausforderungen sowie die Problematik der Integration und die Zielsetzung der Arbeit.
Was wird im Kapitel "Anfänge eines gesellschaftlichen Wandels" behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt den Beginn der Gastarbeiterwerbung, den Arbeitskräftemangel in Deutschland, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Abkommen mit der Türkei, die Hoffnungen der Migranten und die widersprüchliche Integrationspolitik der Bundesregierung.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Arbeiten in Deutschland"?
Dieses Kapitel analysiert detailliert die Arbeitsbedingungen türkischer Migranten, ihr Verhältnis zu Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie die Herausforderungen im Arbeitsmarkt und Diskriminierungserfahrungen.
Was ist der Inhalt des Kapitels "Wohnsituation und Wohnprobleme in Deutschland"?
Dieses Kapitel untersucht die Wohnbedingungen, von Sammelunterkünften bis zu prekären Wohnungen in Altbauten, beschreibt konkrete Zustände, die Gefahr der Ghettobildung und analysiert Berlin-Kreuzberg als Fallstudie.
Worum geht es im Kapitel "Die Familie in Deutschland"?
Dieses Kapitel behandelt Herausforderungen und Veränderungen für Familien türkischer Migranten, analysiert kulturelle Disparitäten und die Bildungschancen der zweiten Generation und den Einfluss familiärer Strukturen und kultureller Werte auf die Integration.
Was wird im Kapitel "Parallele Gesellschaft oder Mischkultur" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Situation der Integration, analysiert die Entwicklung der Integrationsbedingungen und zeigt Beispiele gelungener Integrationen in verschiedenen Bereichen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Türkische Migranten, Integration, Sozio-ökonomische Faktoren, Arbeit, Wohnen, Familie, Gastarbeiter, Deutschland, Migrationshintergrund, Ghettoisierung, Interkulturelle Beziehungen, Arbeitsbedingungen, Wohnverhältnisse, Bildung, Gleichberechtigung, Integrationspolitik.
- Arbeit zitieren
- Susann Hajek (Autor:in), 2010, Die Integration türkischer Migranten von 1960 bis in die Gegenwart, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/962489