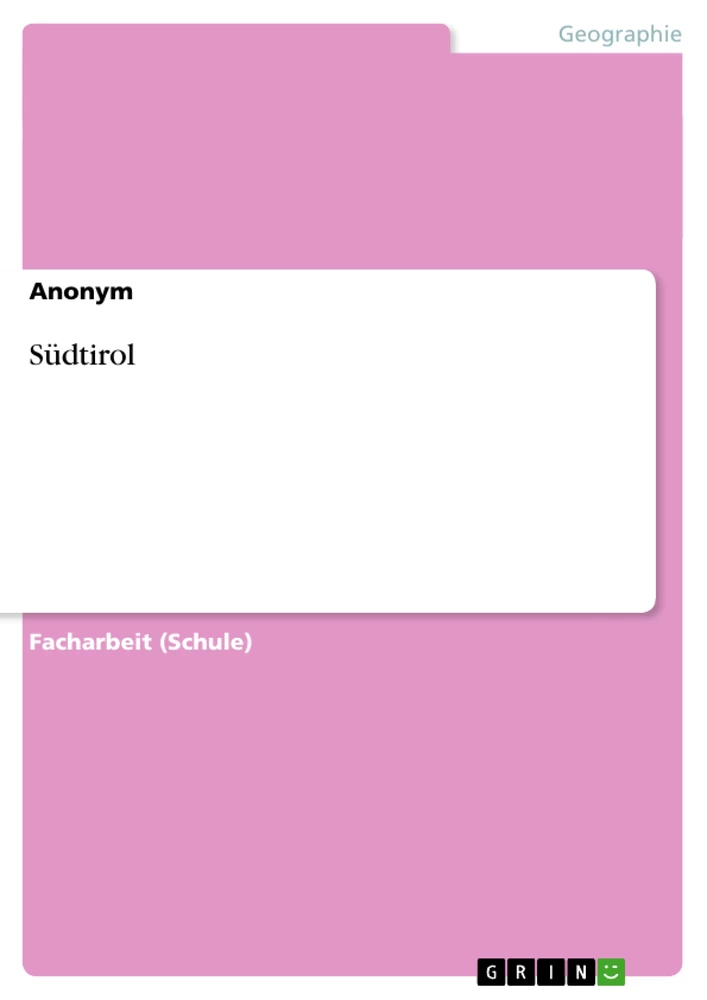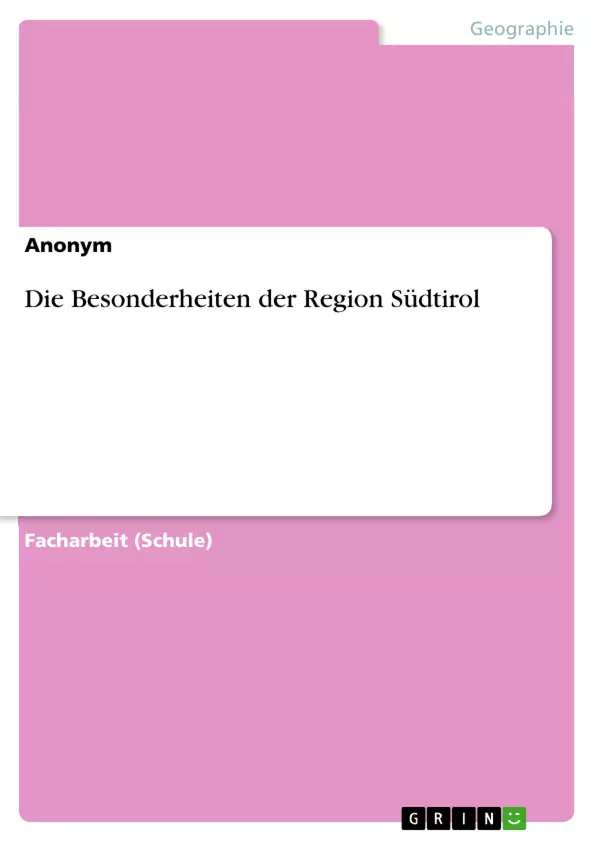Südtirol ist das ,,Land im Gepirg". Fast 2/3 der Fläche Südtirols liegen über 1500m hoch. Aber das ,,Land im Gepirg" zeigt sich in zwei verschiedenen Ansichten. Einmal ist das der Blick von den Tälern aus. Hier, in den breiten Talebenen und Talkesseln von Etsch, Eisack und Rienz schlägt das Wirtschaftliche Herz der Gegenwart. Hier liegen die Städte, haben sich die Industrien und die großen Landwirtschaftlichen Betriebe angesiedelt. Der andere Blick ist der von oben, von den Höhen und Bergen aus. Vom Talgrund der Etsch oder dem Eisack lässt sich die Weite der Hochgebirgslandschaft kaum erahnen. Was von unten wie eine Barierre wirkt, ist vielerorts eine Hochfläche, die von den Menschen seit Jahrhunderten besiedelt und kultiviert wird. Über Höhen und die flachen Sättel und Pässe liefen die Verbindungen der Vorzeit. Denn über die Berge waren die Wege viel kürzer als durch die düstren, gefährlichen Talschluchten oder durch die versumpften Talauen. Damals waren die Berge und Pässe nicht Hindernis, sondern verbindendes Element. Erst mit der Industrialisierung, als die neuen Straßen in den Tälern erbaut wurden, verloren die alten Höhenwege langsam ihre Bedeutung. Die Provinz Südtirol liegt am Südrand der Zentralalpen, die sich wie ein riesiger Klotz zwischen Mitteleuropa und Italien Schieben. Dieser Block aus Urgestein, der sich in Ötztaler, Stubaier und Zillertaler Alpen gliedert, hat aber Löcher und Durchgänge, die seit Jahrtausenden von den Menschen benutzt werden. Zu den niedrigsten und leichtesten Durchlässen gehört der Brenner und der Reschenpaß die noch heute zu Südtirols Pforten nach Norden gehören. Von Brenner führt das Tal des Eisack nach Süden zum Bozener Becken. Hier vereinigt sich der Fluß mit dem 2. Längsten Strom Italiens, dem Adige. Hinter Bozen führt das breite Etschtal durch das Unterland und stellt Südtirols offene Verbindung nach Süden da. Auch nach Osten gibt es einen breiten Durchlaß durch die Gebirgsbarrieren. Dieses dritte große Haupttal des Landes, das Pustertal, ist über die Flüsse Rienz und Drau mit dem Donauraum verbunden. Nur nach Westen türmen sich die Berge fast unüberwindlich auf. Hier thront auch der höchste Berg Südtirols der Ortler, mit der Höhe von 3905m. Neben den großen Flußtälern und den unwirtlichen Hochgebirgen besitzt Südtirol noch ein Zwischenstockwerk, die Zone der Mittelgebirgsterrassen.
Inhaltsverzeichnis
Die Landschaft
Steckbrief Südtirol
Landkarte Südtirol Klima
Die Bodennutzung
Brauchtum/ Uralte Bräuche
Wegbeschreibung
Wirtschaft - Wie sie ihr Geld verdienen/wie sie mit dem Tourismus auskommen
Geschichte
Drei Sprachen (Sonderstatus)
Literaturnachweis
Erklärung der eigenständigen Arbeit
Die Landschaft
Südtirol ist das ,,Land im Gepirg". Fast 2/3 der Fläche Südtirols liegen über 1500m hoch. Aber das ,,Land im Gepirg" zeigt sich in zwei verschiedenen Ansichten. Einmal ist das der Blick von den Tälern aus. Hier, in den breiten Talebenen und Talkesseln von Etsch, Eisack und Rienz schlägt das Wirtschaftliche Herz der Gegenwart. Hier liegen die Städte, haben sich die Industrien und die großen Landwirtschaftlichen Betriebe angesiedelt. Der andere Blick ist der von oben, von den Höhen und Bergen aus. Vom Talgrund der Etsch oder dem Eisack lässt sich die Weite der Hochgebirgslandschaft kaum erahnen. Was von unten wie eine Barierre wirkt, ist vielerorts eine Hochfläche, die von den Menschen seit Jahrhunderten besiedelt und kultiviert wird. Über Höhen und die flachen Sättel und Pässe liefen die Verbindungen der Vorzeit. Denn über die Berge waren die Wege viel kürzer als durch die düstren, gefährlichen Talschluchten oder durch die versumpften Talauen. Damals waren die Berge und Pässe nicht Hindernis, sondern verbindendes Element. Erst mit der Industrialisierung, als die neuen Straßen in den Tälern erbaut wurden, verloren die alten Höhenwege langsam ihre Bedeutung. Die Provinz Südtirol liegt am Südrand der Zentralalpen, die sich wie ein riesiger Klotz zwischen Mitteleuropa und Italien Schieben. Dieser Block aus Urgestein, der sich in Ötztaler, Stubaier und Zillertaler Alpen gliedert, hat aber Löcher und Durchgänge, die seit Jahrtausenden von den Menschen benutzt werden. Zu den niedrigsten und leichtesten Durchlässen gehört der Brenner und der Reschenpaß die noch heute zu Südtirols Pforten nach Norden gehören. Von Brenner führt das Tal des Eisack nach Süden zum Bozener Becken. Hier vereinigt sich der Fluß mit dem 2. Längsten Strom Italiens, dem Adige. Hinter Bozen führt das breite Etschtal durch das Unterland und stellt Südtirols offene Verbindung nach Süden da. Auch nach Osten gibt es einen breiten Durchlaß durch die Gebirgsbarrieren. Dieses dritte große Haupttal des Landes, das Pustertal, ist über die Flüsse Rienz und Drau mit dem Donauraum verbunden. Nur nach Westen türmen sich die Berge fast unüberwindlich auf. Hier thront auch der höchste Berg Südtirols der Ortler, mit der Höhe von 3905m. Neben den großen Flußtälern und den unwirtlichen Hochgebirgen besitzt Südtirol noch ein Zwischenstockwerk, die Zone der Mittelgebirgsterrassen. Vom Talgrund kaum zu erahnen, weiten sich die meisten Seitentäler ab 800 oder 1000m zu welligen Plateaus mit Wiesen, Feldern und Wäldern, zwischen denen unzählige Dörfer, Weiler und Höfegruppen eingebettet sind.
Steckbrief Südtirol
Fläche: 7400km², davon 14,1% bis 1000m Höhe, 21,5% zwischen 1000 und 1500m Höhe und 64,4% über1500m Höhe
Nutzungsarten: Landwirtschaftlich genutzte Fläche: 34,6%, Wald: 38,6%, Brachland: 3,8%, unproduktive Fläche 23,0%
Höchster Berg: Ortler (3905 m)
Provinzhauptstadt: Bozen mit 98 000 Einwohnern
Verwaltung: Südtirol ist mit der Provinz Trentino zur Region Trentino - Südtirol zusammengeschlossen. Die Provinz ist in 116 Gemeinden aufgeteilt.
Sprachen: Deutsch (67,99%), Italienisch (27,65%), Ladinisch (4,36%) Religion: 98% Katholiken
Beschäftigungszahlen: Landwirtschaft: 28 000 (14,5%), produzierendes Gewerbe: 43 600 (22,5%), Dienstleistung: 122 100 (63,0%)
Tourismus: Etwa 12 000 Beherbergungsbetriebe mit ca. 225 000 Gästebetten; rund 3,7 Mio. Touristen pro Jahr, davon rund 2 Mio. aus Deutschland.
Klima
Südtirol kann unerträglich heiß und bitter kalt sein. Das Klima ist von der Höhenlage abhängig. Die niedriggelegenen Talbecken von Bozen und Meran so wie Unterland und Überetsch unterliegen ganz dem Einfluß des Südens. Im August erreichen die Temperaturen in der Provinz - Hauptstadt leicht die 35°C und mehr. Im Winter sind Schneeflocken in Bozen und Meran eine Rarität. Die dunkle Jahreszeit kann so mild sein, das die Caféhaus - Besitzer die Terrassenstühle gar nicht wegräumen. Bereits im Februar blühen im Unterland die ersten Krokusse und Veilchen. Ganz anders sieht es in den höheren Lagen aus. Zwar macht sich auch hier die südliche Lage bemerkbar. Im Vergleich zur Nordseite des Alpenhauptkamms ist das Wetter in den Südtiroler Bergen bei weitem beständiger und sonniger. Sommerliche Kälteeinbrüche mit Regen und Schnee kommen durchaus vor. Allerdings dauern die in der Regel nicht allzu lang. Die Winter sind nicht mehr so hart, wie sie einst waren. Natürlich gibt es weiterhin wahre Kälte und Schneelöcher in Südtirol wie beispielsweise in Pustertal. In den letzen Jahren haben sich die schneearmen Winter gehäuft, und die Gletscher gehen auch in Südtirol immer weiter zurück. Ob dies mit der weltweiten Klimaveränderung zusammenhängt, darüber streiten sich die Wissenschaftler.
Die Bodennutzung
Südtirol ist alters her ein Bauernland. Obwohl die Wirtschaftskraft der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten stark zurück gegangen ist, lebt die Mehrheit der Bevölkerung bis heute in den Dörfern. Besonders in den breiten Talaue der Etsch haben sich in den letzten Jahrzehnten die riesigen Obstplantagen ausgedehnt, die in den Prospekten der Verkehrsämter so gerne als ,,Obstgärten" bezeichnet werden. Aber mit Bauerngärten haben diese Anlagen nichts mehr zu tun. Hier werden Äpfel, Birnen und andere Obstsorten nach den neusten agrarwissenschaftlichen Erkenntnissen nahezu industriell angepflanzt und geerntet. Der traditionelle Getreideanbau, früher für die eigene Versorgung sehr wichtig, ist in den meisten Tälern fast völlig verschwunden. Und auch die Weinanbauflächen nehmen von Jahr zu Jahr ab. Zwar sind die Hänge des Überetsch und der Talboden des Unterlandes noch über und über mit dem Rebstöcken überzogen, doch werden immer mehr Flächen mit Apfelbäumen bepflanzt, die mehr Gewinn versprechen. An geschützten Stellen des Bozener und Meraner Talkessels so wie im Unterland und Überetsch blühen Zitronenbäume und Oleanderbüsche, zwischen den Rebstöcken ragen schlanke Zypressen und wuchtige Edelkastanien empor, an den sonnengewärmten Felsen wachsen Feigenkaktus und Stechpalme.
Brauchtum
Südtirol ist ein festfreudiges Land. Im Sommer haben selbst die kleinsten Ortschaften ein Trachten - oder Volksfest zu bieten. Die bekanntesten Veranstaltungen im Jahreslauf sind: Am Ostermontag das Bauerngalopprennen auf Haflingerpferden in Meran; im April die Bozner Weinkost; im Mai/ Juni die Fronleichnamprozession; im Juli/ August die Freilichtspiele in Neumarkt und Lana; die Rittner Sommerspiele und die Kaltener Orgelkonzerte; im August das Lembenfest in Glums und das Altstadtfest in Brixen; im September der internationale Klavierwettbewerb um den Ferruccio - Preis in Bozen; die internationale Bozener Mustermesse und das Pferderennen um den ,,Großen Preis von Meran" auf der Rennbahn in Meran; von Oktober bis Mai Theater - und Konzertsaison in Bozen.
Uralte Bräuche
Alte Bräuche leben bis heute auch in Tramin fort, beim Egetmannszug am Faschingsdienstag. Das Fest geht schon auf vorrömische, heidnische Fruchtbarkeitsriten zurück, mit denen der Winter ausgetrieben und die Feldgötter gütig gestimmt wurden. Das Schauspiel um den Egetmann war im ganzen Etschtal verbreitet. Bis heute überlebte nur der farbige Umzug in Tramin der mit großem Aufwand an geschmückten Festwagen und polternden Maskengestalten jeweils alle zwei Jahre aufgeführt wird. Obwohl für den Touristengebrauch aufpoliert, verbreitet er noch etwas von der magisch - düsteren Faszination vergangener Zeiten - ganz ähnlich wie die monströsen Fabelwesen, die sich in der romanischen Rundapsis der Kirche St. Jakob in Kastellaz an den Wänden tummeln. Menschen mit Pferden -, Fisch - und Vogelleibern, Schlangen, Tierköpfe auf mißgestalteten Menschenleibern bedrohen, bekämpfen und beißen da einander, mit bösen, abstoßend entstellten Gesichtern. in Glums und das Altstadtfest in Brixen; im September der internationale Klavierwettbewerb um den Ferruccio - Preis in Bozen; die internationale Bozener Mustermesse und das Pferderennen um den ,,Großen Preis von Meran" auf der Rennbahn in Meran; von Oktober bis Mai Theater - und Konzertsaison in Bozen.
Wirtschaft
Südtirol ist eine Insel. Ökonomisch gesehen. Im Vergleich zu den meisten anderen Regionen Italiens und auch zu vielen vergleichbaren Ländern Europas, deren Wirtschaften von Arbeitslosigkeit, Absatzschwierigkeiten und Nullwachstum gekennzeichnet sind, geht es der Südtiroler Wirtschaft seit Jahrzehnten gut. Die wichtigsten ökonomischen Sektoren der Provinz - Fremdenverkehr, Landwirtschaft, der gesamte öffentliche Bereich, das Transportwesen - sind dank der engen Anbindung an den deutschen Markt und dank eines umfassenden Protektionismus nahezu konjunkturunabhängig. Das Wirtschaftliche Auf und Ab, das andere Staaten beutelt, scheint es in Südtirol nicht zu geben. In der Provinz gibt es knapp 200 000 Beschäftigte, die zu fast 2/3 im Dienstleistungsbereich arbeiten, also in der Verwaltung, im Gastgewerbe oder im Handel. Der Tourismus ist hierbei der wichtigste Arbeitgeber. Nahezu ¼ der Beschäftigten arbeiten direkt oder indirekt für den Fremdenverkehr. Auf die knapp 440 000 Südtiroler kommt die gewaltige Zahl von 225 000 Fremdenbetten, in denen etwa 3,7 Millionen Urlauber jedes Jahr rund 25 Millionen mal übernachten. Der Anteil der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe - in der Industrie und im Handwerk - beträgt ebenfalls ein knappes Viertel. Die meisten der Industriebetriebe gehören dem Baugewerbe an. Zukunftsorientierte Branchen wie die Elektronik oder die Chemie - und Kunststoffindustrie gibt es in Südtirol aber kaum. Die Beschäftigten - zahlen in der Landwirtschaft sind in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Gleichzeitig stieg jedoch der Grad der Mechanisierung und der Produktivität, so das die Provinz immer noch ein wichtiges Exportland für Landwirtschaftliche Produkte wie Obst und Wein ist. Während die Ertragslage für die Landwirtschaft in den Klimatisch begünstigten Tälern zufriedenstellend ist, müssen die Bergbauern auf ihren hochgelegenen Höfen mit den kargen, steilen Feldern und Wiesen wegen mangelnder Konkurrenzfähigkeit Jahr für Jahr weitere Einbußen in ihrem ohnehin schon schmalen Einkommen hinnehmen. Auch die Traditionell wichtige Holzwirtschaft steckt in der Krise. Billige Importe und eine sinkende Nachfrage haben die Wälder Wirtschaftlich unrentabel gemacht. Dennoch herrscht in der Provinz praktisch Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenrate ist im Vergleich zu anderen Landesteilen verschwindend gering und liegt der Zeit bei nur 2,2 %. Es gibt einen hohen Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften so wie an Saisonarbeitern, den der einheimische Arbeitsmarkt nicht mehr decken kann. In den Industriebetrieben, im Gastgewerbe und im Obstbau geht oder beschäftigte aus dem Ausland nichts mehr. Viele Fachkräfte kommen so aus anderen Regionen Italiens, aus dem Nachbarland Österreich oder aus EG - Staaten wie Deutschland oder den Niederlanden. Den Bedarf an billigen Saisonkräften decken die Menschen aus Nicht - EG - Ländern. Als Arbeitskräfte sind die Nordafrikaner und Osteuropäer gefragt, auf dem Wohnungsmarkt haben sie aber keine Chance. So leben die meistens von ihren in Wohn - Containern der Industriefirmen in behelfsmäßigen Unterkünften bei den Obstbauern und in Baracken - und Wohnwagensiedlungen am Rande der Industrie - und Gewerbegebiete.
Daten zur Geschichte
Von den ersten Siedlern zu den Rätern und Römern 0800-500 v. Chr.
Die Herkunft der ersten Siedler ist ungewiß. Neben nomadisierenden Stämmen sind es wohl Illyrer und Ligurer, die von Süden her das Land besiedeln und sich mit den später zuziehenden Kelten und Etruskern vermischen. Von den Römern in den Alpen siedelnden Völker Raeti, <Räter>, genannt.
25 v. Chr. - 550 n. Chr.
Das Land wird von den Römern erobert und in das Römische Reich eingegliedert. Es entstehen Römische Siedlungen und die bedeutende Kriegs- und Handelsstraße Via Claudia Augusta nach Norden über den Alpenhauptkamm. Die rätische Urbevölkerung wird romanisiert und später christianisiert. Es entwickelt sich die Mischkultur des Räoromanischen.
Völkerwanderung und frühes Mittelalter
550- 1000
Durch den Ansturm verschiedener Völker zerfällt das Römische Reich. Auf dem Gebiet des heutigen Südtirols treffen die Langobarden von Süden her auf die Franken im heutigen Vinschgau, während die von Norden vorrückenden Bajuwaren auf die durch das Pustertal eindringenden Slawen stoßen. Erbitterte Kämpfe um die Vorherrschaft mit wechselnden Ausgängen sind die Folge. Die Ansässige rätoromanische Bevölkerung wird germanisiert oder zieht sich in unzugängliche Täler zurück. Im 8. Jh. Wird das Land Teil des Karolingischen Reiches. Nach dem Tode Karl des Großen kommen Unterland und Überetsch zum Herzogtum Trient, während der letzte Teil des Landes dem Herzogtum Bayern, also dem entstehenden <Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation> zufällt.
Das Land Tirol
1000-1300
Um den Machtanspruch auf italienischen Territorien zu festigen und die Nord- Süd Verbindung über die Alpen zu sichern, errichteten die deutschen Kaiser an Eisack und Etsch geistliche Fürstentümer. 1027 erhält der Brixener Bischof an Eisack und Inn als Reichslehen, zu dem 1091 noch das Pustertal hinzukommt. Zum Fürstbistum Trient gehören ab 1027 neben dem Unterland und dem Überetsch auch Bozen und der Vinschgau. Die Bischöfe üben aber aus kirchenrechtlichen Gründen ihre weltweite Macht nicht aus, sonder geben sie in die Hand von Vögten. Diese gründen bald Adelsgeschlechter, wie die Grafen von Eppan oder die Grafen von Tirol, die danach trachten, ihre kleinen Herrschaftsgebiete zu vergrößern. In diesen teilweise blutig geführten Machtkämpfen setzen sich letztendlich die Grafen von Tirol durch.
1282
König Rudolf von Habsburg bestätigt den Anspruch des Tiroler Grafen Meinhard II auf das ,,Land an der Etsch und im Gepirg". Somit wird Tirol in den Rang eines souveränen Landes gehoben. Das Pustertal gehört allerdings zur Grafschaft Görz.
Tirol als Teil der habsburgischen Monarchie
1363
Die letzte Tiroler Regentin, Margarethe Maultasch übergibt die Regierungsgewalt an Herzog Rudolf IV von Habsburg. Von nun an ist Tirol Teil des österreichischen Habsburgerreiches.
1500-1516
Das Land gewinnt allmählich seine heutige Gestalt: Mit dem aussterben des Geschlechts der Görzer Grafen kommt das Pustertal zu Tirol, als folge des Krieges gegen Venedig vergrößert sich das Tiroler Territorium durch weite Teile des Trentinos.
1525/26
Gegen die zunehmende Unterdrückung durch Kirche und Landesherren erheben sich die Tiroler Bauern unter der Führung von Michael Geismair. Nach Anfangserfolgen wird der Aufstand blutig niedergeschlagen.
1600-1700
Die Zentren des politischen und wirtschaftlichen Geschehenes in Europa verlagern sich. Tirol ist nicht mehr wichtiges Bindeglied zwischen Nord und Süd, sondern gerät ins politische Abseits. Im Land kann die katholische Kirche uneingeschränkt die Macht ausüben und aufklärerische Gedankengut unterdrücken. Der Mythos vom ,,Heiligen Land Tirol" entsteht.
1701-1714
Erst der ,,Spanische Erbfolgekrieg" reißt Tirol in die gesamteuropäischen Auseinandersetzungen zurück. Die mit Frankreich verbündeten Bayern stoßen nach Tirol vor, wo sie von einer Tiroler Bauernarmee geschlagen werden.
1792-1810
Während der ,,Koalitionskriege" gegen das napoleonische Frankreich und das mit ihm verbündete Bayern kämpfen die kaisertreuen Tiroler Schützen auf seiten der habsburgischen Monarchie. 1805 muß Österreich nach der Niederlage bei Austerlitz Tirol an Bayern abtreten. 1809 kommt es zu einem erneuten Krieg, der für Österreich nach der Schlacht von Wagram wieder in einer Niederlage endet. Unter Andreas Hofer kämpfen die Tiroler allein weiter.
Nach anfänglichen Siegen werden sie werden sie in der vierten Schlacht am Berg Isel am 1. November 1809 vernichtend geschlagen. 1810 wird Hofer in Mantua standrechtlich erschossen. Als Folge der Niederlage wird das Land Tirol zwischen Bayern, Frankreich und Italien aufgeteilt.
1815
Nach der Niederlage Napoleons gegen die vereinigten europäischen Mächte erhält Österreich beim Wiener Kongreß Tirol wieder zugesprochen.
Südtirol als Teil Italiens
1915
Das zunächst neutrale Italien erklärt Österreich den Krieg. In den Dolomiten und am Ortler kommt es zu erbitterten Stellungskämpfen.
1919/20
Im Friedensvertrag von St - Germain muß Österreich die südlich des Alpenhauptkammes gelegene Gebiete, daß Trentino und das heutige Südtirol, an Italien abtreten. Aus dem neuen Territorien wird die italienische Provinz Venetia Tridentina gebildet.
1922
Nach der faschistischen Machtübernahme in Italien beginnt die zwangsweise Italisierung der deutschsprachigen Bevölkerung.
1927
Per Dekret wird die Provinz Bolzano (Bozen) geschaffen, in die aber die Gemeinden des Unterlandes und des Nonsberges sowie Altrei und Truden nicht einbezogen sind. Sie werden zur Provinz Trentino geschlagen.
1937
Hitler und Mussolini einigen sich in der ,,Berliner Vereinbarung" über die Aussiedlung der Südtiroler. In der ,,Option" entscheidet sich die übergroße Mehrheit der Bevölkerung, die Heimat zu verlassen. Der Zweite Weltkrieg verhindert die Abwanderung des größten Teils der Südtiroler.
1943
Nach der Kapitulation der italienischen Streitkräfte besetzen deutsche Truppen Südtirol. Als Teil der ,,Operationszone Alpenvorland" wird das Land unter Deutsche Verwaltung gestellt. Für die in Südtirol lebenden Juden bedeutet die nationalsozialistische Machtübernahme entweder die sofortige Flucht oder die Deportation in die Vernichtungslager. Widerstand gegen die Nazis wird nur von wenigen Südtirolern geleistet.
1946/48
Der ,,Pariser Vertrag" bestätigt den Verbleib Südtirols bei Italien. Allerdings wird der deutschsprachigen Bevölkerung in einem Autonomiestatut ein Minderheitenschutz zugesichert, der teilweise aber nicht verwirklicht wird. Zusammen mit dem Trentino bildet Südtirol innerhalb des italienischen Staatswesens die autonome Region ,,Trentino - Tiroler Etschland".
1957-72
In Südtirol kommt es unter der Losung ,,Los von Trient" zu zahlreichen Terroranschlägen von deutschnationalistischen Gruppen. In einem zweiten Autonomiestatut wird durch Maßnahmen des sogenannten ,,Pakets" die Selbstverwaltungsbefugnis der nunmehr ,,Autonomen Provinz Südtirol" gestärkt. Südtirol bildet aber weiterhin mit dem Trentino eine gemeinsame Region.
1992-93
Durch eine ,,Streitbeilegungserklärung" zwischen Österreich und Italien wird das Autonomiestatut für Südtirol völkerrechtlich verbindlich. Die letzen der im ,,Paket" vorgesehenen Maßnamen wie zum Beispiel die garantierte Zweisprachigkeit bei Gerichtsverhandlungen werden verwirklicht.
Drei Sprachen
In Südtirol werden offiziell drei Sprachen anerkannt: die deutsche (gesprochen von 287 503 Personen), die italienische (116 914 Personen) und die ladinische (18 434 Personen). Die Ladiner sind die Nachfahren der vorrömischen rätischen Ureinwohner des Landes, die von den Römern romanisiert worden waren.
Alle zehn Jahre müssen sich die Südtiroler ob sie wollen oder nicht, einer Volkszählung unterwerfen und sich einer dieser Sprachgruppen zugehörig erklären. Nach den Ergebnissen dieser Zählung wird in Südtirol vieles geregelt. Beispielsweise werden Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst, Kindergartenplätze oder Sozialwohnungen gemäß dem ,,ethnischen Proporz" quotiert: Für jede Sprachgruppe ist eine genau festgelegte Zahl reserviert. Sucht etwa die Stadtverwaltung Bozen drei Totengräber, müssen zwei von ihnen der deutschen und einer der italienischen Sprachgruppe angehören. Dieser Proporz, der allerdings stark Umschriften ist, wird als Mittel gesehen, alle Sprachgruppen in einem angemessenen Verhältnis am öffentlichen Dienst teilhaben zu lassen. Im Vergleich zu früheren Umfragen nimmt der italienischsprachige Bevölkerungsanteil ab. Viele Menschen der italienischsprachigen Bevölkerung fühlen sich an den Gesellschaftlichen Rand gedrängt. So gibt es bis Heute keine gemischtsprachigen staatlichen Kindergärten oder Schulen. Auch in den Kirchen werden die Gottesdienste in aller Regel fein säuberlich getrennt zu unterschiedlichen Zeiten in deutscher und italienischer Sprache gehalten.
Alle offiziellen Bekanntmachungen und die meisten Beschilderungen sind zweisprachig (in Deutsch und Italienisch). Nahezu alle Bewohner der ladinischen Täler in Südtirol beherrschen neben ihrer rätoromanischen Muttersprache auch Deutsch und Italienisch.
Literaturnachweis
Häufig gestellte Fragen
Was ist Südtirol?
Südtirol ist eine Provinz in Italien, die sich am Südrand der Zentralalpen befindet. Es ist bekannt für seine vielfältige Landschaft, die von hohen Bergen bis zu fruchtbaren Tälern reicht. Es ist auch eine Region mit einer reichen Geschichte und Kultur, in der Deutsch, Italienisch und Ladinisch gesprochen werden.
Wie groß ist Südtirol?
Die Fläche Südtirols beträgt 7400 km². Der Großteil der Fläche liegt über 1500 m Höhe.
Was sind die wichtigsten Wirtschaftszweige in Südtirol?
Die wichtigsten Wirtschaftszweige in Südtirol sind der Tourismus, die Landwirtschaft (insbesondere Obst- und Weinbau), das produzierende Gewerbe und der Dienstleistungssektor.
Welche Sprachen werden in Südtirol gesprochen?
In Südtirol werden offiziell drei Sprachen anerkannt: Deutsch (Mehrheitssprache), Italienisch und Ladinisch.
Wie ist das Klima in Südtirol?
Das Klima in Südtirol ist von der Höhenlage abhängig. In den tiefer gelegenen Talbecken ist es eher mild und mediterran, während es in den höheren Lagen kühler und alpiner ist.
Welche sind die größten Städte in Südtirol?
Die Provinzhauptstadt ist Bozen (Bolzano). Andere größere Städte sind Meran (Merano) und Brixen (Bressanone).
Was sind einige der traditionellen Bräuche in Südtirol?
Südtirol hat eine reiche Tradition an Bräuchen und Festen, darunter das Bauerngalopprennen in Meran, die Bozner Weinkost, Fronleichnamsprozessionen und der Egetmannszug in Tramin.
Wie ist die Geschichte Südtirols zusammengefasst?
Südtirols Geschichte ist geprägt von verschiedenen Einflüssen, von den Römern über das Mittelalter bis hin zur Habsburger Herrschaft. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Südtirol Italien zugesprochen. Heute genießt Südtirol eine weitgehende Autonomie.
Was sind die wichtigsten Flüsse in Südtirol?
Die wichtigsten Flüsse sind die Etsch (Adige), der Eisack (Isarco) und die Rienz (Rienza).
Welchen Sonderstatus haben die drei Sprachen in Südtirol?
Die Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe (Deutsch, Italienisch, Ladinisch) wird durch eine Volkszählung alle zehn Jahre festgestellt und beeinflusst die Verteilung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst, Kindergartenplätzen und Sozialwohnungen nach dem Prinzip des "ethnischen Proporz". Alle offiziellen Bekanntmachungen und Beschilderungen sind zweisprachig (Deutsch und Italienisch).
Wo finde ich weitere Informationen über Südtirol?
Im Text werden folgende Quellen genannt: Knaurs Kulturführer, Dumont Reiseführer und HB Atlas.
Wie ist die Bodennutzung in Südtirol?
Südtirol ist traditionell ein Bauernland. Es gibt einen bedeutenden Obst- und Weinbau, aber auch Waldflächen und unproduktive Flächen. Die Landwirtschaft hat sich von traditionellen Methoden hin zu industriellen Methoden entwickelt. Der traditionelle Getreideanbau ist fast verschwunden.
Wie ist der Arbeitsmarkt in Südtirol?
In Südtirol herrscht praktisch Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zu anderen Landesteilen verschwindend gering. Es gibt einen hohen Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften so wie an Saisonarbeitern.
- Quote paper
- Anonym (Author), 1998, Die Besonderheiten der Region Südtirol, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96265