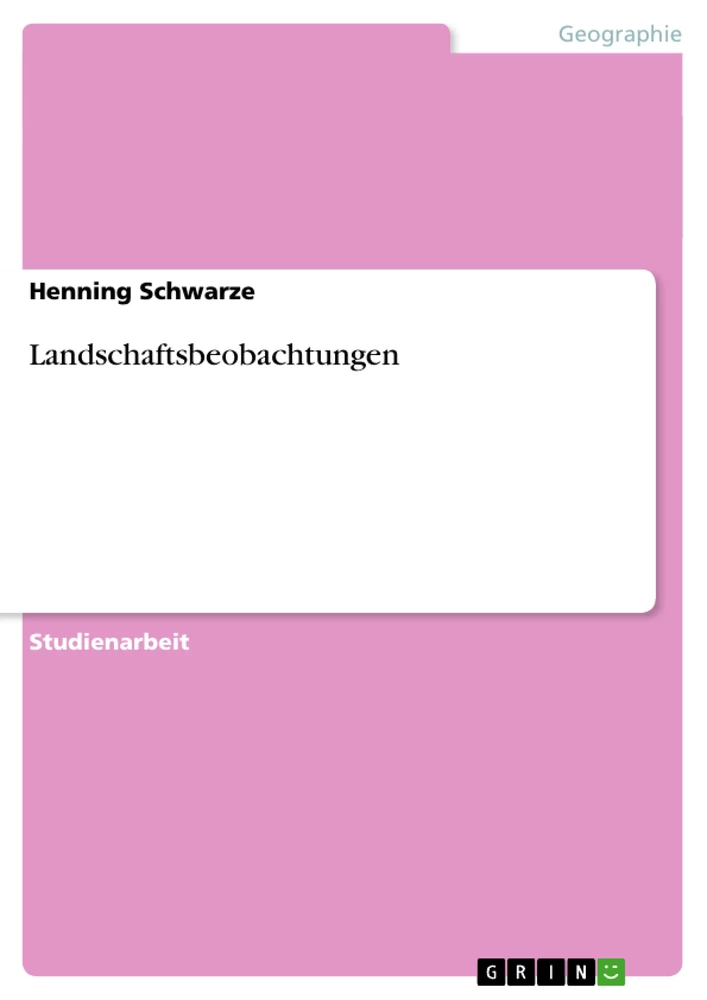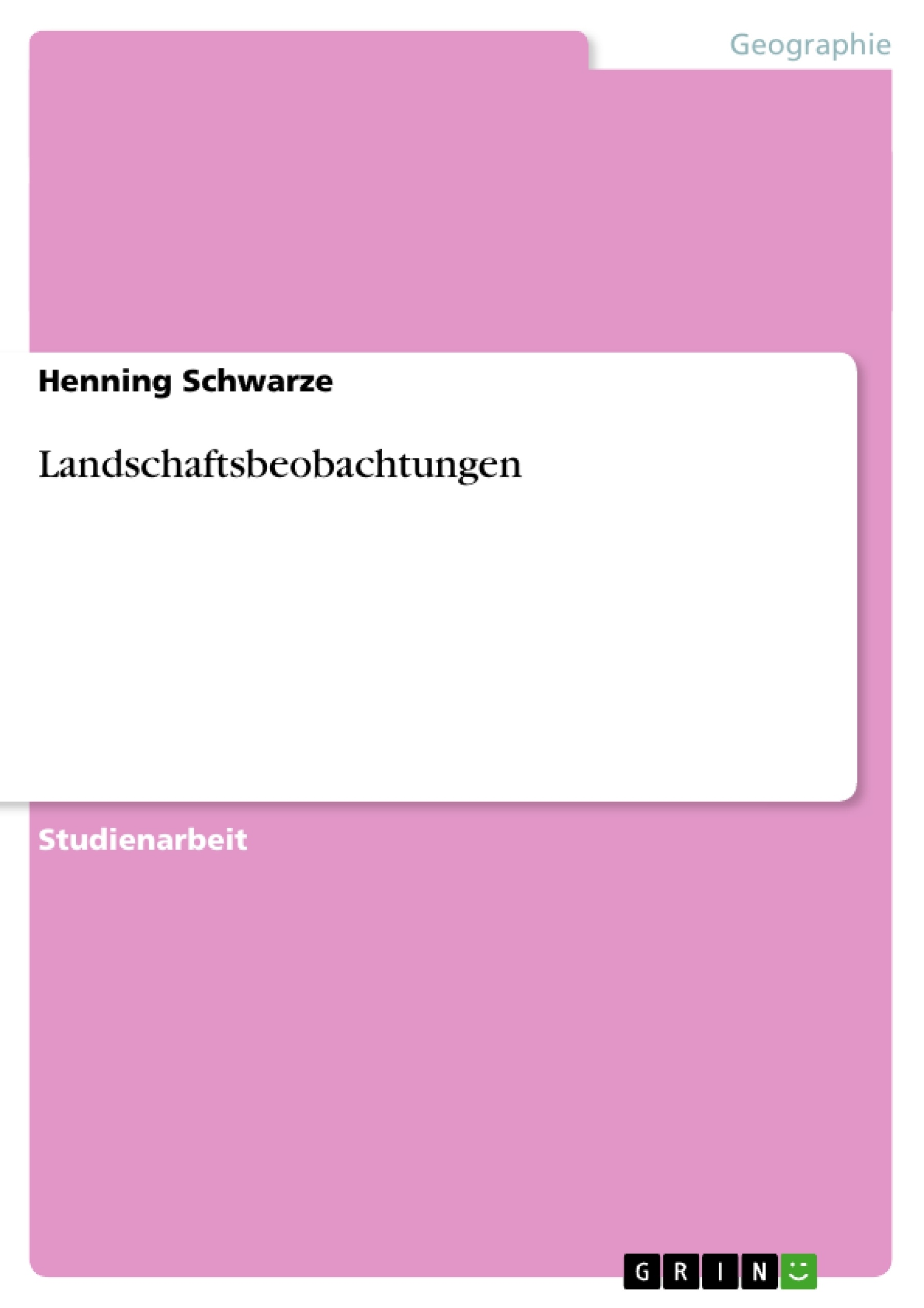INHALT
- Montag, 07.10.96 (Definition. - Marienloh und Umgebung)
- Dienstag, 08.11.96 (Schatenweg - Sennelandschat - Wasserwerk)
- Mittwoch, 09.10.96 (Ottilienquelle - Fischteiche - Padersee)
- Donnerstag, 10.10.97 (Paderborner Hochfläche - Ellerbachtal)
- Freitag, 11.10.97 (Die Stadt Paderborn - Der Dörenpark)
Montag, 7. Oktober 1996
1. Landschaftsbeobachtung allgemein
Unter Landschaft versteht man einen charakteristischen Ausschnitt der Erdoberfläche, welcher ein bestimmtes Erscheinungsbild wiederspiegelt (z.B. Spreewald). Es gibt Teile der Landschaft, welche in Wechselwirkung zueinander stehen, diese sind zum Beispiel Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre und Pedosphäre. Die erwähnten Teile der Landschaft unterliegen bestimmten Gesetzen und werden auch in starkem Maße durch den Menschen geprägt. Relief, Boden, Klima, Wasserhaushalt, Vegetation, Tierwelt und Mensch charakter - isieren einen bestimmten Landschaftstyp. Die Beobachtung der Landschaft nimmt in der Geographie einen hohen Stellenwert ein. Methoden der Landschaftsbeobachtung sind: - visuelle Aufnahme - Messungen - Zählungen - Befragungen - Quellenauswertung - Kartierung (Luftbildauswertung) - Labortechniken
2. Die Ortschaft Marienloh
I. Geschichte
Marienloh ist ein Stadtteil der Großstadt Paderborn, welcher sich an deren nördlicher Flanke befindet. Erstmals erwähnt wird Marienloh im Jahre 1036 und somit feierte man 1986 das 950 jährige Bestehen. Spuren der Besiedlung findet man jedoch schon aus der Steinzeit (8000-4000 Jahre vor Chr.), sowie aus der römischen Kaiserzeit (200-400 Jahre n. Chr.). Nach der Römerzeit wurde aus Marienloh eine Wüstung und man begann erst im 7. Jahrhundert mit der Neube - siedlung. Das Mittelalter über tat sich in Marienloh nichts. Erste Statistiken und Meßtischblätter über Marienloh gab es erstmals 1818, diese sind preußischen Offizieren zu verdanken. Von 270 Einwohnern 1818 hat sich die Zahl bis 1994 auf 3151 Einwohner erhöht. Die Gemarkung Marienloh umfaßt 760 ha. Diese verteilen sich wie folgt: 573 ha Acker und Wiesen, 50 ha Wald, 12 ha Gewässer und der Rest verteilt sich auf Sonstiges. Dieses Land erstreckt sich auf den Bereich der Senne, der Lippeniederung und der Marienloher Schotterebene. Bis zum Jahr 1969 war Marienloh selbstständig und wurde dann von Paderborn eingemeindet. Das Dorfbild von Marienloh ist durch einige Grünflächen aufgelockert, wobei eine 1856 vor der Kirche angepflanzte Blutbuche besonders auffällt. Die Kirche selber wurde 1848 erbaut. In der Nähe der Kirche befanden sich eine Jungenschule, diese wurde 1880 erbaut und eine Mädchenschule. An der Jungenschule wurde bis 1955 unterrichtet und an der Mädchenschule von 1913 bis 1955. Die beiden Gebäude dieser Einrichtungen sind auch heute noch vorhanden. Auch andere Gebäude, wie zum Beispiel ein 120 jahre altes Haus an der Detmolder Straße, sind heute Zeugen für die Geschichte Marienlohs.
II. Gewerbestrukturen
Zu Beginn war in Marienloh die Landwirtschaft tonangebend, noch 1939 war jeder zweite Marienloher in diesem Bereich tätig. Doch nach dem Krieg kam es, aufgrund neuer technischer Geräte und ertragsfördernder Düngemittel, zu einer Änderung der Erwerbsstruk - tur. Es spezialisierten sich Großbetriebe und Kleinbetriebe verschwanden. Als Beleg hierfür kann man sehen, daß es 1948 zum Beispiel noch 274 Schweine gab, während es 1993 5000 Stück waren. Des weiteren wurden früher Hackfrüchte zur Selbstversorgung angebaut, während es heute Mais (Futter), Raps, Gerste, Weizen und Roggen ist. Auch heute noch findet man landwirtschaftliche Nutzfläche in mitten des Ortskerns. Zur Versorgung findet der Bürger einen Supermarkt, ein Elektrogerätegeschäft, einen Bäcker, zwei Banken, eine Post und mehrere Gaststätten. Ein Betrieb hat sich auf die Fertigung von LKW - Planen spezialisiert und ist auch über die Grenzen Marienlohs bekannt. Seit 1996 findet man in Marienloh auch einen Zahnarzt. Was die Verkehrsanbindung betrifft, so gab es von 1906 bis 1965 eine Eisenbahnlinie von Paderborn nach Bad Lippspringe, mit einer Station in Marienloh, und von 1911 bis 1963 fuhr eine Straßenbahn von Paderborn über Marienloh, Lippspringe und Schlangen nach Horn. Reste dieser Einrichtungen lassen sich auch heute noch, in Form eines neu errichteten Fahrrad- und Fußgängerweges auf dem alten Streckenverlauf finden und wo der Bahnhof stand ist nun Brachland. Mit dem Bau der B1 neu kam es zu einer Entlastung der alten Bundesstr.1. Diese verläuft mitten durch den Ort und ist vor wenigen Jahren zurückgebaut worden. Trotzdem fahren täglich mehr als 12000 Autos durch Marienloh, in die Richtungen Paderborn und Detmold. Der jüngeren Bevölkerung Marienlohs stehen ein Kindergarten und eine Grundschule zur Ver- fügung. III. Die Beke
Die Beke ist ein Bach, der seinen Ursprung in der Nähe der Ortschaft Altenbeken hat. Er mündet, nach fließen in westliche Richtung, hinter Marienloh, in die Lippe. Aufgrund hoher Niederschläge und der Schneeschmelze in der Egge kam es in Marienloh immer wieder zu schweren Überschwemmungen, da sich der Bach dire kt durch den Ortskern schlängelte. Dieser Umstand führte dazu, daß nach der Einrichtung einer Kanalisation und der Eingemein - dung durch Paderborn (Finanzielle Mittel) beschlossen wurde, die Beke um die Ortschaft zu lenken. Man beließ sie lediglich dort, wo schon Brücken vorhanden waren. Im Verlauf dieser Verlegung wurde die Beke auch begradigt, ihr Querschnitt um 1,50 m vergrößert und die Flußsohle sowie die Böschung mit Betongrassteinen ausgelegt. Da man aufgrund der Begradigung mit einen Anstieg der Fließgeschwindigkeit rechnete, errichtete man auch acht Sohlabstürze zur Geschwindigkeitsreduzierung. Diese Eingriffe haben natürlich die Lebewesen im Bach im stärksten Maße beeinflußt. Des weiteren fallen auch kostspielige Arbeiten an, wie zum Beispiel das Ausbaggern des Flußbettes oder das Mähen der Böschungen. Diese Kosten trägt je nach Gewässer entweder die Gemeinde, der Kreis oder der Bund. Da natürlich auch in Marienloh immer wieder Land für neue Häuser erschlossen wird, kommt es zur neuen Versiegelung der Landschaft, womit auch der Oberflächenabfluß und somit dieWassermenge der Beke wieder ansteigt. Dies führt, bei starkem Niederschlag, wiederum zu massiven Schäden an den Böschungen, wenn der Bach in kurzer Zeit stark ansteigt. Ein weiteres Problem ergab sich durch die Einmündung in die Lippe, da sich diese im rechten Winkel vollzog und das gegenüberliegende Lippeufer stark beschädigt wurde. Aus diesem Grund verlegte man 1992 den Einmündungsbereich so, daß die Beke gleich in die Fließrichtung der Lippe geführt wird. Vorbei sind jedoch die Zeiten, wo noch sämtliche Abwässer der Häuser in die Beke eingeleitet wurden.
Dienstag, 8. Oktober 1996
1. Standort: Schatenweg
Der Schatenweg befindet sich in der Mitte der beiden Ortsteile Marienloh und Mastbruch. Er verläuft parallel zur Bundestr.1 und wird zum größten Teil als Fahrstrecke für Lkws genutzt, die Kies aus den angrenzenden Seen (Tallesee) abtransportieren. Wir befinden uns hier in der Lippelandschaft, welche sich, von der Steinzeit bis zur Bronzezeit, als eine Naturlandschaft darstellte. Danach gab es erste Veränderungen, im Wald wurde Vieh gehalten, man begann mit Ackerbau und die Römer fingen an, den Wald zu roden, um das Holz als Nutzholz zu verwenden. Im Mittelalter kam es dann zu großen Eingriffen in das Landschaftsbild. Die Naturlandschaft veränderte sich in eine Kulturlandschaft. Der Auenwald wurde vernichtet, die Tierwelt veränderte sich dramatisch, zum Beispiel das Mammut, der Waldelefant und der Auerochse verschwanden ganz. Man machte sich die Flüsse zu Nutze, Mühlen wurden errichtet und Korrekturen an den Flüssen vorgenommen, um sie befahrbar zu machen. Das 19. Jahrhundert kennzeichnete die Lippelandschaft vorallem durch wasserbauliche Maß - nahmen. Es wurden Schleusen und Kanäle errichtet, die Ufer befestigt und begradigt. Es voll - zog sich ein Wechsel, von der extensiven Nutzung der Landschaft, zu einer intensiven Nutzung. Heide - und Moorflächen verschwanden fast komplett, weitere Tierarten, wie zum Beispiel der Biber, wurden aus dem Landschaftsbild verdrängt.
2. Standort: Zaun der 2. Schutzzone des Wasserwerks PB
Auf dem Weg zu diesem Standort überquerten wir den Diebesweg. Hierbei stellten wir fest, daß es an dieser Straße keine Kanalisation gibt, was für die Stadt, den Kreis bzw. für das Land bedeutet, daß der Randbereich der Straße regelmäßig gemäht und alle 10 Jahre abgeschält werden muß, um den, durch Verkehr vergifteten, Boden zu entsorgen. Unsere weitere Aufmerksamkeit galt dem Paderborner Wasserwerk. Das Gelände an diesem Standort besteht aus Dünenresten, die ca. 12 m hoch anstehen. Früher entnahm man das Wasser direkt aus den Dünensanden. Um das Grundwasser anzureichern verwendete man Sickerbecken, in die man Lippewasser leitete. 1968 gab es die erste Tiefenbohrung. Heute gibt es neun Stellen, an denen man, in einer Tiefe von 200-380 m, im Kreidegestein (211-379m), das 5000 bis 6000 Jahre alte Tiefenwasser entnimmt.
Jährlich werden etwa 10 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert. Um das Wasserwerk herum gibt es drei Schutzzonen. Die Schutzzone 1 befindet sich unmittelbar um den Brunnen herum. Die 2. Schutzzone, auch 50 Tageslinie genannt, ist so weit vom Brunnen entfernt, daß eventuelle Verunreinigungen innerhalb dieser 50 Tage, bis zum erreichen des Brunnens, sich abgebaut haben. Die Schutzzone 3 umfaßt einen sehr großen Bereich, der bis an die Ortschaften Benhausen, Neuenbeken und die Paderborner Hochfläche reicht und sich nach dem Fließverhalten im Untergrund richtet.
Die Sennelandschaft
Bei der Betrachtung der Vegetation der Senne fällt auf, daß die Kiefer bestandsbildend ist. Desweiteren findet man ausgedehnte Erikaheideflächen durchsetzt mit Büschen, jungen Birken sowie vereinzelten Kiefern, außerdem die Traubenkirsche, Lerchen, Birken, Eichen und Kastanien. In der Senne findet man vorherschend Sandboden, welcher nur an der Oberfläche Humus aufweist. In der oberen Senne findet man trockene Kerbtäler, an die sich eine Zone mit Quelltälern anschließt, worauf die untere Senne folgt. Die Bachläufe in der unteren Senne sind stark verzweigt und schaffen sich ein eigenes Bett, das meist höher als die Umgebung liegt. Dieser Umstand hat zur Folge, daß Dämme errichtet werden müssen, um Schutz vor Überschwemmungen zu bieten. Diese soeben erwähnte Vegetation ist jedoch nicht die ursprüngliche Vegetation der Senne, diese war Wald, welcher zum größten Teil aus Birken und Eichen bestand. Um jedoch einen Nutzen für den Menschen aus der Senne zu ziehen, wurde Wald abgeholzt und als Nutzholz verbraucht und auf den entstandenen freien Flächen Heidekraut angepflanzt. Dieses Heidekraut wiederum diente als Nahrung für die Heidschnucke, welche vom Menschen gehalten wird. Um jedoch eine Übernutzung durch Heidekraut zu vermeiden, wurde die Kiefer angepflanzt, da sie sehr widerstandsfähig ist und auf dem Sandboden schnell gedeiht. Da die Kiefer sich gegenüber anderen Bäumen durchsetzte prägte sie schnell das Bild der Senne. Außerdem wurde die Kiefer auch als Nutzholz für den Bergbau, den Möbelbau und die Papierherstellung verwendet und in der Nähe von Bad Lippspringe pflanzte man sie als Schutz vor heranwehendem Sand aus der Senne an. Aus diesen Punkten läßt sich folgern, daß das heutige
Erscheinungsbild der Senne eine extreme Kulturlandschaft widerspiegelt. Ohne die Bearbeitung der Heideflächen durch den Menschen würde eine erneute Verwaldung der Senne einsetzen. Dieses wäre jedoch ein Umstand, welcher die jetzige Nutzung der Senne als Truppenübungsplatz beeinträchtigen würde. Die weitere Nutzung der Senne besteht im Anbau von Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren ( Sandboden ). Auch als
Naherholungsraum werden Teile der Senne genutzt. Auch Naturdenkmäler, wie Gewässer, Bäume, Findlinge und auch Hügelgräber der älteren Bronzezeit ( in Oesterholz - Haustenbeck ) sind in der Sennelandschaft zu finden. Erkundung des Dorfes Marienloh
1. Geographische / topographische Lage, Raum und Natur
Im Erdgradnetz findet man Marienloh bei 8°46` Ost und 51°47` Nord, dies ist westlich der Egge und an der Ostgrenze der Senne. Südlich grenzt es an die Lippeniederung und nördlich findet man den Teutoburger Wald. Das heißt, daß man in der nördlichen und östlichen Umgebung ein Mittelgebirge mit vornehm- lich Laubwald findet, während man nach Süden hin versiegeltes Land durch die Stadt Paderborn bestimme nd ist und sich die Senne als eine Kulturlandschaft mit starkem Kiefern und Heidebestand, sowie mehreren Bachläufen darstellt. Marienloh selber befindet sich auf einer ziemlich ebenen Fläche, welche von Ost nach West zur Lippeniederung leicht abfällt. An der südöstlichen Flanke wird Marienloh von dem Bach Beke geschnitten, welcher den
Ortsteil Klusheide vom überigen Ort trennt und im westlichen Verlauf in die Lippe mündet. Die Lippe umfließt Marienloh von Nordost aus Bad Lippspringe kommend an seiner westlichen Seite. Betrachtet man das Klima in dieser Gegend, so findet man Anhaltspunkte für ein maritimes sowie auch kontinentales Klima. Der jährliche Niederschlag liegt bei 800-900 mm . Geologisch gesehen findet man in Marienloh im Osten und Nordwesten Bach- und Flußablagerungen und Auenlehm des Holozän. Im Süden hingegen entdeckt man Windablagerungen und älteren Flugsand aus der Weichselkaltzeit. Die Vegetation besteht aus vielen Laub und Nadelbäumen, sowie mehreren kleinen Wäldchen mit Mischwald. Auch Auenflächen lassen sich an der Beke sowie der Lippe finden. Um die Ortschaft verteilt gibt es Ackerflächen auf denen Hackfrüchte und Getreide angebaut werden. Im Westen, zur Lippe hin, dominieren Flächen, welche zur Viehhaltung bestimmt sind. Schaut man sich die Verkehrssituation näher an, stellt man fest, daß der Ort von Paderborn Richtung Bad Lippspringe von der alten Bundesstraße 1 durchschnitten wird, welche mittlerweile zurückgebaut wurde. An dieser nun veränderten Strecke findet man gut ausgebaute Fußgänger- und Radwege. Marienloh hat auch Anbindung an die neue Bundestr.1, welche auch eine Verbindung zur Autobahn 33 hat.
2. Siedlungsgeographische Aspekte
In der Ortschaft Marienloh findet man noch heute Häuser, die vor der Jahrhundertwende erbaut wurden. Als Ortskern kann man die Umgebung der Kirche bezeichnen, diese wurde 1848 erbaut. In ihrer Nähe steht auch das ehemalige Schulgebäude von 1880. An der Detmolder Straße findet man auch noch ein 120 Jahre altes Fachwerkhaus, welches aber umgebaut wurde. Wenn man sich vom Ortskern in Richtung Lippe bewegt, entdeckt man noch weitere Fachwerkhäuser. Die heute noch erhaltenen Altbauten sind meistens gut erhalten, jedoch kommt es auch noch vor, daß man in letzter Zeit ein Fachwerkhaus abgerissen hat. Nach dem Krieg kam es zu einer enormen Vergrößerung Marienlohs. Hiervon zeugt zum Beispiel die Klusheide, wo sehr viele 1-2 geschoßige Häuser stehen, die in den fünfziger und sechziger Jahren erbaut wurden. Damals noch Brach gelassene Flächen zwischen den Häusern sind nun auch bebaut. In manchen der alten Häuser kann man auch Geschäfte entdecken, wie zum Beispiel einen Bäcker, einen Friseur, ein Installationsbetrieb oder eine Fahrradhandlung. Diese Geschäfte scheinen allerdings Familienbetriebe zu sein, die schon lange das Bild von Marienloh prägen. Neu erbaute Gebäude bieten dann auch Platz für einen Supermarkt, einen Zahnarzt, für Versicherungsagenturen, Banken und für ein Ingenieurbüro. In einem Altbau gibt es einen Computerladen, doch hier ist deutlich festzustellen, daß der Verkaufsraum ange - mietet ist. Als Stätten der Begegnung dienen die Kirche, das Gemeindehaus und die Schützen - halle und die Gaststätten.
3. Grün- und Freiflächen
Im Ortskern von Marienloh stehen noch einige sehr alte Bäume, wie zum Beispiel die 1856 vor der Kirche gepflanzte Blutbuche. Weiter alte Bäume stehen auf dem Friedhof und in der Umgebung der alten Schule. Gleichzeitig mit dem Rückbau der Detmolder Straße pflanzte man, parallel zum Straßenverlauf, eine hohe Anzahl junger Bäume. Die Beke, welche teilweise durch den Ort fließt, bietet, aufgrund der künstlichen Umleitung und der Uferbefest - igungen, keinen besonders natürlichen Eindruck.
4. Verkehrsflächen
Den zentralen Punkt bei der Beobachtung der Verkehrsflächen bildet die Detmolder Straße. Die alte Bundesstr.1, welche nach Süden Richtung Paderborn führt und nach Norden in Richtung Detmold, wurde vor wenigen Jahren zurückgebaut. Verkehrsinseln, Fuß- und Radwege wurden eingerichtet, sowie eine neue Teerdecke aufgezogen. An dieser Straße sind die meisten Geschäfte, viele Bushaltestellen und drei der vier Ampeln, die es in Marienloh gibt. Zur Trennung zwischen Autos und Fußgängern wurden Beete angelegt und Bäume gepflanzt. Täglich wird die Detmolder Straße etwa von 12000 Autos befahren. Die Nebenstraßen lassen sich in größere und kleinere unterscheiden. Eine der größeren Nebenstraßen kommt vom Diebesweg und endet in der Detmolder Straße. An ihr befindet sich die vierte Ampel und der Rest der Bushaltestellen. Die größeren Nebenstraßen unters cheiden sich von den kleineren durch eine intakte Teerdecke und das Vorhandensein von Gehsteigen. Dies ist bei den kleinen Straßen nicht die Regel.
5. Bevölkerung
Die Zahl der Bevölkerung hat sich seit 1818 (erste Angaben durch die Preußen) bis 1994 fast verzwölffacht und lag 1994 bei 3151.
Von diesen 3151 Personen sind 60% katholischer, 21% protestantischer und 19% anderer oder keiner Konfession. Ein gewisser Anteil der Bevölkerung besteht aus ausländischen Mitbürgern. So findet man in der Klusheide eine Reihe von Häusern wo Engländer wohnen und an der Detmolder Straße ist ein Ausländerheim. Da die meisten Geschäfte in Marienloh Familienbetriebe sind, ist anzunehmen, daß viele Einwohner in die umliegenden Städte pendeln, um dort einer Beschäftigung nachzugehen. Lediglich südlich der Klusheide gelegen, gibt es einen größeren Industriebetrieb, die Firma Weidmüller, aus dem benachbarten Kreis Lippe, welche einen Teil der Produktion und der Logistik nach Marienloh gelegt hat. Viele Anwohner jedoch müssen weite Fahrtstrecken in Kauf nehmen, zum Beispiel nach Paderborn, Detmold oder Bielefeld. Fünf bis sechs Familien haben die Landwirtschaft zu ihrem Beruf gemacht und weitere acht verdienen sich auf diesem Weg ein Beibrot. Problematisch ist es auch für die jüngere Generation in Marienloh. Es ist nur ein Kindergarten und eine Grundschule vorhanden. Für die Weiterbildung an einer Haupt- oder Realschule oder das Gymnasium müssen die Jugendlichen nach Bad Lippspringe oder Paderborn pendeln. Hierzu steht ihnen allerdings ein gute ausgebautes Nahverkehrsnetz zur Verfügung. Die PESAG unterhält eine Buslinie zwischen Paderborn und Marienloh und die Bundesbahn hat auf der Strecke Detmold-Horn-Schlangen-Lippspringe-Paderborn, vier Haltestellen in Marienloh eingerichtet. Seit August `96 fährt diese Linie im zwanzig Minutentakt. Fahrkarten für die Buslinien werden den Schülern kostenlos gestellt. Vor dreißig Jahren gab es auch noch eine Straßenbahn und eine Eisenbahnlinie. Wie es für ein kleines Dorf üblich ist, gibt es in Marienloh ein pulsierendes Vereinsleben. Man spielt erfolgreich Fußball, kann Volleyball und Badminton spielen. Die Kirchengemeinde hat eine Krabbelstube für die jüngsten eingerichtet, es gibt eine Jagdgenossenschaft und den örtlichen Schützenverein. Diesen Vereinen stehen als Einrichtungen die Schützenhalle, zwei Sportplätze und das Gemeindehaus zur Verfügung.
6. Landwirtschaft
Wie uns der Vorsteher der Marienloher Landwirte mitteilte, hat die Landwirtschaft in Marienloh die selbe Entwicklung hinter sich, wie sie überall zu beobachten ist. Viele kleine Betriebe verschwanden und es gibt nur noch ein paar spezialisierte Großbetriebe. Gründe für diese Entwicklung sind leistungsfähigere Maschinen und besseres Düngemittel. In Marienloh verhält es sich so, daß es früher 37 Vollerwerbsbetriebe gab, heute sind es nur noch 5 bis 6 und 8 Nebenerwerbsbetriebe. Die Vollerwerbsbetriebe haben zwischen 30 und 60 ha Land. Vieles hiervon wurde von den kleineren Betrieben gekauft. Um ihre Felder zu erreichen, müssen die Landwirte 2 bis 4 km weit fahren und teilweise noch weiter, falls sie Felder in Nachbargemeinden gepachtet haben. Beim Fruchtbau bauen sie Futtergras, Mais, Weizen, Raps und Gerste an. In Marienloh erfolgte eine Spezialisierung in den Bereichen Schweinemast, Milchkuhhaltung und Ackerbau. Außerdem haben sich zwei Betriebe auf die Haltung von Ebern und Säuen für den Zuchtbetrieb spezialisiert und sind in diesem Bereich über die Grenzen Marienlohs bekannt. Da heutzutage große und moderne Maschinen teuer sind, wird in Marienloh verstärkt mit dem Mittel der Nachbarschaftshilfe gearbeitet. Spezielle Arbeitsgänge wie das Säen und Spritzen werden teilweise von anderen Firmen erledigt. Da es sich in hier ausschließlich um Familienbetriebe handelt, werden während der Stoßze iten Leiharbeiter eingestellt. Ein großes Problem für die Landwirte mit Milchkuhhaltung stellt die EU dar und besonders in Marienloh macht den Bauern das Lippeauenprogramm zu schaffen, welches auf Bundesebene läuft. Durch dies Programm bekommen die Landwirte sehr hohe Auflagen, was zum Beispiel das Düngen oder die Verlegung von Dränage betrifft. Durch diese Maßnahme des Bundes sind die Preise der Landflächen um über die Hälfte im Wert gesunken.
Mittwoch, 9. Oktober 1996
1. Standort: Ottilienquelle
Die Ottilienquelle ist eine Mineralquelle, welche früher als Badequelle und als Quelle zur Heil - wassergewinnung genutzt wurde. Aus diesem Grund gründete man 1856 die Kuranstalt Inselbad. Bis 1965 füllte man dort das Mineralwasser der Quelle ab. Mineralwasser bedeutet, daß in der Summe mindestens 1000 mg gelöster Stoffe pro Liter im Wasser enthalten sein müssen. Bei unserer Untersuchung des Wassers stellten wir fest, daß sich ca. 1729 mg /l gelöste Stoffe im Wasser befinden, da die Leitfähigkeit des Wassers 2660 m s/cm beträgt ( 2660 x 0,65 ). Bei der Messung der Wassertemperatur erhielten wir einen Wert von 16° Celsius, was darauf hinweist, daß das Wasser aus einer enormen Tiefe an die Oberfläche gelangt, denn bei einer Quelle wo das Wasser normal an die Oberfläche tritt, hat es eine Temperatur, die ca. der Jahresmitteltemperatur des Standortes der Quelle entspricht. Noch heute ist die Ottilienquelle ein beliebtes Ausflugsziel und seit 1986 erinnert eine Schale, an der das Quellwasser an die Oberfläche tritt, an die damalige Nutzung dieser Quelle.
2. Standort: Fischteiche ( An den Fischteichen betrachteten wir mehrere Standorte )
1. Parkplatz am Restaurant "Fischteiche" An diesem Parkplatz findet man mehrere infrastrukturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Telefonzelle, eine Fußgängerampel und einen Parkplatz mit ca. 80 Stellplätzen und einem gesonderten Busparkplatz. Direkt an den Parkplatz schließt sich das Restaurant an, welches für die gehobene Mittelklasse bestimmt ist, es hat eine große Sitzplatzkapazität und einen Festsaal. Hinter dem Parkplatz erkennt man, daß dort beleuchtete Wege vorhanden sind und ein Trimmpfad.
2. Spielplatz neben dem Restaurant Dieser Abenteuerspielplatz ist sehr großzügig und aufwendig gestaltet. Man findet mehrere Spielgeräte aus Holz. Desweiteren befindet sich auf dem Spielplatz ein artesischer Brunnen aus dem Jahr 1963. Er ist 132 m tief und das Wasser ist ca. 16° C warm und seine Leitfähigkeit beträgt etwa 2600 m s/cm. Dieser Brunnen speist die anliegenden Fischteiche. Die Quellschüttung ist relativ hoch und das Wasser steigt durch seinen eigenen Druck an die Oberfläche.
3. Steg am ersten Teich Hier ist ein Steg angebracht, der es dem Besucher ermöglicht, möglichst nah an das Wasser heran zu treten und es genau zu beobachten. Für den Interessierten Besucher sind dort Hinweisschilder angebracht, was die verschiedenen Lebewesen in diesem Gebiet betrifft und wie sich der Mensch hier verhalten soll, damit er die Natur nicht zerstört.
4. Weggablung an den Fischteichen1 und 2 In diesem Bereich sind die Wege nicht mehr asphaltiert und es liegt nur noch ein Splittbelag vor. Man kann erkennen, daß die Ufer mit einem Geflecht befestigt sind (Faschine), um sie zum Beispiel vor Wellenschlag zu schützen. Es fällt auf, daß hier die Nutzung extensiver wird, das heißt die Umgebung wird naturnaher.
5. Weg um den 2. Fischteich An diesem Weg findet man einen ehemaligen artesischen Brunnen, der früher die Fischteiche speiste. Der Teich ist weitgehend mit Seerosen bedeckt. Die Wege sind weiterhin beleuchtet und es sind Bänke aufgestellt.
6. Weg um den 3. Fischteich Der dritte der Fischteiche ist weitgehend verlandet (Schilf). Hier ist die Umgebung sehr naturnah, was eine ökologische Nische für diverse Tiere darstellt. Am weiteren Verlauf des Weges ist ein Gedenkstein für den ehem. Bürgermeister Frankenberg aufgestellt, der Initiator für das Gebiet "Fischteiche" war.
7. Parkplatz am 5. Fischteich Dieser Teich ist wohl für die Besucher einer der interessantesten. An seinem Ufer befindet sich eine Hütte, an der man sich im Sommer Ruderboote mieten kann, um damit den See zu befahren. Da dieser Teich in der Reihe, der von der Quelle gespeisten Teiche der Letzte ist, ist seine Wassertemperatur auch am niedrigsten. Daher friert er auch am schnellsten zu und aus diesem Grund wird er im Winter, falls er genügend tief gefroren ist, zum Schlittschuh laufen freigegeben. Dies wird von der Stadt organisiert und manchmal findet sogar Eis laufen unter Flutlicht statt. Auf dem Eis des fünften Fischteiches finden bis zu 4000 Personen Platz. Des weiteren fällt auf, daß an diesem Teich eine ausreichende Ufer- und Wegbefestigung fehlt.
8. Freie Fläche am ehemaligen Paderborner Zoo Nachdem wir uns von den Fischteichen ein wenig in Süd westliche Richtung bewegt haben und hierbei die Bahnlinie Paderborn
- Bielefeld überquert haben, befinden wir uns nun in einem Waldstück. In diesem Wald war früher einmal der Paderborner Zoo. Auf der Karte erkennt man ein verzweigtes, regelmäßiges Wegenetz in diesem Waldstück, diese Wege sind heute jedoch ziemlich stark zugewachsen.
3. Standort: Padersee
Der Padersee entstand 1980, da Bodenmaterial für die Rerichtung des Nixdorf Wall ausgehoben wurde. Im See befinden sich Ein- und Ausfluß der Pader. Er ist 7,6 ha groß, die maximale Seelänge beträgt 450 m, die Breite 310 m und er ist drei bis vier Meter tief. Neben der Aufgabe als Naherholungsraum dient er auch als Wasserrückhaltebecken und ist Bestandteil des Hochwasserschutzes. Da die Pader, welche ja in der Innenstadt entspringt, viele Düngemittel der Paderborner Hochfläche, Schadstoffe und Schlamm mit sich führt, werden diese Stoffe im Padersee abgelagert, da ja die Fließgeschwindigkeit des Flusses verloren geht. Aus diesem Grund kommt es am Padersee unter anderem zur Eutrophierung, das heißt, es kommt zu einer Nährstoffanreicherung, welche sich vor allem in den Sommermonaten in einem vermehrten Algen- und Wasserpflanzenwachstum äußert. Da im See die Sedimente ebenfalls abgelagert werde, fließen sie auch nicht im Ablauf mit hinaus, die hat zur Folge, daß der Pader im weiteren Verlauf Sand, Steine und Kies fehlen, welche die Erosion der Gewässersohle wieder ausgleichen. Bei einer Untersuchung der Schwebfrachtablagerung der Pader im Padersee stellte man fest, daß jährlich 1700 Tonnen Material im See bleiben. Um den See als Naherholungsraum interessant zu machen, legte man an seinem Ufer ein Café, öffentliche Toiletten, befestigte Wege (zum Teil beleuchtet), Plattformen zum beobachten des Sees, mehrere Bänke und einen Spielplatz an. Am Ablauf des Padersees befindet sich auch eine Turbine zur Stromerzeugung. Bei der Erkundung der Vegetation am Padersee findet man angepflanzte Büsche, Sträucher, Bäume (Birke, Eiche, Fichte) und im Bereich des Einlaufs Schilfs.
Naherholungsgebiet Fischteiche - Padersee
Das von uns untersuchte Gebiet hat für die Stadt Paderborn eine relativ große Bedeutung hinsichtlich der Freizeitnutzung, zum einen ist es für viele Menschen ein attraktives Gebiet, aufgrund der Nähe zum Stadtrand und der guten Verkehrsanbindung ( B1, Nixdorf-Ring ), dies ist wichtig, berücksichtigt man, daß die Menschen in der heutigen Zeit immer weniger Freiraum für ihr Vergnügen haben, außerdem werden den Besuchern eine Reihe von Aktivitäten geboten ( Wandern, Joggen, Bootfahrten, Café, Spielplätze, Minigolf ). Auch geht in diesem Teil Paderborns der naturnahe Aspekt nicht verloren und interessierten Bürgen wird ein Einblick in verschiedenste ökologische Nischen geboten. Jedoch hat jede Sache auch seine Schattenseite. In diesem Stück Natur kommt es zu einer massiven Anhäufung von Menschen, welche das natürliche Gleichgewicht aus der Bahn bringen können. Es kommt zu einem enormen Verkehrsaufkommen, mit den Folgen von Abgasen, giftigen Stoffen und starker Lärmbelästigung. es muß ein Konsens zwischen der Nutzung des Naherholungsgebiets durch den Menschen und der Erhaltung des kostbaren Naturraumes geben. Hierbei würden eine noch höhere Zahl an Hinweisschilder, mit genauen Verhaltensregeln, und zum Beispiel organisierte Führungen helfen, um dem Besucher den Naturraum und seine Gefährdung durch den Menschen, noch näher bringen und ins Bewußtsein rücken. Der hohe Anspruch der Menschen an Freizeiteinrichtungen bringt viel Streß mit sich. Da es der Mensch oft sehr eilig hat, weil er möglichst viel erleben will, bleibt daher kaum Zeit für Entspannung, es kommt soweit, daß man nicht einmal mehr in Ruhe essen kann. So entsteht eine "Fast-Food" Gesellschaft, in der man weiteste Strecken mit dem Auto zurücklegt, um auch noch den letzten Winkel unberührter Natur zu erforschen. Der Trend in einer Zeit mit gestiegenem Freizeitanteil geht hin zu einer landschaftsbezogenen Erholung, wobei die natürliche Umgebung immer mehr verloren geht, da man dem Besucher Attraktionen bieten muß. Am Anfang dieser Entwicklung sind die Pflanzen- und Tierwelt die geschädigten, doch im Endeffekt sind wir es selber, die sich die eigene Umwelt zerstören. Ein Beleg hierfür ist, daß es in der BRD 2400 Naturschutzgebiete gibt ( davon 460 in NRW ), von denen 52% durch das Freizeitverhalten der Menschen belastet sind.
Donnerstag, 10. Oktober 1996
Wir haben unser Beobachtungsgebiet gewechselt, während wir uns bis jetzt im Ostmünsterland und deren Teillandschaft, dem Sennerand, aufhielten, befinden wir uns nun auf der Paderborner Hochfläche. Auf dem Weg zu unserem ersten Standort war das typische Erscheinungsbild der Paderborne r Hochfläche auffallend. Das Ansteigen der Landschaft, mit anschließendem Abfallen und Wiederanstieg, was sich bis auf den Kamm der Egge fortsetzt. Man bezeichnet die Paderborner Hochfläche auch als Schichtstufenlandschaft.
1. Standort: Steinbruch am Ortsrand von Grundsteinheim
In diesem Steinbruch kann man sehr gut den Kalkstein der Paderborner Hochfläche sehen, mit seinen unterschiedlichen Schichten und den zahlreichen Spalten und Rillen, in denen das Oberflächenwasser versickert. Wenn das Wasser dann, nach durchfließen von vielen Rillen und Spalten, schließlich auf die Mergelschicht trifft, tritt es, dort wo der Kalkstein endet, an der Oberfläche als Quelle wieder zu Tage. Durch das Auftreffen des Wassers auf die Mergelschicht verwittert diese jedoch und der Mergel wird an der Quelle in das Vorderland hinausgespült. Dies hat zur Folge, daß unter dem Kalkstein Hohlräume entstehen, über denen dann das Gestein (Kalk) abbricht und nachsackt. Dieser Vorgang setzt sich immer wieder fort und so frißt sich der das Gestein immer weiter zurück. Hierbei spricht man dann von "Rückschreitender Erosion". Von dem nachgebrochenen Gestein bleiben Reste übrig, die als Zeugenberge bezeichnet werden und diesen Vorgang dokumentieren.
2. Standort: Bach am Ortsrand von Grundsteinheim
An diesem Bachlauf treffen wir eine besondere Karsterscheinung der Paderborner Hochfläche an, eine Bachschwinde oder auch Schwalgloch genannt. Inmitten der Bachsohle ist ein Loch zu erkennen, in dem ein Großteil des Wassers verschwindet, also hinein läuft. Hierbei handelt es sich ebenfalls um Spalten im Untergrundgestein, also im Turon- und Cenoman - Kalkstein, wo sich das Wasser einen Weg durch die unterschiedlichsten Gänge sucht, bis es auf eine wasserundurchlässige Schicht trifft (Cenoman-Mergel). Nun bildet sich über dieser Schicht ein Karstwasserspiegel unter der Paderborner Hochfläche. Trifft dieser Karstwasserspiegel in Paderborn dann auf die Schicht des Emscher - Mergels, tritt das Wasser als Paderquelle an die Oberfläche. Diese Bachschwinde n, die man auf der Paderborner Hochfläche findet, werden häufig von den einheimischen Landwirten verstopft, da sie das Wasser der Bäche zum bewässern ihrer Felder nutzen wollen.
3. Standort: Acker auf der Hochfläche, zwischen Grundsteinheim und B64
Auch an diesem Standort kommt es zu einer typischen Karsterscheinung. inmitten des Ackers erkennt man eine Baumgruppe, wo man bei näherer Betrachtung feststellt, daß diese Baum - gruppe ein ziemlich rundes Loch, von 25 m Durchmesser und einer Tiefe von 10 m versteckt. Es handelt sich um eine sogenannte Lösungsdoline. Kalk an der Oberfläche des Gesteins wurde durch Niederschlag gelöst und im Laufe der Zeit entstand diese Hohlform, welche übrigens auch sehr steile Wände aufweist. Es gibt verschiedene Formen von Dolinen, zum Beispiel Einsturzdolinen, wo sich durch Ausspülung unter der Oberfläche ein Hohlraum gebildet hat und dieser dann irgendwann eingestürzt ist. Bei Ponordolinen fließt Wasser direkt in die Kalkschichten und höhlt diese Stück für Stück aus. Dolinen haben unterschiedliche Größen und können einen Durchmesser von 2-200 Metern erreichen und eine Tiefe von 2-300 Metern. Der chemische Vorgang bei der Lösung des Calciumcarbonates wird durch Kohlensäure unterstützt. CaCO3 + H2O + CO2 > Ca(HCO3)2 Die Kohlens äure besteht aus Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO)2, bei der Reaktion entsteht das wasserlösliche Calciumhydrogencarbonat Ca(HCO3)2.
Die Böden der Paderborner Hochfläche
Größtenteils besteht der Boden der Paderborner Hochfläche aus Braunerde, Braunerde
- Rendzina, Kalkstein, Kalkmergelstein und Mergel. Entlang der Bachläufe findet man Kolluvium, meist über Kalksteinverwitterungslehm, darunter Schotter, Mergelkalkstein und Kalkmergelstein. Am zweiten Rücken der Hochfläche gibt es Braunerde, zum Teil pseudo - vergleyt, aus Hottensteinschlufflehm, gelegen über Mergelkalkstein. An den Hängen und vereinzelt auch an Bachläufen liegt Rendzina, stellenweise pseudo - vergleyt, stellenweise aus Kalkstein und Kalkmergelgestein, vor. ( Quelle: Bodenkarte 1:50 000 ) 4. Standort: Das Ellerbachtal
Station 1: Wir befinden uns hier auf dem Weg südlich des Sommerberges. Nach Norden erstreckt sich die Paderborner Hochfläche, wo wir Ackerland sehen, auf dem Kalksteine verteilt liegen, welche vom Pflug eines Landwirtes an die Oberfläche befördert wurden, was darauf hinweist, daß das anstehende Gestein sich direkt unter der Oberfläche befindet. Nach Süden hin fällt die Fläche steil in ein Tal ab. Diese wird als Weideland für Vieh genutzt. Ein Problem hierbei ist, daß das Vieh auf der Weide mit Wasser versorgt werden muß, da der Niederschlag sofort versickert oder aufgrund des Gefälles den Hang hinunter fließt. Am Rand des Weges steht die typische Vegetation für kalkhaltigen Boden, Holunder, Brombeeren und Schleen.
Station 2: Süd-westlich von uns erstreckt sich das Haxthauser Holz. Dieses Stück des Waldes besteht aus einem stockwerkartig aufgebauten Buchenwald. Ein Stockwerk bezeichnen die Bäume (Buchen), mit einem dichten Kronendach, ein weiteres die Strauchschicht (Holunder) und letzteres die Krautschicht (Waldmeister).
Station 3: Am dritten Standort, mitten im Haxthauser Holz, fällt auf, daß sich ein Nutzungswandel vollzogen hat. Der natürliche Buchenwald ist verschwunden und stattdessen wachsen hier Ahorn- und Nadelbäume, also eine Forstkultur. Nadelbäume haben eine höhere Interzeption, d.h. sie können einen Teil des Niederschlags kurzzeitig zurückhalten, und somit bei starkem Niederschlag, ein sofortiges fließen des Wassers in den Ellerbach, verhindern.
Station 4: Von der letzten Station begehen wir den Waldweg am Erlengrund Richtung Station 4. Parallel zum Weg verlaufen ehemalige Hohlwege. Diese stammen aus dem
Mittelalter und laufen in ihrer Richtung auf den Hellweg zu. Es läßt sich erkennen, daß hier einmal mehrere Hohlwege verliefen. Grund dafür ist, daß durch den Menschen (Wagen), Regen und Schmelzwasser, also erosion, der Boden abgetragen wurde und sich ein Hohlweg immer mehr vertiefte. Zwangs - läufig mußte sich der Mensch einen neuen Weg "trampeln", wo sich dieser Vorgang wieder - holte. Der Verlauf des Erlengrund Wegs ist schlingenförmig, was auf Mäandrierung hinweist. Besonders auffallend ist, daß wenn man sich die Hänge rechts und links des Weges anschaut, sie anfangs symmetrisch sind und im weiteren Verlauf asymmetrisch werden.
Station 5: Wir haben nun das Ellerbachtal erreicht. Auffallend jedoch ist, daß man den Ellerbach vergeblich sucht. Dies ist aber normal, da der Ellerbach an Bachschwinden verschwunden ist und unterirdisch fließt. Nur nach starkem und anhaltenden Niederschlag verläuft der Bach oberflächlich. Deutlich ist im Verlauf des Tals die Mäandrierung mit Gleit- und Prallhang zu erkennen.
Station 6: An dieser Station hat man, nach der schweren Ellerbachflut von 1988, das Rückhaltebecken für den Ellerbach erbaut. Bei dieser Hochwassererscheinung wurden vorallem in Dahl zahlreiche Häuser (Keller) überflutet, die Kläranlage beschädigt, Brücken unterspült und der Naturhaushalt erheblich verändert. Nach lange anhaltenden Niederschlägen im Dezember 88, kam es am 18.u.19. Dezember zu extrem ergiebigen und kurzzeitigen Regengüssen. Da der Boden durch die vorherigen Regenfälle bereits gesättigt war, betrug der Oberflächenabfluß 90 Prozent. Die Konsequenz hieraus war starke Flächen- und Rillenerosion, die daraus resultierende Akkumulation und die erwähnten Hochwasserschäden. Das Rückhaltebecken soll verhindern, daß es in der Zukunft nochmals zu einem solchen Extremereignis kommt.
Auf dem Weg zu unserem Ausgangspunkt (Station 1) sieht man das Übe rlaufventil des Rückhaltebeckens, welches den Damm bei einer Flut entlasten soll.
Freitag, 11. Oktober 1996
1. Standort: An der Paderhalle
Wir befinden uns an der Paderhalle in Paderborn. Unmittelbar an dieser Stelle verlief die alte Stadtmauer, von der noch einige Reste zu sehen sind. Ebenfalls in der Nähe der Paderhalle kann man einige der Paderquellen entdecken. Auffallend ist, was wir auch im weiteren Verlauf der erkundung sehen werden, daß es eine Vielzahl von exotischen Bäumen in Paderborn gibt, wie zum Beispiel die Pyramidenpappel, die gemeine Platane, den gemeinen Trompetenbaum oder den Elefantenbaum. Alle diese erwähnten Baumarten haben eins gemeinsam, daß sie relativ wiederstandsfähig sind, was Umweltgifte angeht. Aus diesem Grund haben sie eine hohe Chance in der City zu überleben. An der Paderhalle finden wir auch zwei sehr große Parkplätze, welche für die Paderhalle, das Sportzentrum Maspernhalle und für die Innenstadt bestimmt sind. Es finden auf diesen Park - plätzen aber auch Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Zirkus, Kirmis, Messen, Beach - volleyball- und Streetsoccerturniere statt. Auch als Katastrophenplätze in Kriesenfällen stehen die Plätze zur verfügung. Angrenzend an den Parkplatz wurde eine mobile Meßstation des Landesumweltamtes aufgestellt. Mit ihrer Hilfe ermittelt man zum einen meterologische Parameter, wie Windrichtung und Geschwindigkeit sowie die Temperatur und die Luft wird auf Schwefel - dioxid, Kohlenmonoxyd, Stickstoffmonoxyd und auf die Ozonwerte hin untersucht. Mit diesen Werten kann man ein Immissionskartaster erstellen, welches bei der städtebaulichen Planung hilft, die Luftbelastung so gering wie möglich zu halten.
2. Standort: Paderquellgebiet
Im Paderquellgebiet gibt es, wie der Name schon sagt, eine Anhäufung der Paderquellen. Die Gesamtzahl der Quellen der Pader beläuft sich auf ca. 200, von denen die wenigsten mit Namen versehen sind. Nur ein Teil der Quellen läßt sich so gut unterscheiden, wie zum Beispiel die westlichen Quellen, Dammpader, Warme Pader (keine Karstquelle) und die Börnepader. Die bekannten östlichen Quellen sind die Rothobornpader (wurde 1036 gesegnet) und die Dielenpader. Die Quellen der Pader haben eine Quellschüttung von 3000-9000 Litern pro Sekunde, womit es die stärksten Quellen Deutschlands sind und es kommt noch hinzu, daß die Pader mit vier Kilometern der kürzeste Fluß Deutschlands ist. Von dem Zeitpunkt, wo das Oberflächenwas - sehr auf der Paderborner Hochfläche in den Klüffen versickert, braucht es 2-4 Tage, bis es die Quellen in Paderborn erreicht hat (200-400 m/h). Dieses Wasser erfüllte unterschiedlichste Aufgaben und war für Paderborn von großer Bedeutung. Man nutzte es als Trink-, Bade -, Wasch- und Löschwasser und es wurden verschiedene Mühlen für Getreide, Energie, Schmiede, Ölmühlen und Walkmühlen betrieben.
3. Standort: Der Geißelsche Garten
Dieser Garten, fast direkt in der City und unterhalb des Doms gelegen, war früher eine private Parkanlage. Man findet dort typische Bäume, Pflanzen und Tiere der Paderborner Hochfläche. Seine Funktionen liegen in der optimalen Sauerstofferhöhung und der Luftreinigung, sowie in der Funktion als Erholungsraum. Ähnliche Aufgaben übernehmen auch die Paderwiesen, der Riemekepark, Bepflanzungen an Verkehrswegen und Dach- und Fassadenbegrünungen. Desweiteren sorgen diese Grünflächen dafür, daß das Bild der ( Innen- ) Stadt nicht zu trist erscheint und es wird gleichzeitig aufgelockert.
4. Standort: Am Dom
Der Dom ist eines der imposantesten Gebäude in Paderborn und er ist ein Indiz für die Geschichte Paderborns. Gegründet wurde Paderborn 776 von Karl dem Großen. Es wurde ein Bistum, eine Burgstadt, mit 250x200 Quadratmetern Grundfläche. Die Besiedlung in Paderborn begann jedoch schon in der jüngeren Steinzeit. Im 9. Jahrhundert fand in der Nähe die Schlacht im Teutoburger Wald statt. Alte Handelswege, wie der Hellweg, verliefen hier. Im 11. Jahrhundert erbaute man den Dom und im 12. Jahrhundert wurde man Mitglied der Hanse, daher florierte der Handel und das Handwerk. 1614 gründete man in Paderborn die erste Universität Westfalens. Nachdem die Preußen ihre Schlacht gegen Frankreich verloren hatten, wurde Paderborn bis 1813 vom Bruder Napoleons regiert. Bis zum 19. Jahrhundert wuchs Paderborn nicht über die Stadtmauern hinaus. 1920 zählte man 20000 Einwohner und bis zum 2. Weltkrieg hin war es eine reine Verwaltungsstadt. Erst danach vollzog sich ein Wechsel zur Industrie- und Gewerbestadt. Neue Impulse wurden 1952 mit der Gründung der Universität Gesamthochschule, der katholischen
Fachhochschule, der theologischen Fakultät und in jüngerer Zeit mit der Gründung einer Fachhochschule der Wirtschaft gesetzt.
Einkaufszentrum Dörenpark
Aufgrund wechselndem Einkaufsverhalten der Kunden hat sich in den letzten Jahren , in den Städten, der Trend zur Einrichtung von Einkaufszentren durchgesetzt. Auch an Paderborn ging diese Entwicklung nicht vorbei und wir können große und kleine Einkaufszentren finden. Die Aufgabe uns erer Gruppe war es, den Dörenpark, gelegen am östlichen Rand Paderborns, Richtung Benhausen, zu untersuchen. Wir hatten die Aufgaben das gesamte Zentrum nach Art der Geschäfte, Geschoßhöhen, Größe, Verkehrsanbindung und Parkplätzen zu kartieren, die Geschäfte nach Bedarfsgruppen und Angebot zu gliedern und eine Befragung des Kunden - stammes nach ihrem Einkaufsverhaltens durchzuführen.
Untersuchung zum Kundenstamm des Dörenparks am 11.Oktober 1996
Bei der Untersuchung des Kundenstammes, begannen wir zuerst mit einer Zählung, der auf den Parkplätzen untergebrachten Fahrzeuge. Hierbei unterschieden wir auch noch, die Herkunft der Fahrzeuge, nach Nummernschildern. Die Parkplätze, bzw. das Parkhaus am Dörenpark, haben ein Stellvermögen von 600 Fahrzeugen. Bei der ersten Zählung um 12:30 Uhr, zählten wir 111 Fahrzeuge, die sich, auf die in der folgenden Grafik zu erkennenden Kreise aufteilten: Herkunft ( Kennzeichen ) Anzahl Autos
PB 87 LIP 4 HX 11 BI 2 GT 1 KS 1 KB 1 HOL 1 LSZ 1 MK 1 England 1
Bei der zweiten Zählung, um 14:00 Uhr, wurden 130 Fahrzeuge gezählt, und das Bild hatte sich wie folgt verändert:
Herkunft ( Kennzeichen ) Anzahl Autos PB 103 LIP 7 HX 9 England 4 BI 2 KS 1 KB 1 HOL 1 MK 1 GT 1
( Bei jeder Zählung waren noch jeweils ein Fahrzeug aus den Kreisen Korbach, Lausitz, Holstein, Gütersloh, Kassel und dem Märkischen Kreis anwesend. )
Es läßt sich erkennen, daß bei der zweiten, Zählung mehr PKWs vorhanden waren, als bei der ersten, dies läßt darauf schließen , daß viele der Fahrzeughalter am Freitag, bereits Mittags Feierabend gehabt haben. Bei den Fahrzeugen, aus den Kreisen, wo nur ein PKW zu finden war, kann man annehmen, daß die Halter, nicht zum Stammkundenkreis des Dörenparks gehören, sondern entweder aus beruflichen so wie familiären Gründen dort parken, oder in Paderborn ihren zweiten Wohnsitz haben. Klar zu erkennen ist, daß die meisten Besucher aus dem Kreis Paderborn kommen, aber auch die nahegelegenen Kreise Lippe und Höxter, den Dörenpark als Einkaufsziel nutzen. Die Zahl der britischen Fahrzeuge läßt sich mit der nahegelegenen Karserne und der daraus resultierenden, britischen Siedlung begründen.
Befragung von Kunden des Dörenparks
Bei der Befragung, von 19 Kunden des Dörenparks, haben wir auf einem Fragebogen nach der Altersklasse und dem Geschlecht, dem benutzten Verkehrsmittel zum erreichen des Parks, der Herkunft, dem Besuchsmotiv und nach eventueller Kritik und Vorschlägen der Kunden gefragt.
Bei den Altersgruppen, sowie der Geschlechteraufteilung, bekamen wir folgendes Ergebnis:
Alter Frauen über 60 1 über 50 1 über 40 1 über 30 6 über 20 5 Alter Männer jünger als 20 3 über 60 2
Wie man aus diesen Grafiken erkennt, ist der Anteil der Frauen, welche im Dörenpark einkaufen, wesentlich höher, als der der Männer. Bei den Frauen überwiegt der Anteil an jüngeren Frauen, da diese eventuell noch während der Woche berufstätig sind und daher den Freitagmittag zum einkaufen nutzen, während ältere Frauen auch an den übrigen Wochentagen, Zeit zum einkaufen haben. Bei den Männern fällt auf, daß sie entweder unter zwanzig, beziehungsweise über sechzig Jahre alt sind. Hieraus kann man den Schluß ziehen, daß es sich, bei den jüngeren Männern, wahrscheinlich um ledige Personen handelt, und daß die älteren Männer wohl meistens Rentner sind.
Herkunft der befragten Personen Paderborn 13 Marienloh 2 Schlangen 2 Benhausen 2
Den größten Anteil der Besucher bildeten Personen aus Paderborn, die auch meistens direkt aus der City kamen. Gleichmäßig der Anteil von Personen aus den Dörfern Benhausen, Marienloh und Schlangen. Das gerade diese Ortschaften zum Einzugsbereich des Dörenparks gehören, läßt sich aus der sehr guten Verkehrsanbindung erklären. Aus dem, von den drei Orten am weitesten entfernten, Schlangen, benötigt man höchstens zehn Minuten, mit dem PKW, bis zum Dörenpark. Außerdem sind es drei kleine Orte, wo man Geschäfte dieser Größenordnung nicht findet und wo ein Möbelhaus, wie zum Beispiel Koch oder eine Aldifiliale, nicht vorhanden sind.
Der größte Teil, der befragten Personen, zeigte sich mit dem Dörenpark sehr zufrieden, zum einen, was das Angebot an Geschäften betrifft, sowie die große Anzahl an Parkplätzen. Das einzige, was von wenigen Personen bemängelt wurde, war das Fehlen eines Schlachters. Was noch auffällig war, war daß die meisten Personen, zum Einkauf im Aldi gekommen waren, um dort Lebensmittel zu besorgen. Nach diesem Besuch wollten dann einige, der Befragten, noch andere Geschäfte besuchen, zum Beispiel mit den Kindern in das Spielzeuggeschäft oder nach neuen Möbeln gucken.
"Freie Tankstelle" Benhausen
Die Tankstelle in Benhausen ist eine sehr kleine Tankstelle. Es gibt an ihr nur die gängigen Kraftstoffsorten zu kaufen und verschiedene Sorten Motoröle. Andere Gebrauchsgegenstände können dort nicht erworben werden. Die Kundschaft besteht zum größten Teil aus Stammkunden, welche auch meistens in Benhausen ihren Wohnsitz haben. Wichtig ist diese Tankstelle für die in Benhausen ansässigen Landwirte, da sie nicht mit ihren Traktoren bis nach Paderborn oder Bad Lippspringe fahren müssen. Aufgrund fehlenden Angebots stellt diese Tankstelle keine Konkurenz zu anderen Geschäften in Benhausen dar.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Einblick in Landschaftsbeobachtungen und Ortsanalysen, speziell in und um Paderborn, Deutschland. Es beinhaltet Beobachtungen, Analysen und Studien zu verschiedenen Standorten, Gewerbestrukturen, geografischen Aspekten, Siedlungsgeografie, Grünflächen, Verkehrsflächen, Bevölkerung und Landwirtschaft.
Welche Orte werden in diesem Dokument untersucht?
Das Dokument untersucht primär Marienloh, die Sennelandschaft, die Paderborner Hochfläche, das Ellerbachtal, Paderborn selbst (inklusive Paderquellgebiet und Dörenpark) sowie weitere umliegende Orte und Gebiete.
Was sind die Hauptthemen der Landschaftsbeobachtung?
Die Hauptthemen umfassen die Definition von Landschaft, die Wechselwirkung zwischen Atmosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre und Pedosphäre, den Einfluss des Menschen, sowie die Charakterisierung von Landschaftstypen durch Relief, Boden, Klima, Wasserhaushalt, Vegetation, Tierwelt und den Menschen selbst. Es werden auch Methoden der Landschaftsbeobachtung wie visuelle Aufnahme, Messungen, Zählungen, Befragungen, Quellenauswertung, Kartierung und Labortechniken behandelt.
Welche Aspekte von Marienloh werden detailliert beschrieben?
Die Geschichte von Marienloh, die Gewerbestrukturen (von Landwirtschaft bis zu modernen Betrieben), die Veränderung der Beke (Bach) durch Kanalisierung und Begradigung, die Verkehrsanbindung und die Infrastruktur werden detailliert beschrieben.
Was sind die Besonderheiten der Sennelandschaft, die in dem Dokument hervorgehoben werden?
Es werden die vorherrschende Kiefernvegetation, Heideflächen, Sandböden, das militärische Übungsgelände, die landwirtschaftliche Nutzung für Kartoffeln, Spargel und Erdbeeren sowie die Bedeutung als Naherholungsraum hervorgehoben. Die Veränderung von ursprünglichem Wald zu einer Kulturlandschaft durch menschlichen Einfluss wird betont.
Welche Karsterscheinungen werden auf der Paderborner Hochfläche beschrieben?
Es werden Steinbrüche, Bachschwinden (Schwalgloch), Lösungsdolinen, die Böden der Hochfläche (Braunerde, Rendzina) und das Ellerbachtal mit seinen geologischen und hydrologischen Besonderheiten beschrieben.
Was wird über das Paderquellgebiet und die Stadt Paderborn erläutert?
Es werden die Paderquellen, ihre Bedeutung für Paderborn (Trinkwasser, Energiegewinnung), der Geißelsche Garten als Erholungsraum, die Geschichte Paderborns (von Karl dem Großen bis zur modernen Universitätsstadt) sowie die Entwicklung von Einkaufszentren wie dem Dörenpark erläutert.
Welche Informationen liefert die Analyse des Dörenparks?
Die Analyse umfasst die Herkunft der Kunden (Kennzeichenanalyse), die Alters- und Geschlechterstruktur der Kunden, die Besuchsmotive, die Zufriedenheit mit dem Angebot und die Verkehrsanbindung. Es wird auch auf das Fehlen bestimmter Geschäfte (z.B. Schlachter) hingewiesen.
Was sind die wichtigsten ökologischen Aspekte, die in dem Dokument angesprochen werden?
Die Auswirkungen der menschlichen Eingriffe auf die Natur, die Notwendigkeit des Hochwasserschutzes, die Eutrophierung des Padersees, die Bedeutung von Grünflächen für die Luftqualität und die Belastung von Naturschutzgebieten durch Freizeitverhalten werden thematisiert.
- Quote paper
- Henning Schwarze (Author), 1995, Landschaftsbeobachtungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96268