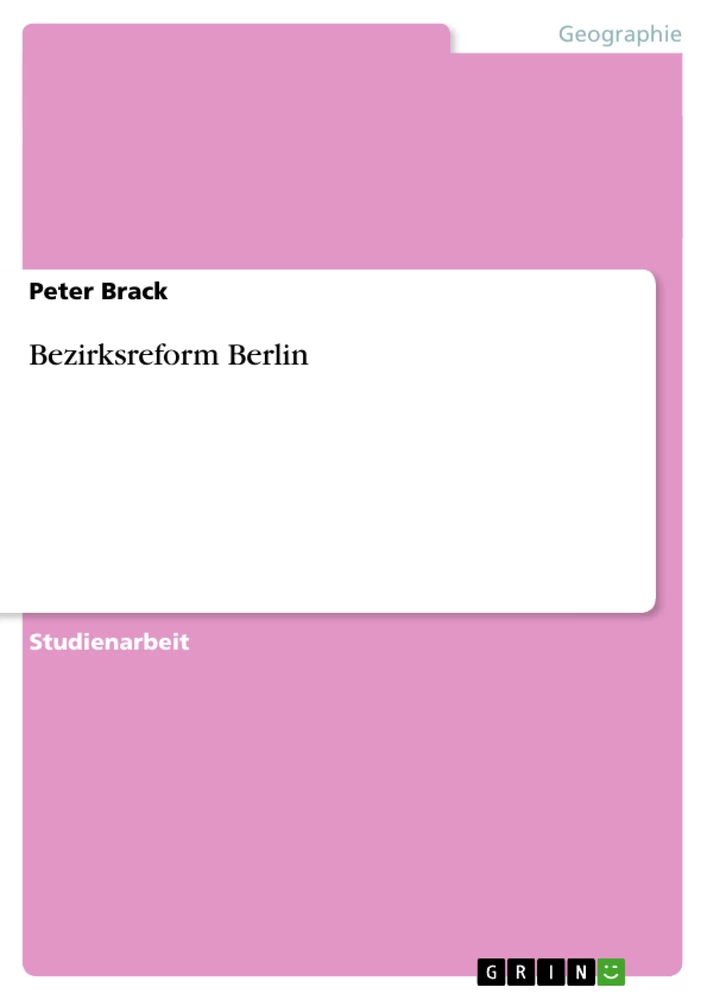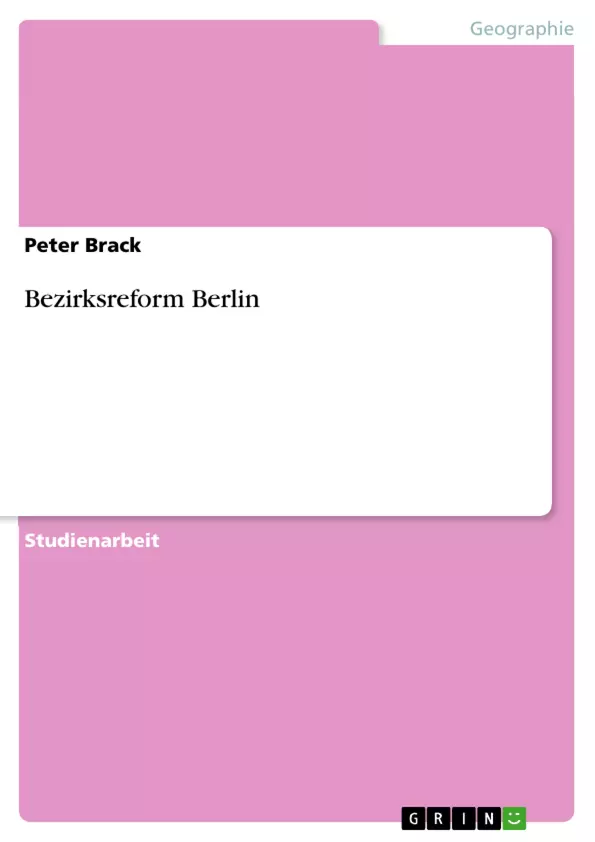Ein tiefgreifender Umbruch erschütterte die politische Landschaft Berlins in den späten 1990er Jahren: Die Bezirksreform. Dieses Buch enthüllt die hitzigen Debatten und komplexen Machtspiele, die hinter der Neugliederung der Berliner Bezirke steckten. War es ein notwendiger Schritt zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung, oder ein von Parteikalkül getriebenes Manöver? Tauchen Sie ein in die Chronologie eines langwierigen Streits, der die Hauptstadt spaltete. Von den ursprünglichen 23 Bezirken zu den schließlich beschlossenen zwölf – jede Zusammenlegung, jede Aufgabenverlagerung war hart umkämpft. Entdecken Sie die wahren Motive der Akteure, die Argumente für und wider die Reform, und die potenziellen Auswirkungen auf die Bürger. Die Autoren analysieren die Rolle der Volksabstimmung, die Kritik an den Übergangsregelungen und die Bedenken hinsichtlich des Eingriffsrechts des Senats. Erfahren Sie, wie die Raumplanung Berlin-Brandenburg die Entscheidungen beeinflusste und welche Rolle die angespannte Haushaltslage spielte. Dieses Buch bietet eine umfassende Analyse der Berliner Bezirksreform, beleuchtet die politischen Ränkespiele und die langfristigen Folgen für die Stadt. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Kommunalpolitik, Verwaltungsreformen und die Geschichte Berlins interessieren. Die detaillierte Untersuchung der Gesetzesänderungen, Senatsvorlagen und Gutachten ermöglicht einen tiefen Einblick in die komplexen Entscheidungsprozesse. Verfolgen Sie die Chronologie der Ereignisse, von den ersten Vorschlägen bis zur endgültigen Verabschiedung der Gesetze. Die Bezirksreform in Berlin – eine Geschichte von Macht, Politik und dem Ringen um die Zukunft der Stadt, inklusive der damit verbundenen Kostenersparnis, kürzeren Verwaltungswegen und vergleichbaren Verwaltungseinheiten. Die Analyse der Parteikalküle und der potenziellen Auswirkungen auf zukünftige Mehrheitsverhältnisse machen dieses Buch zu einem spannenden Einblick in die Berliner Politik.
Gliederung
1. Einleitung
2. Aktuelle Beschlußlage
2.1. Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 27.03.1998
2.1.1. Neugliederung der Bezirke
2.1.2. Reduzierung der Zahl der Parlamentsabgeordneten, der Senatoren und der Bürgermeister
2.1.3. Aufgabenverlagerung
2.1.4. Übergangsregelung
2.2. Verwaltungsreform
2.2.1. Gesetz zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 28.05.1998
2.2.2. Allgemeines Zuständigkeitsgesetz
3. Gründe für eine Bezirksreform in Berlin
3.1. Kostenersparnis
3.2. Vergleichbare Verwaltungseinheiten
3.3. Kürzere Verwaltungswege
3.4. Raumplanung Berlin-Brandenburg
4. Streitpunkte der Senatsvorlagen
4.1. Volksabstimmung
4.2. Bezirkszusammenlegungen
4.3. Übergangsregelung
4.5. Aufgabenverlagerung und Eingriffsrecht des Senats
4.6. Kostenersparnis
4.7. Parteikalkül
5. Kurze Chronologie eines langen Streites zur Bezirksreform Berlin
6. Fazit / Ausblick
Literaturverzeichnis
Anlagen: 1. Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 26.03.1998
2. Drucksache 13/1872
3. Bericht der Arbeitsgruppe Gebietsreform des ständigen Ausschußes für Inneres des Rates der Bürgermeister vom 10.02.1997
1. Einleitung
"Das ist ein historischer Tag", bemerkte der Regierende Bürgermeister Berlins, Eberhard
Diepgen, am 26.03.1998, kurz nach der Abstimmung über das Zweite Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin. Gemeint war damit der vorläufige Endpunkt eines langen politischen Streites um eine Neugliederung der Berliner Bezirke.
Spätestens seit 1990 war klar, daß Berlin mit seinen 23 Bezirken, deren Einteilung zum größten Teil noch aus der Gründungszeit der Berliner Großgemeinde anno 1920 stammt, unter der enormen Last der vielfältigen Probleme der Wiedervereinigung der beiden Stadthälften effizientere Verwaltungseinheiten benötigt.
Von der Warte des Senates aus sollte eine Reduzierung der Anzahl der Bezirke im Verbund mit der Parlamentsreform und der Verwaltungsreform gesehen werden, und lange Zeit war geplant, diese drei Bereiche im Paket abzustimmen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird versucht, die verschiedenen Aspekte dieser Bezirksreform näher zu beleuchten.
Dabei beginne ich mit der Erläuterung der bisher beschlossenen Gesetze, wende mich danach den Motivationen für die Bezirksneugliederung zu, und werde danach die Gegenargumente zu den verschiedenen Senatsvorlagen diskutieren.
Nach einer kurzen Chronologie des lange währenden Streits um eine Neuordnung der Bezirke Berlins werde ich im Schlußteil dieser Arbeit versuchen, eine Art Fazit zu ziehen und einen Ausblick in die mittelfristige Zukunft Berlins wagen.
2. Aktuelle Beschlußlage
Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ( Juli 1998 ) liegen drei verabschiedete Gesetze vor, die direkt oder indirekt die Bezirksreform betreffen. Gebietsreform und die sogenannte Parlamentsreform liegen als Verfassungsänderung vor, die Verwaltungsreform wurde in ihren Grundzügen als Allgemeines Zuständigkeitsgesetz (AZG) beschlossen, bedarf jedoch der weiteren Ausgestaltung durch weitere Gesetze und Verordnungen. Die Gebietsreform wurde am 28.05.98 auch als einfaches Gesetz als "Gesetz zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke" verabschiedet.
2.1. Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 27.03.1998
Nach drei emotionsgeladenen Lesungen wurde am 27.03.1997 die Grundlage für die Bezirksreform gelegt. Es handelt sich hierbei um die Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Verfassung von Berlin. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß eine Verfassungsänderung nur durch eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus beschlossen werden kann. Die Brisanz lag in der knappen Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten der Koalition von CDU und SPD.
Im Folgenden werden die wichtigsten Punkte dieses Gesetzes genannt und erläutert.
2.1.1. Neugliederung der Bezirke
" Artikel 4
(1) Berlin gliedert sich in zwölf Bezirke. Diese umfassen die bisherigen Bezirke
1. Mitte, Tiergarten und Wedding,
2. Friedrichshain und Kreuzberg,
3 Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow,
4. Charlottenburg und Wilmersdorf,
5. Spandau,
6. Zehlendorf und Steglitz,
7. Schöneberg und Tempelhof,
8. Neukölln,
9. Treptow und Köpenick,
10. Marzahn und Hellersdorf,
11. Lichtenberg und Hohenschönhausen,
12. Reinickendorf.
..."
(Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin, 54. Jahrgang, Nr. 11,1998)
Der Unterschied zur alten Version liegt sowohl in der Neugliederung der Bezirke, als auch in der Weglassung der Formel " Berlin umfaßt die Bezirke..." der alten Version , deren Formulierung noch auf die Verfassung von 1950 zurückgeht, als aufgrund der damaligen Inselsituation der drei Westsektoren eine Gebietshoheitsbeschreibung notwendig war. Da das Gebiet des Landes Berlin mittlerweile im Rahmen des Einigungsvertrages (Protokoll zum Einigungsvertrag, zu Art. 1) festgelegt worden ist, ist die für eine Landesverfassung unübliche Gebietsbeschreibung entbehrlich.
Auf das Kernstück dieses Teils der Verfassungsänderung, nämlich die Neugliederung der Bezirke, mit all seinen Aspekten, soll unter Punkt 4.2. näher eingegangen werden.
2.1.2. Reduzierung der Zahl der Parlamentsabgeordneten, Senatoren und Bürgermeister
Der Artikel 38 Absatz 2 der Verfassung von Berlin regelt die Zahl der Abgeordneten des Abgeordnetenhauses. Es wurde eine Verringerung der Abgeordneten auf 130 beschlossen. Diese Verringerung von 150 Abgeordneten auf 130 wird als Parlamentsreform bezeichnet, deren Bedeutung jedoch kaum über eine Willenserklärung zur Einsparung von Kosten auf der höchsten Ebene der Legislative hinausreicht. Zusammen mit Überhangs- und Ausgleichsmandaten werden im Abgeordnetenhaus der vierzehnten Wahlperiode ca. 180 Abgeordnete erwartet.
Artikel 55, Absatz 2 besagt, daß die Anzahl der Senatoren von zehn auf acht reduziert werden, die Zahl der Bürgermeister von drei auf zwei.
2.1.3. Aufgabenverlagerungen
Um den aufkommenden Forderungen nach einer Aufgabenumschichtung weg von Senatszuständigkeiten hin zu stärkeren Bezirken mit mehr Rechten und Aufgaben, eine verfassungsrechtliche Grundlage zu geben , wird unter Artikel 67 und 68 eine recht allgemein gehaltene Festlegung der zukünftigen Senats- bzw. Bezirksaufgaben statuiert. Demnach sind die einzelnen Senatsverwaltungen nur noch für solche Aufgaben zuständig, welche gesamtstädtischer Natur sind. Die bisher zuständigen Fachaufsichten sollen aufgelöst werden und durch ein Eingriffsrecht des Senates ersetzt werden.
Die einzelnen Punkte dieser Aufgabenumschichtung sollen durch Gesetz geregelt werden.
2.1.4. Übergangsregelungen
Die wichtigsten Punkte der sogenannten Übergangsregelungen umfassen vor allem die verschiedenen legislativen Bereiche der Bezirke, nämlich die
Bezirksverordnetenversammlung und deren Postenträger, also Bürgermeister und Stadträte. Hierbei wurde unter anderem festgelegt:
- die Beendigung der Amtszeit der Bezirksverordnetenversammlungen der zusammenzulegenden bisherigen Bezirke zum 1. Januar 2001,
- die Festlegung der Anzahl der Bezirksverordneten der neuen Bezirke, welche aus zwei bisherigen Bezirken zusammengelegt wurden auf 69, bei Bezirken, welche aus drei bisherigen Bezirken gebildet werden auf 89, und deren Antritt ihrer Amtszeit ab dem 1. Januar 2001,
- die Verlängerung der Amtszeit der Postenträger der 13. Wahlperiode bis zum 1. Januar 2001.
2.2. Verwaltungsreform
Mit der Verwaltungsreform ist neben der Neugliederung der Berliner Bezirke gemeinhin die effizientere und dabei kostensparendere, da Doppelzuständigkeiten vermeidende Aufgabenverlagerung weg von den Senatsverwaltungen hin zu den Bezirken gemeint. Die Verwaltungsreform entspricht daher der praktischen Umsetzung der Verfassungsänderung zur Bezirksneugliederung. Besondere Brisanz erlangte dieser Punkt aufgrund der Tatsache, daß unter anderem der Rat der Bürgermeister der Meinung war, eine Verwaltungsreform solle vor einer Gebietsreform durchgeführt werden, der Senat jedoch darauf beharrte, daß Beides parallel von statten gehen müsse.
2.2.1. Gesetz zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 28.05.1998
Das sogenannte Gebietsreformgesetz ist die detailliertere, einfache Gesetzesvariante der verfassungsrechtlichen Verankerung der Bezirksreform.
Hierbei werden noch einmal die Zusammenlegungen zu zwölf Bezirken, als auch die Übergangsregelungen für die Bezirksverordnetenversammlungen festgehalten. Interessant erscheint jedoch der neugefaßte § 37, Absatz 1, Satz 2: " In jeder Bezirksverwaltung soll ein Bürgeramt eingerichtet werden".
Hiermit wird versucht, die Bürgernähe auch weiterhin sicherzustellen. Vorgesehen sind diese Bürgerämter in den bisherigen Rathäusern und an weiteren leicht erreichbaren Orten.
2.2.2. Allgemeines Zuständigkeitsgesetz
Dieses Gesetz regelt die Übertragung von Aufgaben der Senatsverwaltung zu den Bezirken. Damit bekommen die neugebildeten Bezirke mehr Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse. Diese Kompetenzverlagerung wird durch Personal und Finanzen unterstützt, d.h. Geld und Personal folgen den Aufgaben. Die Fachaufsichten werden aufgelöst und durch das sogenannte Eingriffsrecht des Senates ersetzt. Hierbei kann der Senat eine Entscheidung eines Bezirkes korrigieren, falls diese dringende gesamtstädtische Interessen beeinträchtigt.
Die Einrichtung von Bürgerämtern als auch von Leistungs- und Verantwortungszentren zur Gewährleistung der Bürgernähe wird hier gesetzlich noch einmal verankert.
3. Gründe für eine Bezirksreform in Berlin
Nahezu alle politischen Strömungen innerhalb Berlins waren sich seit der Wiedervereinigung im Klaren, daß die Verwaltung Berlins eine Reform braucht, um auch nach dem Wegfall der Berlinhilfe leistungsfähig und bezahlbar bleibt. Neben den im letzten Abschnitt behandelten Kompetenzverlagerungen hin zu den Bezirken, waren vor allem die Neugliederung der unteren Verwaltungseinheiten, also die Bezirksgebietsreform Anlaß zu einem langen Streit. In den nächsten Punkten werden die wichtigsten Argumente für die Bezirksreform genannt.
3.1. Kostenersparnis
Die Hauptmotivation für eine Verschlankung des Verwaltungsapparates war und ist die angespannte Haushaltslage in Berlin und somit die zwangsläufige Notwendigkeit zu sparen. Aufgrund der zu bewältigenden Aufgaben in den Jahren nach der Wiedervereinigungen, als auch aufgrund des Wegfalls des Berlinzuschusses hat das Land Berlin enorme Haushaltsengpäße zu überwinden. Die Schließungen von Kultureinrichtungen und kurzfristig verhängte Haushaltssperren sind ein sicheres Indiz hierfür.
In der Begründung der Senatsvorlage zur Verfassungsänderung (Drucksache 13/1872) wird von einer Kostenersparnis von ca. 203 Millionen DM pro Jahr ausgegangen. Davon seien rund 165 Mio. DM sofort und rund 38 Mio. DM mittelfristig zu erzielen. Hauptposten sind hierbei die ca. .1500 wegfallenden Stellen.
3.2. Vergleichbare Verwaltungseinheiten
Argumentiert wird, beziehungsweise wurde, bei diesem Punkt hauptsächlich damit, daß die sogenannte Grundausstattung eines Bezirkes, enthaltend alle Stellen, die verantwortlich sind für die Grundversorgung der Bürger mit Leistungen, der Verwaltungsapparat, sowie die beschließende Ebene (Bezirksverordneten-versammlung, Stadträte und Bürgermeister) eines Bezirkes in der Größenordnung Neuköllns mit über 300 000 Einwohnern durchaus gut in der Lage sei, seine Aufgaben zu erfüllen. Somit sei eine komplette Grundausstattung für kleinere Bezirke überflüssig. Alle Bezirke sollten deshalb vergleichbare Einwohnerzahlen mit ca. 300 000 Einwohner aufweisen.
Desweiteren wurde auf eine demokratische Benachteiligung des Bürgers eines großen Bezirkes verwiesen, da die Zahl der Bezirksverordneten pro Bezirk gleich ist. Somit also in einem Bezirk mit niedriger Einwohnerzahl das Verhältnis von Bezirksverordneten zu Bürgern ungleich besser ist, sie also besser vertreten werden können als in einem Bezirk mit großer Einwohnerzahl.
3.3. Kürzere Verwaltungswege
Das Schaffen von kürzeren Verwaltungswegen, der Wegfall von Doppelzuständigkeiten und Reibungsverlusten soll über eine Aufgabenumschichtung von der Senatsebene auf Bezirksebene erreicht werden.
Der Senat wird dabei nur noch Aufgaben übernehmen, welche ministerieller oder gesamtstädtischer Natur sind, behält sich aber ein Eingriffsrecht vor. Kürzere Verwaltungswege sind also tatsächlich eher mit einer Reform der Verwaltungsverordnungen verknüpft als mit dem Neuzuschnitt der Bezirke.
3.4. Raumplanung Berlin-Brandenburg
Im gescheiterten Fusionsvertrag zwischen Berlin und Brandenburg war ein Artikel vorgesehen, welcher Berlin verpflichtet hätte, eine Bezirksreform durchzuführen. Der Grund hierfür war, daß bei einer Vereinigung der beiden Bundesländer, also bei einer einheitlichen Verwaltung des neu zu schaffenden Bundeslandes kein aufgeblähter Berliner Verwaltungsapparat mit in diese neue Zweckehe mit eingebracht werden sollte. Seit der Ablehnung der Fusion durch eine Volksabstimmung fiel dieses Argument weg.
4. Streitpunkte der Senatsvorlagen
Sehr kontrovers diskutiert wurden die zum Thema Bezirksreform erarbeiteten Senatsvorlagen 13/1871 und 13/1872 (Anlagen 3 und 4). Obwohl nahezu keine Partei eine Neugliederung der Bezirke prinzipiell ablehnte, wurden diese beiden Drucksachen auf allen Ebenen scharf kritisiert.
4.1. Volksabstimmung
Selbst der Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen forderte noch Anfang 1996 eine Volksbefragung zum Thema Neugliederung der Bezirke. Als die Fusionierung Berlins und Brandenburgs an einer Volksabstimmung scheiterte, wurde von der Regierungskoalition die Position vertreten, daß eine nötige Verfassungsänderung durch eine qualitative Mehrheit (Zwei Drittel) im Abgeordnetenhaus ausreichend sei.
4.2. Bezirkszusammenlegungen
Der wohl am heftigsten umstrittene Punkt waren die verschiedenen Modelle einer etwaigen Neugliederung. Seit der Wiedervereinigung wurden unterschiedliche Modelle vorgeschlagen. Im Gespräch waren Neugliederungen zu 18, 15, 14 oder 12 neuen Bezirken. Nach der Festlegung des Senates auf das Zwölfer-Modell lassen sich die Gegenargumente zu der neuen Bezirksaufteilung folgendermaßen unterteilen:
- Die vom Senat geplanten Gebietsneuzuschnitte sind reine Bezirkszusammen- legungen ohne Berücksichtigung von strukturellen, sozialen und kulturellen Zusammenhänge schaffen neue Widersprüche und Probleme. Das alleinige Kriterium der Einwohnerzahl als Grundlage für neue Bezirkszuschnitte ist daher nicht sinnvoll.
- Verschiedene Bezirke, beziehungsweise deren Postenträger waren nicht mit dem neuen Partnerbezirk einverstanden. Exemplarisch sei hier auf den Fall Wedding verwiesen. Im 1997er Modell war für den Bezirk Wedding eine Zusammenlegung mit dem Bezirk Prenzlauer Berg geplant. Man befürchtete eine weiter Verschärfung der sozialen Probleme. Erst mit der Ausweisung einer Zusammenlegung des Weddings mit den Innenstadtbezirken Mitte und Tiergarten zum neuen Haupstadtbezirk im beschlossenen Zwölfer-Modell 1998, wurde der Widerstand des Bezirkes Wedding gebrochen.
4.3. Übergangsregelung
Die sowohl im Gesetz zur Änderung der Verfassung Berlins, als auch im Gebietsreformgesetz verankerten Übergangsregelungen führten zum Protest der Oppositionsparteien. Streitpunkt hierbei waren vor allem die Verlängerungen der Mandatszeiten für Bürgermeister und Stadträte der Bezirke um ein Jahr. Vorgeworfen wurde eine reine Verlängerung aus Gründen des Pensionsanspruches der Postenträger. Zudem gibt es während dieses Verlängerungsjahres keine Kontrollinstanz in Form von Bezirksverordnetenversammlungen, da ja diese Postenträger nicht von den neuen Bezirksverordnetenversammlungen gewählt wurden, also auch nicht von diesen abgewählt werden können.
4.5. Aufgabenverlagerung und Eingriffsrecht des Senats
Die im Verbund mit der Gebietsreform zu sehende Kompetenzverlagerungen hin zu den Bezirken werden Probleme bei der Umsetzung im Bereich der Finanzen und des Personals erwartet. Zudem wurden diese Kompetenzverlagerungen aufgrund der Einführung des
Eingriffsrechtes, anstatt der bisherigen Fachaufsichten, eher als eine weitere Entmündigung als eine Stärkung des Bezirkes, kritisiert.
4.6. Kostenersparnis
Das Hauptargument für eine Bezirksreform wurde und wird von den Gegnern angezweifelt. Als Beispiel sei hier die Gegenrechnung des Rates der Bürgermeister aufgeführt, die im Rahmen der Stellungnahme zur Senatsvorlage 13/1871 veröffentlicht wurde, welche von einer Einsparsumme zwischen rund 51 Mio. DM und 68,5 Mio DM pro Jahr ausgeht. Nicht berücksichtigt sind dabei die Kosten für diese Bezirks- bzw. Verwaltungsreform in Form von Gutachten und Fortbildungskosten des Personals. Vergleichend sei noch einmal die Einsparsumme von rund 200 Mio. DM laut Senatsrechnung genannt. Die divergierenden Rechnungen unterscheiden sich in der Hauptsache in der unterschiedlicher Herangehensweise bei den vermeintlich wegfallenden Stellen im Bereich der Senats- und Bezirksverwaltungen und der Aufrechnung der zu errichtenden Bürgerämtern und Leistungs- und Verantwortungsstellen.
4.7. Parteikalkül
Besonders interessant gestalteten sich die politischen Machtkämpfe, meist hinter verschlossenen Türen. Da eine Verfassungsänderung nur mit einer sogenannten qualitativen Mehrheit des Abgeordnetenhauses - zwei Drittel - beschlossen werden kann, hing dieser Beschluß bis zur letzten Minute am seidenen Faden. Nur mit nahezu allen Stimmen der Regierungskoalition konnte diese Reform beschlossen werden. Diese Ausgangssituation führte zu teilweise grotesken Meinungsumschwüngen. So war zum Beispiel der Bürgermeister des Bezirkes Wedding, Nisblé, genau so lange ein Gegner einer Gebietsreform, bis sein Bezirk im letzten Senatsvorschlag dem neuen Hauptstadtbezirk zugeschlagen wurde.
Nur gemutmaßt werden kann, inwieweit das vermutete Wahlverhalten der Bürger der neuen Bezirke für den Neuzuschnitt von Bezirken eine Rolle gespielt hat. Wurde in den Planungen des Senates vordringlich darauf geachtet, daß sich ein Neugliederung der Bezirke positiv auf zukünftige Mehrheitsverhältnisse für die Koalition auswirkt?
Diese Frage wurde von den Oppositionsparteien immer wieder aufgeworfen. Und in der Tat erscheinen Bezirksneuzuschnitte wie das quasi in letzter Minute entstandene Kreuzberg/Friedrichshain oder die Zusammenlegung von Marzahn und Hellersdorf nachteilig für die Oppositionsparteien.
5. Kurze Chronologie eines langen Streites zur Bezirksreform Berlin
Nachdem nun das Pro und Kontra einer Bezirksreform benannt wurden, wird im folgenden Teil eine Chronologie des langen politischen Streites gegeben, um die einzelnen Vorstöße, welche letztendlich zu den Gesetzen zur Berliner Bezirksreform führten, in einen zeitlichen Zusammenhang zu bringen:
Januar 1991: Bezirksbürgermeister von Schöneberg Michael Barthel schlägt ein 14-Bezirke- Modell vor (Besonderheit: Aufteilung Kreuzbergs) 23.05.1993: Bericht der Arbeitsgruppe "Reduzierung der Zahl der Bezirke": Bezirksvertreter sprechen sich für eine konsequente Durchführung der Verwaltungsreform und eine Vertagung der Bezirksreform aus, die Senatsvertreter votieren dagegen für eine Gebietsreform. Es werden zwei Modelle (mit 12 bzw. 18 Bezirken) präsentiert
21.-23.01.1994: SPD beschließt, die Bezirksgebietsreform noch in dieser Wahlperiode zu beschließen
24.01.1994: Eberhard Diepgen vor dem Abgeordnetenhaus: "Die wesentlichen Ziele unserer Verwaltungsreform, und dazu gehört abschließend auch die Gebietsreform, müssen in dieser Legislaturperiode erreicht werden."
21.06.1995: Fusionsvertrag Berlin-Brandenburg wird in einer Volksabstimmung abgelehnt
25.01.1996 Die Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU sieht die Reduzierung der Anzahl der Bezirke in Berlin auf 18 vor
21.03.1996: Senat stellt Gesetzesentwurf zur Änderung der Berliner Verfassung vor. Artikel 4: "Berlin gliedert sich in 18 Bezirke."
21.03.1996: Rat der Bürgermeister lehnt Senatsvorlage einstimmig ab
25.04.1996: Das Abgeordnetenhaus lehnt einen Antrag der PDS-Fraktion über die Bindung einer Gebietsreform an eine Volksabstimmung ab
27.10.1996: Senatsbeschluß: 12 Bezirke
27.10.1996 - Ende 1996: Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlungen:
Mehrheit aller Bezirke sprechen sich gegen eine Gebietsreform aus
10.12.1996: Senatsvorlage Nr. 283/96 betreffs Gebietsreformgesetz mit 12 Bezirken
20.02.1997 Ablehnung der Senatsvorlage durch den Rat der Bürgermeister
1.07.1997: Senat bringt neue Gesetzesvorlagen (Drucksachen 13/1871 und 13/1872) ins Abgeordnetenhaus ein
26.02.1997 Neues 12er Modell wird vom Senat eingebracht, Kreuzberg wird jetzt mit
Friedrichshain zusammengelegt, Wedding wird zum Hauptstadtbezirk zugeschlagen und ist jetzt Gebietsreformbefürworter
18.03.1998: Rat der Bürgermeister lehnt auch neue Gesetzesvorlage ab
26.03.1998: Annahme der Gesetzesvorlage zur Änderung der Verfassung von Berlin gegen die Stimmen der Opposition
28.05.1998: Annahme des Gesetzes zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke, Annahme des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes
6. Fazit / Ausblick
Selten kann eine Verknüpfung von räumlichen und politischen Aspekten dermaßen direkt beobachtet werden. Die Einbindung der raumordnerischen Komponente beim Thema Bezirksreform Berlin als kostensparende Maßnahme macht deutlich, wie relevant dieser Aspekt der Geographie im täglichen Leben werden kann, und wie empfindlich politische Entscheidungsträger darauf reagieren.
Der politische Streit auf allen Ebenen und quer durch alle Parteien, bei dem letztendlich in der entscheidenden Abstimmung zur entsprechenden Änderung der Verfassung von Berlin vom 26.03.1998, durchaus von einer Abstimmung unter Fraktionszwang gesprochen werden kann, macht die Verquickung von parteipolitischen Machtkämpfen und raumplanerischen, sinnvollen Entwicklungen sichtbar.
Inwieweit die beschlossenen Gesetzesvorlagen die Erwartungen in Bezug auf Kostenersparnis und Effizienz der neuen Verwaltungseineheiten erfüllen werden, kann nur die Zukunft aufzeigen. Eine längere Übergangszeit, mit Kompetenzgerangel zwischen den einzelnen Bezirken und zwischen Bezirks- und Senatsaufgaben und Startschwierigkeiten in den neu einzurichtendenen Bürgerämtern und den sogenannten Leistungs- und Verantwortungszentren kann jedenfalls erwartet werden.
Literaturverzeichnis:
Landesumweltamt Brandenburg (1996): Berlin-Brandenburg regional`96. Potsdam
Scherf, K.; Viehrig, H. (Hrsg.) (1995): Berlin und Brandenburg auf dem
Weg in die gemeinsame Zukunft. Gotha
Wekel,J. (1997): Berlin auf dem Weg zur Bundeshauptstadt. In: Ehlers, E. (Hrsg.) Deutschland und Europa - Historische, politische und geographische Aspekte. Bonn
Internet:
http://www.parlament-berlin.de http://www.berlin.de
http://www.berlin-online.de http://www.kreuzberg.de
Anlagen:
1. Zweites Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 26.03.1998
2. Drucksache 13/1872
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine Analyse der Bezirksreform in Berlin, die in den 1990er Jahren stattfand. Es umfasst die aktuelle Beschlusslage, die Gründe für die Reform, Streitpunkte der Senatsvorlagen, eine Chronologie des Streits und ein Fazit mit Ausblick.
Welche Gesetze sind im Zusammenhang mit der Bezirksreform relevant?
Die wichtigsten Gesetze sind das Zweite Gesetz zur Änderung der Verfassung von Berlin vom 27.03.1998 und das Gesetz zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke (Gebietsreformgesetz) vom 28.05.1998. Auch das Allgemeine Zuständigkeitsgesetz (AZG) ist von Bedeutung.
Was waren die Hauptgründe für die Bezirksreform?
Die Hauptgründe waren Kostenersparnis, Schaffung vergleichbarer Verwaltungseinheiten, kürzere Verwaltungswege und die Raumplanung Berlin-Brandenburg.
Welche Streitpunkte gab es bei den Senatsvorlagen?
Die wichtigsten Streitpunkte waren die Frage einer Volksabstimmung, die konkreten Bezirkszusammenlegungen, die Übergangsregelungen, die Aufgabenverlagerung und das Eingriffsrecht des Senats, die erwartete Kostenersparnis und Parteikalkül.
Wie verlief die Chronologie des Streits um die Bezirksreform?
Die Chronologie umfasste verschiedene Modelle zur Neugliederung (18, 15, 14, 12 Bezirke), Ablehnungen von Senatsvorlagen durch den Rat der Bürgermeister, Gesetzesentwürfe und letztendlich die Annahme der Gesetzesvorlage zur Änderung der Verfassung von Berlin und des Gesetzes zur Verringerung der Zahl der Berliner Bezirke.
Was ist das Fazit der Analyse?
Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass die Verknüpfung von räumlichen und politischen Aspekten bei der Bezirksreform deutlich wird. Ob die beschlossenen Gesetze die erwarteten Kostenersparnisse und Effizienzsteigerungen bringen, wird die Zukunft zeigen.
Was sind Bürgerämter und Leistungs- und Verantwortungszentren im Kontext der Bezirksreform?
Bürgerämter wurden in den bisherigen Rathäusern und an anderen leicht erreichbaren Orten eingerichtet, um Bürgernähe zu gewährleisten. Leistungs- und Verantwortungszentren sollten ebenfalls zur Bürgernähe beitragen und wurden gesetzlich verankert.
Was war das Eingriffsrecht des Senats?
Das Eingriffsrecht des Senats ermöglichte es dem Senat, eine Entscheidung eines Bezirkes zu korrigieren, falls diese dringende gesamtstädtische Interessen beeinträchtigt. Es ersetzte die bisherigen Fachaufsichten.
Warum wurde eine Volksabstimmung gefordert, und warum kam es nicht dazu?
Eine Volksabstimmung wurde ursprünglich gefordert, um die Bevölkerung in die Entscheidung einzubeziehen. Nachdem die Fusionierung Berlins und Brandenburgs an einer Volksabstimmung scheiterte, vertrat die Regierungskoalition die Position, dass eine Verfassungsänderung durch eine Zweidrittelmehrheit im Abgeordnetenhaus ausreichend sei.
Was waren die Kritikpunkte an den Übergangsregelungen?
Die Verlängerung der Mandatszeiten für Bürgermeister und Stadträte der Bezirke wurde kritisiert, da sie als reine Verlängerung aus Gründen des Pensionsanspruches der Postenträger angesehen wurde und während dieser Zeit keine Kontrollinstanz in Form von Bezirksverordnetenversammlungen existierte.
- Arbeit zitieren
- Peter Brack (Autor:in), 1998, Bezirksreform Berlin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96271