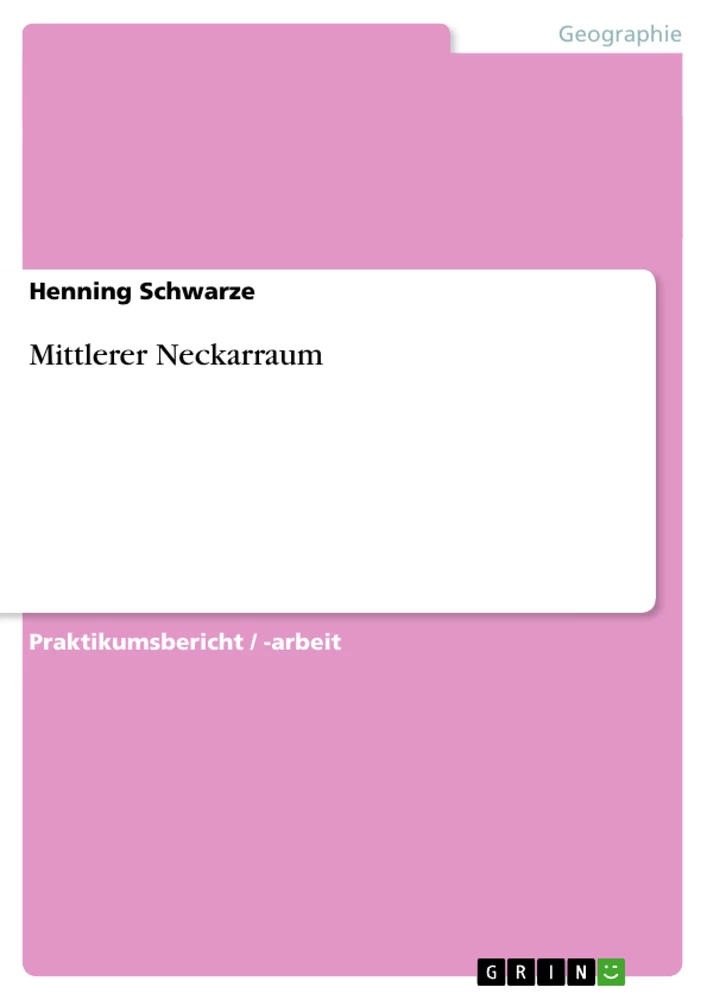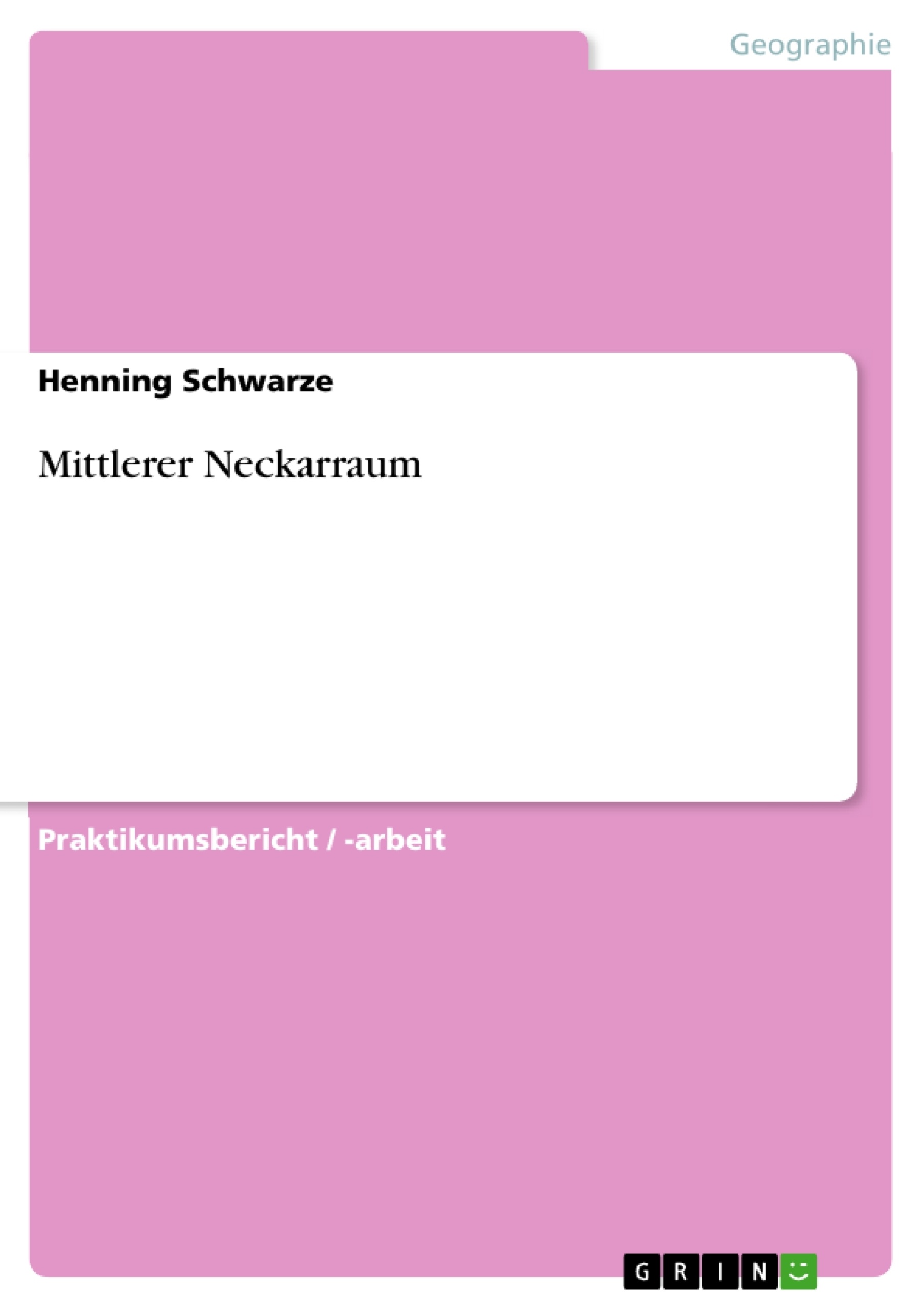Entdecken Sie die faszinierende Vielfalt Süddeutschlands in einer packenden Reise durch Mainfranken, die Schwäbische Alb und den dynamischen Verdichtungsraum Stuttgart. Erkunden Sie das malerische Maintal mit seinen charakteristischen Kastentälern, sonnenverwöhnten Weinbergen und historischen Siedlungen, die von Handel und Weinbau geprägt sind. Tauchen Sie ein in die geologische Geschichte der Schwäbischen Alb, von den berühmten Fossilienfunden in Holzmaden bis zu den beeindruckenden Burgruinen Staufeneck und Helfenstein, die Einblicke in vergangene Zeiten gewähren. Erleben Sie die einzigartige Schichtstufenlandschaft mit ihren markanten Gesteinsformationen und der komplexen Flussgeschichte, die das Relief geprägt hat. Analysieren Sie den Verdichtungsraum Stuttgart, von seinem Binnenhafen in Esslingen/Untertürkheim bis zum Polyzentrum Fasanenhof und der pulsierenden Innenstadt, und verstehen Sie die Strukturmerkmale dieses bedeutenden Wirtschaftsraums mit seinen Arbeitsplatzstrukturen, Pendlerströmen und der Bevölkerungsentwicklung. Dieses Buch bietet eine umfassende und anschauliche Erkundung der geographischen, geologischen und wirtschaftlichen Besonderheiten dieser Regionen und ist somit ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die sich für Landschaft, Geschichte und regionale Entwicklung interessieren. Begeben Sie sich auf eine informative Reise und entdecken Sie die verborgenen Schätze und dynamischen Prozesse, die diese Regionen so einzigartig machen. Erfahren Sie mehr über die geologischen Formationen, die wirtschaftlichen Wandlungen und die kulturellen Besonderheiten, die Mainfranken, die Schwäbische Alb und Stuttgart prägen. Lassen Sie sich von den landschaftlichen Schönheiten und der urbanen Vielfalt inspirieren und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge dieser faszinierenden Regionen Deutschlands.
Inhaltsverzeichnis
1. Mainfranken
2. Die Schwäbische Alb
3. Die Schichtstufenlandschaft der Schwäbischen Alb
4. Der Verdichtungsraum Stuttgart
5. Strukturmerkmale eines Verdichtungsraumes am Beispiel Stuttgart
6. Links
Mainfranken
1. Standort: Autobahnraststätte Würzburg Themenschwerpunkt: Naturräumliche Aspekte
- das Maintal ist ein Kastental, in das mehrere Kerbtäler mit ihren Schwemmkegeln münden
- die Böden:
- die Talsohle besteht aus Lockermaterial mit darüber liegenden Auenböden
- Hänge bestehen aus Kalkstein und Muschelkalk, dies ist hartes, festes, homogenes Material, was die Steilheit der Hänge erklärt
- Hochfläche besteht aus Muschelkalk mit einer Lößauflage
- das Klima:
- Hauptwindrichtung ist West, daraus resultiert, daß das Mittelgebirge Spessart klimatisch vorgeschaltet ist
- dies ergibt ein Lee- Lage des Maindreiecks, wo subkontinentales Klima vorherrscht und was diesen Bereich zu einer Wärme- u. Trockeninsel macht
- Nutzung:
- Talsohle: Siedlungen, Industrie und Gewerbe (ursprünglich angesiedelt auf den Schwemmkegeln der Kerbtäler, zum Schutz vor Hochwasser)
- Hänge: zur sonnenexpositionierten Seite Weinbau ( auffällig ist, daß erst ab einem bestimmten Höhenniveau angebaut wird, der Grund sind "Kaltseen" über den Mainauen)
- Hochfläche: Ackerbau (Weizen, Gerste und Zuckerrüben), weitgehend waldfrei 2.Standort: Sommerhausen
Themenschwerpunkt: Typische Siedlungsformen im Maintal
- dörfliche Grundstrukturen:
- komplette Ummauerung, enge Gassen, Kopfsteinpflaster und alte Bausubstanz (Heckerhäuser mit Runden Toreinfahrten für den Weinbau, Paterre als Wirtschaftsteil, 1. Stock als Wohnteil, es ist kein klassisches Bauernhaus sondern hat eher städtischen Charakter)
- historische Grundlagen der Entwicklung:
- Main diente als Transportweg
- mögliche Schutzfunktionen des Main und der Hänge für die Ortschaften
- Klimagunst dieses Gebietes ermöglichte den Weinbau als wirtschaftliches Standbein 3. Standort: Stadt Marktbreit
Themenschwerpunkt: Entwicklung im Maintal
- alte Funktionen der Ortschaften:
- Handel, Zollstellen und der Wein als wertvolles Handelsgut
- Funktionswandel:
- der Main hat aufgrund größerer Schiffe und der Eisenbahn an Bedeutung als Transportweg verloren, dies bedeutete für die Siedlungen einen Funktionsverlust, welcher zur Stagnation führte, was ein weiteres Anwachsen der Orte verhinderte, aber dazu führte, daß die alte Bausubstanz erhalten blieb
- hierdurch wurde die Tür für den Tourismus als neues Wirtschaftsstandbein geöffnet (Besichtigungs- u. Kurzzeittourismus zu Stoßzeiten (Bsp. Sommerhausen: Torturmtheater, Weinfeste)), wohlhabende Leute aus der Stadt sind zugezogen um in diesem besonderen "Ambiente" zu leben, was wiederum dazu führt das nun die Ortschaften expandieren um Touristen und Neubürger zu versorgen
Die Schwäbische Alb
1. Standort: Urweltmuseum Holzmaden
- das Museum wurde aufgrund der besonderen Standortfaktoren hier errichtet
- von altersher gab es Schieferbrüche zur Gewinnung von "Fleinses", der Schiefer ist eine Meeresablagerung aus der Jurazeit vor ca. 150 Millionen Jahren, in ihm hat man ausgezeichnet erhaltene Versteinerungen gefunden welche auf der Welt einzigartig sind (verschiedene Saurier, Fische, Muscheln und Pflanzen)
- es wird die fossile Lebewelt des Jurameers dargestellt
- in dem Museum werden neben den ausgestellten Fossilien auch Erläuterungen zum Aufbau der Schwäbischen Alb gemacht
Aufbau und Alter der Schwäbischen Alb:
- der Grundgebirgssockel besteht aus Granit und Gneis, auf welchem die Schichtstufen lagern, diese unterteilen sich in harte und weiche Schichten
Der Schwäbische Jura: (in allen Schichten des Jura findet man Versteinerungen, besonders gut erhaltene in den Schichten des Schwarzen Juras)
- die Mächtigkeit des Schwäbischen Jura beträgt etwa 800m, welche sich in den Schwarzen Jura (ca. 110m), den Braunen Jura (ca. 240m) und den Weißen Jura (ca. 450m mächtig) unterteilt die einzelnen Schichten sind am Meeresgrund abgelagert worden und im Posidonienschiefer findet man die Fossilien, hiervon gibt es nochmals 17 unterschiedliche Schichten und jede von ihnen weist eine besondere Art von Fossilien auf
Die Bedeutung der Fossilienfunde für die Wissenschaft:
- es läßt sich feststellen, was für Lebewesen und Pflanzen hier angesiedelt waren, durch ihre Anordnung in unterschiedlichen Schichten und tiefen lassen sich Aussagen über das Klima anstellen, die Temperatur und Strömungsverhältnisse lassen sich ableiten, man erhält einen Einblick in die Entwicklungsstufen der Gattungen und über Zustand und Lage der Funde lassen sich Aussagen über geologische Verhältnisse wie Material und Verschiebungen, Hebungen und Senkungen von Gesteinen und Schichten machen
2. Standort: Burgruine Staufeneck
- die Burg wurde erbaut aus Sandstein aus dem Braunen Jura, in dem sich
Eiseneinschlüsse erkennen lassen, aufgrund des Vorhandenseins des Eisens gab es früher auch lokale Verhüttung in diesem Gebiet
Es folgt eine Geländebeobachtung mit Hilfe eines Kartenblattes:
- von der Burgruine aus hat man einen Blick in Richtung Filstal und Lautermündung
- im Bereich der Lautermündung erkennt man ein flaches Wannental, die Mündung selber befindet sich bei Süßen, wo auch die Lauter ihre Erosionsbasis hat
- ab Gingen weitet sich das Tal in Richtung Göppingen, was bedeutet, daß die Fils mit dem Austritt aus der Alb an Gefälle verliert, dieses gilt auch für ihren im Blattbereich größten Nebenfluß, die Lauter, welche bei Donzdorf in eine Weitung eintritt
- die Quellen der Flüsse treten im gleichen Höhenniveau aus
- Nutzung des Talbereichs: Streuobstwiesen und Ackerbau
- Nutzung des Hangbereichs: Wald, und an jeder neu ansetzenden Schichtstufe wird das Gelände flacher und daher auch ackerbaulich genutzt
- es handelt sich hier um ein Stufenland, welches durch wasserreiche Flüsse zertalt ist, auch ein Stockwerkbau ist (angedeutet) erkennbar (Blick südlich auf das Albvorland und südlich der Fils)
- die Fils zeigt auffallende Unterschiede in der Laufgestaltung, bis Süßen ist sie windungsreich und schlängelt sich durch eine Wiesen- u. buschbedeckte Talaue, ab Süßen fließt sie dann fast geradlinig entlang dem nördlichen Talhang, was nur auf Flußregulierungen zurückgehen kann
- Entlang des Filsverlaufs befinden sich auch die Hauptverkehrsachsen (Hauptstr. und Eisenbahnlinie), man sieht hier eine Siedlungsgasse mit enormem Wachstum aller Orte, verursacht durch die vielfältige Industrieausstattung
- Zwischen der Städtereihe Göppingen, Eislingen, Geislingen liegen weitgehend verstädterte, ehemalige bäuerliche Filstalgemeinden (Salach, Süßen, Gingen, Kuchen)
- durch diese Umstände hat das Filstal eine Ausstrahlung in das südliche Albvorland (Industrie- u. Pendlersiedlungen)
3. Standort: Burgruine Helfenstein
- die Burgruine Helfenstein liegt oberhalb der Stauferstadt Geislingen, von der Position (640m ü.NN) hat man einen Blick auf Geislingen und das Filstal
- die geologische Situation stellt sich so dar, daß hier Massenkalke vorherrschend sind, aus denen dann die heute anstehenden Korallenriffkalke mit gebankten Kalken entstanden sind, diese sind extrem widerstandsfähig und hart
- Die Stadt Geislingen hat seinen alten Ortskern im engen Rohrachtal unter der Ruine Helfenstein, während das Haufendorf (spätere Bergwerkssiedlung) Altenstadt am Filsknie entstanden ist. Infolge der verkehrsgünstigen Lage durch den Paß ins obere Filstal und die "Steige" mit Zugang auf die Hochfläche der Schwäbischen Alb, sind beide einst selbständigen Gemeinden durch
Industrieansiedlung (besonders prägend war WMF) zu einer Stadt zusammengewachsen
4. Standort: Das Wental (zwischen Bartholomä und Steinheim)
- der Weg in das Wental führt auf die Hochfläche der Schwäbischen Alb, besonders typisch ist, daß man sich auf einem Höhenniveau von ca. 700m ü.NN befindet, was einem Mittelgebirge entspricht, daß man auf der Hochfläche selber aber keine oder geringe Höhenunterschiede findet, während im Albvorland Kuppenberge und steile Hänge zu sehen waren
- das Wental ist ein Trockental, welches durch Verkarstung entstanden ist (Trockentäler lassen sich auf der Hochfläche öfter erkennen), im Tal sind die Dolomitfelsen besonders auffallend. Normalerweise kam es in einem Tal wie dem Wental aufgrund der Karsterscheinungen zu keinem Oberflächenabfluß, sondern zu einem Abfluß direkt in die Spalten und Klüfte des Kalkgesteins, während einer Eiszeit oder in kälteren Perioden war der Boden jedoch gefroren (Permafrostboden), und "plombiert" worden und es gab bei einer einsetzenden Schneeschmelze oder Niederschlag zu starkem Oberflächenabfluß, welchem nur die extrem harten Dolomitfelsen, aus gebankten Kalken mit einem hohen Magnesiumanteil, widerstanden, die nun das Bild des Wentals prägen
- das starke Ausmaß an Verkarstung der Hochfläche läßt sich durch den hohen Säureanteil vom Wassers des Jurameers erklären, das den Kalkstein besonders gut löst, wodurch es zu dem schnellen eindringen des Oberflächenwassers durch die Klüfte in den Untergrund kommt und dann an Karstquellen wieder zu Tage tritt
- für den Menschen hat dies zur Folge, das man keine Bäche auf der Hochfläche findet und nur ein tief gelegenen Grundwasserspiegel hat, daher mußte man die Wasserversorgung durch Regenwasser aufrecht erhalten, bevor man mit Fuhrwerken Wasser auf die Hochfläche brachte und später mit Pumpstationen die Albwasserversorgung gewährleistete (auf der schwäbischen Alb gibt es die älteste Fernwasserversorgung).
3 Die Schichtstufenlandschaft der Schwäbischen Alb
Unter einer Schichtstufenlandschaft versteht man einen geomorphologischen Landschaftstyp, der sich aus einer Abfolge von Schichtstufen zusammensetzt. Diese sind von einander durch mehr oder weniger ausgedehnte Dachflächen, meist geringer Neigung getrennt. Die Schichtstufen ordnen sich meist geotektonischen Hebungsbereichen zu, in deren Nähe sie sich entwickeln.
Die Entwicklung der Schichtstufen ist abhängig von der Gesteinsart, der Mächtigkeit der Gesteinsschichten sowie von der Neigung. Bei der Rückverlegung der Schichtstufen kommt es zur Bildung von Ausliegern und Zeugenbergen. Man geht davon aus, daß für die Entstehung der Schichtstufenlandschaft der Schwäbischen Alb der Einbruch des Rheingrabens verantwortlich ist. Durch den Einbruch kam es an den Rändern des Rheingrabens zu tektonischen Hebungen (Vogesen u. Schwarzwald), dies hatte auch zur Folge, daß die unterschiedlichen Schichten schiefgestellt wurden und somit die Voraussetzungen zur Entstehung der Schichtstufenlandschaft gegeben wurden. Zuerst mußte die oberste Schicht erodieren und daher wurde am Anfang der Jura abgeräumt. Als ein Beweis für diese Entstehung gilt, daß man in einem alten Vulkanschlot Reste des Weißen Jura gefunden hat, dieser jedoch heute ca. 70 km entfernt ist. Dies sagt aus, daß vor geraumer Zeit dort noch Weißer Jura vorhanden gewesen sein muß, dieser im Verlauf der Zeit jedoch durch Erosion abgewandert ist. Gesteinsaufbau und Schichtlagerung im Hinblick auf das Relief
Ausschlaggebend für den Gesteinsaufbau und die Schichtlagerung der Schwäbischen Alb ist die Widerstandsfähigkeit des dort anstehenden Gesteinspakets.
Die Mächtigkeitsverhältnisse schwanken zwischen Erms und Fils stark. Die Gesamtmächtigkeit beträgt im Untersuchungsgebiet etwa 750m. Davon entfallen auf den Schwarzjura oder Lias im Durchschnitt 100 m, den Braunjura (Dogger) 300m und den Weißjura ca. 350m.
Der Schwarzjura steht im Vorland der Alb an. Er tritt als Flächenbildner im Albvorland weiträumig in Erscheinung, vor allem die widerstandsfähigen Sandsteine der unteren Liasplatte, 30-40m über dem Keuper, die eine Stufe bilden.
Der Schwarzjura besteht weitgehend aus kalkigen Sandsteinen aber auch aus Tonen, Mergel und Schiefer, die durch Schwefelkies und Bitumen (fein verteiltes Erdöl) dunkelgrau gefärbt sind. Die Tone der Braunen Jura haben ähnliches Aussehen wie die des Lias und werden nach oben hin zunehmend sandig. Der Braune Jura bildet den Untergrund und besteht überwiegend aus wasserstauenden Tonen, vereinzelt auch Kalk und Siderit.
Die Gesteine des Weißen Jura , welche die eigentliche Stufenrandzone der Schwäbischen Alb aufbauen, zeigen die Wechsellagerung zwischen widerstandsfähigen Kalken und weichen Mergelschichten. In der Schwäbischen Alb sind in den hellgrauen Mergelschichten (weich) der weißen Jura ab und zu Riffkalke eingelagert.
Sie bilden zu den gebankten Kalken (hart) der weißen Jura (Malm) in sofern einen Gegensatz, als sie sich über das Niveau der Bankkalke erheben. Die Riffkalke des Malm sind von größerer Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Angriff von Erosion als die Bankkalke und sie treten morphologisch im Relief der Albhochfläche als Kuppen in Erscheinung. Von besonderer Bedeutung ist ihr Vorkommen jedoch für die Ausbildung von Trauf- oder Walmstufen an der Stufenrandzone der Schwäbischen Alb und ihrer Talhänge.
Als Gesteinsformen treten im Albvorland die obersten drei Formationen des Keupers auf, gefolgt von dem Schwarzen Jura und dem Braunen Jura. Der Weiße Jura, der die letzte Schichtstufe des südwest-deutschen Schichtstufenlands aufbaut, bildet den Anstieg und die Hochfläche der Schwäbischen Alb.
Im allgemeinen wird die Stufenkannte der Alb aus den mittelkimmeridgen Kalken aufgebaut. Auf dem Grund des häufigen Wechsels zwischen geschichteter und verschwammter Fazies in diesen Kalken sind auch die Mächtigkeitsverhältnisse starken Schwankungen unterworfen. Die Folge davon sind unterschiedliche Schichtstufentypen am Albtrauf und ein unruhiges Relief der Albhochfläche. So verursachen die verschwammten Riffkalke eine unruhige, kuppige Landschaft, die sogenannte Kuppenalb, während sich die geschichteten Sedimente durch verhältnismäßig ebene Flächen abzeichnen.
Die ältesten zutage tretenden Schichten der Schwäbischen Alb sind die Keuperschichten im Filstal.
In entscheidenden Ausmaßen hat sich die flußgeschichtliche Entwicklung auf die Oberflächengestalt der Hochfläche der Schwäbischen Alb als auch auf das Vorland ausgewirkt. Zwischen diesen beiden Regionen spiegelt die Stufenrandzone deutlich den Kampf zwischen Rhein und Donau wieder, den beiden Vorflutern des gesamten Gewässernetzes. Es stehen die jungen, engen rheinischen Stirntäler mit ihren Schotterterrassen den alten, südostwärts gerichteten, breit angelegten wannenförmigen Tälern gegenüber, welche im Bereich der Filsalb ebenfalls durch Terrassen altersmäßig einzustufen sind. An mehreren Stellen schneidet der Stufenrand der Schwäbischen Alb die alten Flußläufe an, sie sind dadurch geköpft. Vereinzelt haben sich die zum Neckar orientierten Gewässer auch in die alten Tallandschaften zurückverlegt. Die Stufenrandzone wurde dadurch gebuchtet, Berghalbinseln und Ausläufer entstanden.
4 Der Verdichtungsraum Stuttgart
1. Standort: Stuttgart Hafen
- der Hafen liegt im Stadtteil Esslingen/Untertürkheim
- es ist ein Binnenhafen, gelegen am Neckar
- umgesetzt werden Massengüter wie Erze, Kohle, Mineralöle und Chemikalien, teilweise auch Stückgüter (z.B. Eisen o. Stahl) sowie Güter für die nah gelegene Automobilindustrie
- Hafentypische Merkmale wie Be- u. Entladekräne, Kaimauern und Leichter (motorlose Schubeinheiten) sind erkennbar, dazu kommen Raffinerien, Büro- u. Verwaltungsgebäude
- aufgrund einer schlechten Verkehrsanbindung (zu weit innerstädtlich, A8 ist nur über den Zubringer B10 zu erreichen) und der geringeren Bedeutung des Neckars als Transportweg, kann dem Stuttgarter Hafen kein zu hoher Stellenwert zugewiesen werden
2. Standort: Fasanenhof
- liegt im Süden Stuttgarts und stellt ein Polyzentrum dar, we il es sich um eine Wohn- u. Industriestadt handelt (vorwiegend allerdings Wohnstadt mit eigenen Versorgungszentren)
- der Fasanenhof ist dominant durch die Standortvorteile seiner räumlichen Lage geprägt, zum einen die Nähe zur sich dynamisch entwickelnden Großstadt, zum anderen die beträchtlichen Flächenreserven innerhalb der bedeutungsvollen Entwicklungsachsen
- hinzu kommt eine besondere Verkehrsgunst durch unmittelbaren Anschluß an die Autobahn A8
- im Vergleich zu anderen Städten ist der Fasanenhof als ein Vertreter jenes genetischen Stadttyps zu bezeichnen, der im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach dem II. Weltkrieg (3. Industrialisierungsphase) aus einem Dorf hervorgegangen ist
- die Nähe zum städtischen Zentrum Stuttgart (hochrangiges Angebot an Einkaufs- u. Unterhaltungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze) birgt allerdings auch den Nachteil der "Schattenlage" und Reduktion als reine Wohnstadt
- aufgrund der wirtschaftlichen und besonders gesellschaftlichen Entwicklung sowie infolge städtischem Einfluß aus dem benachbarten urbanen Innovationszentrum ergibt sich für den Fasanenhof fast zwangsläufig der strukturelle Wandel von Verstädterung und Suburbanisierung
3. Standort: Stuttgart Innenstadt
- die Stadt Stuttgart hat sich in einer Bucht entwickelt, wo ursprünglich noch keine Nähe zum Neckar bestand, die Entwicklung vollzog sich Rund um das Stuttgarter Schloß herum
- es gibt ein weit verzweigtes Straßenbahnnetz und einen großen Hauptbahnhof, wo man zur Zeit an neuen Konzepten arbeitet, um den Menschen höhere Funktionalität und Komfort zu bieten und somit den Besuch der Innenstadt als Erlebnis und Erholung zu gestalten und nicht als "streßige" Pflicht
- im Bereich des Schlosses findet man großzügige Parkanlagen und altertümliche Gebäude, die meistens der Legislative zugeteilt sind
- weiter findet man in der Innenstadt typische Plätze an den sich eine Spezialisierung auf bestimmte Bereiche wie Versicherungen und Banken, Dienstleistungsbetriebe, Geschäfte für den täglichen Bedarf, Luxusartikel und Verwaltung vollzogen hat, diese Bereiche unterscheiden sich auch im Ausdrucksbild der Gebäude
5 Strukturmerkmale eines Verdichtungsraumes am Beispiel Stuttgart
Die Region "Mittlerer Neckar" ist dominant geprägt durch den Verdichtungsraum der Landeshauptstadt Stuttgart und den angrenzenden Randzonen, zum Beispiel Ludwigsburg, Esslingen und Tübingen.
Verdichtungsraum meint eine regionale Konzentration von Einwohnern und Arbeitsplätzen mit entsprechender Bebauung und Infrastruktur.
Das Ballungszentrum Stuttgart weist folgende auffällige Arbeitsplatzstrukturmerkmale auf. In der Region Stuttgart waren mit Stand vom 30.06.95 insgesamt 1 040 284 Personen beschäftigt, hiervon fallen auf den Primärsektor 7 286, den Sekundärsektor 496 547 und auf den Tertiärsektor 536 451Beschäftigte.
Generell ist die Zahl der Arbeitsplätze leicht rückläufig, wobei sich das Arbeitsplatzangebot vom sekundären (Produzierendes Gewerbe) zum tertiären Sektor ("Dienstleistungsgesellschaft") hin verschiebt. Die Gründe für die rückläufigen
Beschäftigungszahlen im Produzierenden Gewerbe liegen zum einen in der Substitution menschlicher Arbeitskraft und zum anderen im zunehmenden Personalkostendruck.
Auffällig ist die Konzentration von Dienstleistungen im Stadtkern. Produzierende Betriebe wurden in die Randzonen des Ballungsgebietes ausgesiedelt.
Das Ballungszentrum Stuttgart hat einen Einpendlerüberhang von 176 500 Arbeitnehmern (210 000 Einpendler - 33 500 Auspendler). Die gesamte Region dagegen hat nur einen Einpendlerüberhang von 64 00 Personen (659 000 Einpendler - 595 000 Auspendler).
Zur Bevölkerungsentwicklung sind folgende Aussagen zu treffen, der Verdichtungsraum Stuttgart gehört zu den Wegzugsgemeinden, d.h. die Wohnfunktion wird mehr und mehr in die Randzonen ausgelagert. Gründe hierfür sind steigende Mietpreise, Erschöpfung der allgemeinen Wohnkapazität und die bessere Wohnqualität.
Die Bevölkerungs- u. Siedlungsentwicklung im Oberzentrum Stuttgart kann grob in 4 Phasen untergliedert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Links:
- Institut für Geologie und Paläontologie Stuttgart (mit der kompletten geologischen Abhandlung Baden-Württembergs zum download)
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Themenschwerpunkte in Mainfranken?
Die Themenschwerpunkte in Mainfranken umfassen naturräumliche Aspekte des Maintals, typische Siedlungsformen und die Entwicklung im Maintal.
Welche naturräumlichen Aspekte des Maintals werden behandelt?
Behandelt werden die Kastentalstruktur des Maintals, die Böden in Talsohle, Hängen und Hochfläche, sowie das Klima, insbesondere die Lee-Lage des Maindreiecks und dessen subkontinentales Klima.
Welche Siedlungsformen sind typisch für das Maintal?
Typische Siedlungsformen umfassen komplett ummauerte Dörfer, enge Gassen, Kopfsteinpflaster und alte Bausubstanz wie Heckerhäuser.
Wie hat sich das Maintal entwickelt?
Die Entwicklung umfasste Handel, Zollstellen und Weinbau. Der Funktionswandel durch den Bedeutungsverlust des Mains als Transportweg führte zur Stagnation, Erhalt der alten Bausubstanz und schließlich zur Entwicklung des Tourismus.
Was wird im Urweltmuseum Holzmaden ausgestellt?
Das Museum zeigt die fossile Lebewelt des Jurameers, insbesondere Versteinerungen aus der Jurazeit, wie Saurier, Fische, Muscheln und Pflanzen.
Wie ist die Schwäbische Alb aufgebaut und wie alt ist sie?
Die Schwäbische Alb besteht aus einem Grundgebirgssockel aus Granit und Gneis, auf dem die Schichtstufen des Schwäbischen Jura lagern. Der Schwäbische Jura ist etwa 800m mächtig und unterteilt sich in Schwarzen, Braunen und Weißen Jura.
Welche Bedeutung haben die Fossilienfunde für die Wissenschaft?
Die Fossilienfunde geben Einblicke in die damalige Tier- und Pflanzenwelt, das Klima, die Temperatur- und Strömungsverhältnisse, die Entwicklungsstufen der Gattungen sowie die geologischen Verhältnisse.
Was ist das Besondere am Wental?
Das Wental ist ein Trockental, das durch Verkarstung entstanden ist. Auffällig sind die Dolomitfelsen, die dem starken Oberflächenabfluss während der Eiszeiten widerstanden.
Was versteht man unter einer Schichtstufenlandschaft?
Eine Schichtstufenlandschaft ist ein geomorphologischer Landschaftstyp, der sich aus einer Abfolge von Schichtstufen zusammensetzt, die durch Dachflächen getrennt sind. Die Entwicklung der Schichtstufen hängt von Gesteinsart, Mächtigkeit der Gesteinsschichten und Neigung ab.
Welche Strukturmerkmale hat der Verdichtungsraum Stuttgart?
Der Verdichtungsraum Stuttgart zeichnet sich durch eine Konzentration von Einwohnern und Arbeitsplätzen, entsprechende Bebauung und Infrastruktur aus. Auffällig ist die Verlagerung von Arbeitsplätzen vom sekundären zum tertiären Sektor, ein Einpendlerüberhang und die Auslagerung der Wohnfunktion in die Randzonen.
Welche Phasen der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung gab es im Oberzentrum Stuttgart?
Die Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung kann grob in 4 Phasen unterteilt werden (Abbildung in der Leseprobe nicht enthalten).
Was sind die Strukturmerkmale eines Verdichtungsraumes am Beispiel Stuttgart?
Die Region "Mittlerer Neckar" ist dominant geprägt durch den Verdichtungsraum der Landeshauptstadt Stuttgart und den angrenzenden Randzonen, zum Beispiel Ludwigsburg, Esslingen und Tübingen.
Wie ist die Arbeitsplatzstruktur in Stuttgart?
In der Region Stuttgart waren im Juni 1995 insgesamt 1.040.284 Personen beschäftigt, davon 7.286 im Primärsektor, 496.547 im Sekundärsektor und 536.451 im Tertiärsektor.
- Quote paper
- Henning Schwarze (Author), 1997, Mittlerer Neckarraum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96276