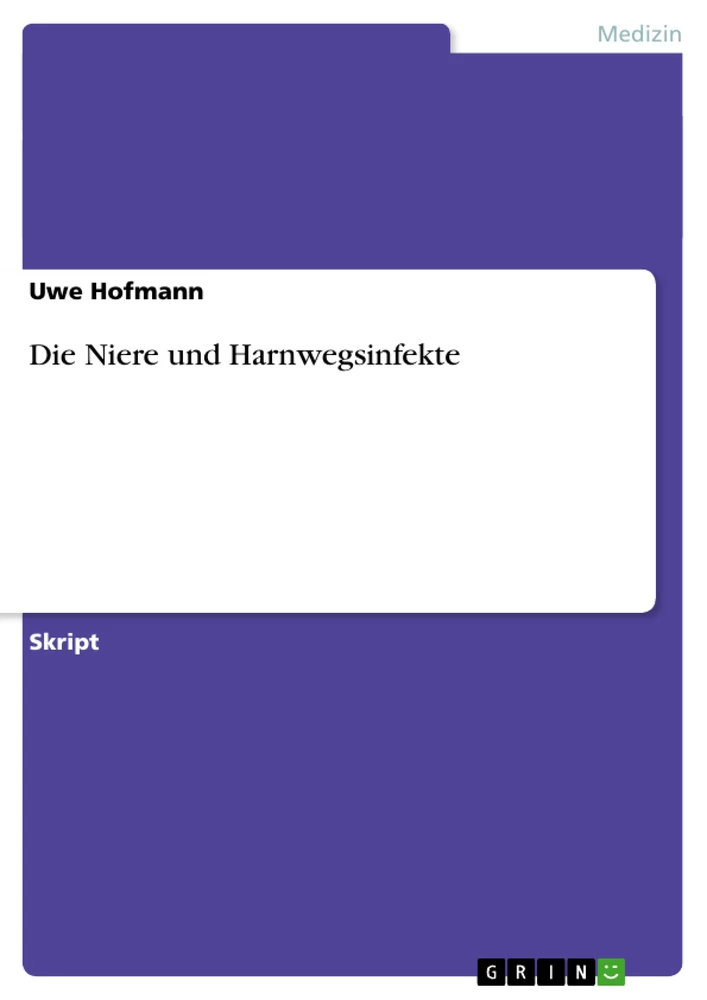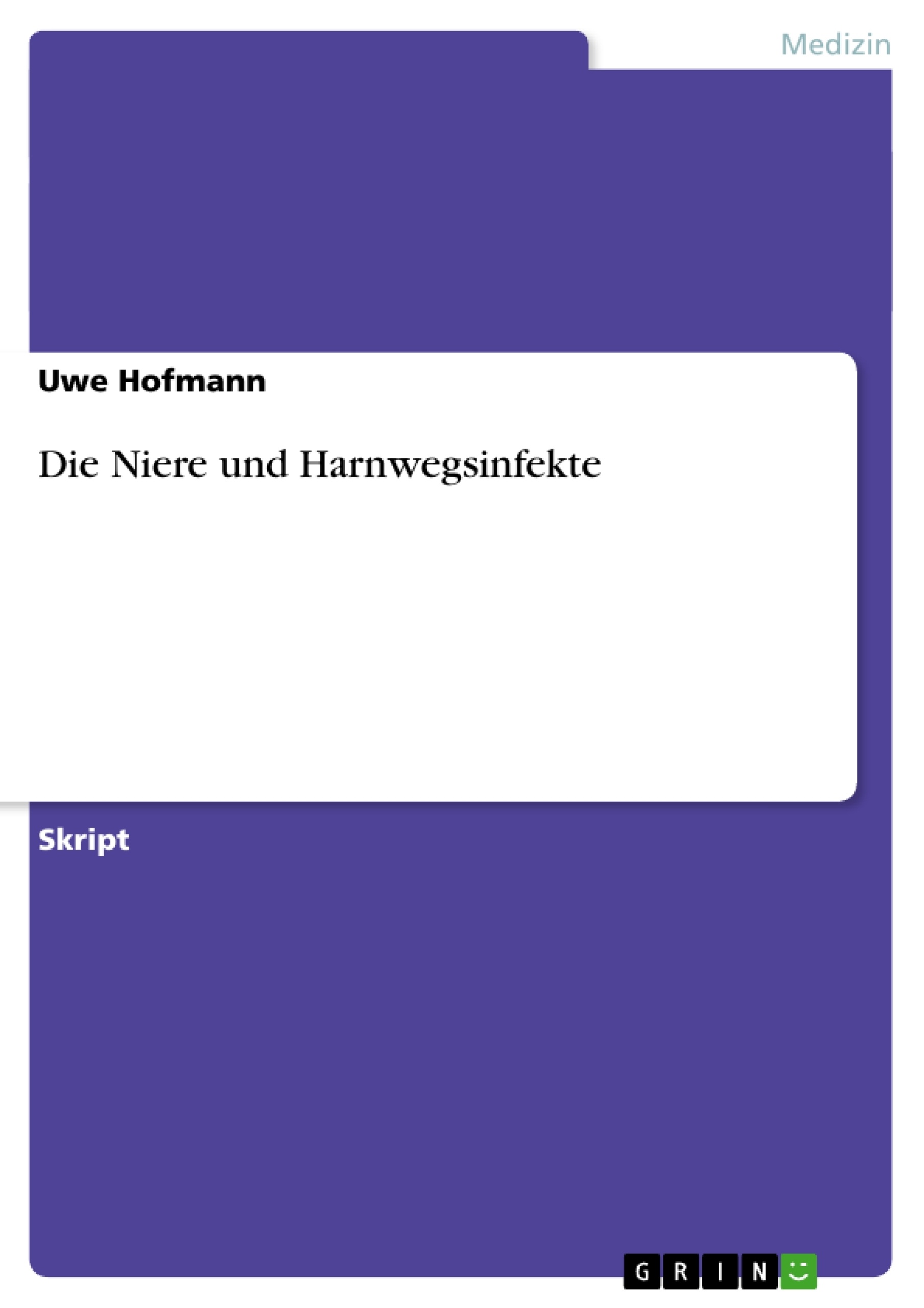Die Niere
1. Lage
- retroperitoneal
- in der Längsachse leicht gekippt
- eingehüllt in eine derbe Organkapsel, gelagert in lockerem Fett- und Bindegewebe
- dem oberen Pol liegt die Nebenniere auf
2. Form
- Bohnenförmig
- 10 - 14 cm lang, 5 - 7 cm breit, 4 - 5 cm stark
- hat oberen und unteren Nierenpol
- medialer / lateraler Rand
- Gewich 120 - 300 g
- Nierenpforte an eingedellter Seite (medial) mit Gefäße, Nerven und Nierenbecken
3. Aufbau
- im Längsschnitt zeigen sich Nierenrinde und Nierenmark
- Rinde enthält die Nierenkörperchen, sowie die Anfangs- und die Endstücke der Nie- renkanälchen
- Mark wird von 10 - 12 Nieren- (Mark-)Pyramiden gebildet. Die Grundfläche der Py- ramiden geht Richtung Rinde und läuft in Markstrahlen (den gebündelten Sammel- rohren) zu den Nierenkelchen aus. Die Pyramidenspitzen bilden die Nierenpapillen und münden in die Nierenkelche ein.
- Die Nierenkelche bilden große Teile des Nierenbeckens
4. Aufgaben
- Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen
- Elyt-Haushalt (Na, K), Säure-Basen-Haushalt, Wasserhaushalt, osmotischer Druck
- Kreislaufregulation, Blutbildungsstimmulation
5. Begriffe
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
6. Hormone, die auf die Niere einwirken
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
7. Hormone, die die Niere selbst produziert
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8. Harnwegsinfekte
8.1 Pyelonephritis (= Nieren-Nierenbecken-Entzündung)
Inzidenz: 1% der Jungen; 4 - 5% der Mädchen
Ursache: meist aufsteigende Infekte. V.a. im Säuglingsalter auch hämatogen gestreut Beg. Faktoren sind jegliche Harnwegsobstruktionen und Restharnbildung (durch Reflux, Di- vertikel, Innervationsstörungen
Unterscheidung:
a) komplizierte Harnwegsinfekte
- durch anatomisch und / oder funktionell auffällige Harnwege
- mit Restharnbildung, Divertikel, Obstruktion, neurogene Blase (Innervationssörung), Blasenektrophie
- auch bei Schwangeren wegen Obstruktion durch Uterus
b) unkomplizierte Harnwegsinfekte
- symptomatische Harnwegsinfekte
→ Bakteriurie und Leukozyturie mit klinischen Symptomen
- asymptomatische Harnwegsinfekte
→ Bakteriurie und Leukozyturie ohne klinische Symptome
- isolierte Bakteriurie
→ Bakteriurie ohne Leukozyturie und ohne Klinik
- Harnwegsinfekte ohne Fehlbildungen
→ Infekt der unteren Harnwege bei anatomisch und funktionell normalen Harnwegen
Die Beurteilung in der Diagnostik erfolgt nach sicheren und unsicheren Kriterien:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Klinik:
- Dysurie
- Polakissurie
- Sekundäre Enuresis
- Fieber
- Bei PN: v.a. hohes Fieber und Flankenschmerz
- Häufig auch asymptomatisch, jedoch altersabhängig:
- Bis sechs Monate: Apettitlosigkeit, Gedeihstörung, Durchfall und Fieber
- Bis 24 Monate: Fieber, Apettitlosigkeit, Durchfall
- Bis 12 Jahre: Fieber, Polakissurie, Enuresis, Bauchschmerz
Erreger der unkomplizierten Harnwegsinfekte:
Hauptsächlich E. coli (O- und K-Antigen)
Proteus, Enterokokken, Klebsiellen, Pseudomonas
Erreger bei komplizierten Harnwegsinfekte v.a. Problemkeime
Komplikationen:
Treten v.a. bei Reflux auf.
Bei nichtbehandelter PN: Narbenbildung mit Funktionsverlust der Niere
Hypertoie, Blasenwandverdickung und höckrige Oberfläche; funktionelle Störungen
(Comliance sinkt, Dranginkontinenz, nächtliches Einnässen)
Therapie:
Je nach erwartetes Erregerspektrum mit Aminopenicilline (Trimethoprim → Trimanyl‚, Amoxicillin → Amoxypen[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten], Cephalosporine)
8.2 Glomeruläre Nephropathien
Ursachen:
- genetische Disposition
- Immunologisch durch
- Ablagerung von Immunkomplexen
- Alternative Aktivierung des Komplementsystems
- Antikörperbildung gegen Basalmembran
- Toxine (Scharlachstreptokokkentoxine führen zu einer Steigerung der Gefäßpermea- bilität →Streptococcus pyogenes)
Klinik:
- Nephritisches Syndrom
Symptomenkomplex aus Hämaturie, leichte bis mittlere Proteinurie, Einschränkung der Filtration und Hypertonie
- Nephrotisches Syndrom
Erhöhte Durchlässigkeit der Basalmembran für Proteine. Symptomenkomplex aus star- ker Proteinurie (überwiegend Albumin) → Hypalbuminämie, Hypovolämie bei gene- ralisierter Ödembildung (anfangs meis Lidödem); Hyperlipidämie.
- Leitsymptome
Periorbitale Ödeme, Beinödeme, Aszites, Pleuraerguß
8.2.1 akute Glomerulonephritis
immunologische Krankheit, die meist auf Antikörperbildung gegen Bestandteile der Nierenglomerula beruht.
8.2.1.1. Poststreptokokken-GN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.2.1.2 rasch progressive GN
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
8.2.2 Nephrotisches Syndrom-verbundene Erkrankungen
Hierzu zählen:
- Minimal-change-GN (77,4%)
- Membranöse GN (6,7%)
- Membrano-proliferative GN (6,2%)
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Lage der Niere?
Die Niere liegt retroperitoneal und ist in der Längsachse leicht gekippt. Sie ist von einer derben Organkapsel umgeben und in lockerem Fett- und Bindegewebe gelagert. Dem oberen Pol liegt die Nebenniere auf.
Wie ist die Form und Größe der Niere?
Die Niere ist bohnenförmig, 10-14 cm lang, 5-7 cm breit und 4-5 cm dick. Sie hat einen oberen und unteren Nierenpol, einen medialen und lateralen Rand, und wiegt 120-300g. An der medialen Seite befindet sich die Nierenpforte mit Gefäßen, Nerven und Nierenbecken.
Wie ist die Niere aufgebaut?
Im Längsschnitt zeigt die Niere Nierenrinde und Nierenmark. Die Rinde enthält die Nierenkörperchen, sowie die Anfangs- und Endstücke der Nierenkanälchen. Das Mark wird von 10-12 Nieren-(Mark-)Pyramiden gebildet. Die Grundfläche der Pyramiden geht Richtung Rinde und läuft in Markstrahlen zu den Nierenkelchen aus. Die Pyramidenspitzen bilden die Nierenpapillen und münden in die Nierenkelche ein. Die Nierenkelche bilden große Teile des Nierenbeckens.
Welche Aufgaben hat die Niere?
Die Niere ist verantwortlich für die Ausscheidung harnpflichtiger Substanzen, den Elektrolyt-Haushalt (Na, K), den Säure-Basen-Haushalt, den Wasserhaushalt, den osmotischen Druck, die Kreislaufregulation und die Blutbildungsstimulation.
Was ist Pyelonephritis?
Pyelonephritis ist eine Nieren-Nierenbecken-Entzündung, meist verursacht durch aufsteigende Infekte. Risikofaktoren sind Harnwegsobstruktionen und Restharnbildung.
Was sind die Ursachen glomerulärer Nephropathien?
Die Ursachen sind genetische Disposition, immunologische Faktoren (Ablagerung von Immunkomplexen, Aktivierung des Komplementsystems, Antikörperbildung gegen Basalmembran) und Toxine.
Was ist das Nephritische Syndrom?
Ein Symptomenkomplex aus Hämaturie, leichter bis mittlerer Proteinurie, Einschränkung der Filtration und Hypertonie.
Was ist das Nephrotische Syndrom?
Erhöhte Durchlässigkeit der Basalmembran für Proteine. Symptomenkomplex aus starker Proteinurie (überwiegend Albumin), Hypalbuminämie, Hypovolämie bei generalisierter Ödembildung und Hyperlipidämie. Leitsymptome sind periorbitale Ödeme, Beinödeme, Aszites und Pleuraerguß.
Was ist akute Glomerulonephritis?
Eine immunologische Krankheit, die meist auf Antikörperbildung gegen Bestandteile der Nierenglomerula beruht. Beispiele sind Poststreptokokken-GN und rasch progressive GN.
Welche Erkrankungen sind mit dem Nephrotischen Syndrom verbunden?
Hierzu zählen Minimal-change-GN, Membranöse GN und Membrano-proliferative GN.
- Citation du texte
- Uwe Hofmann (Auteur), 1999, Die Niere und Harnwegsinfekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96329