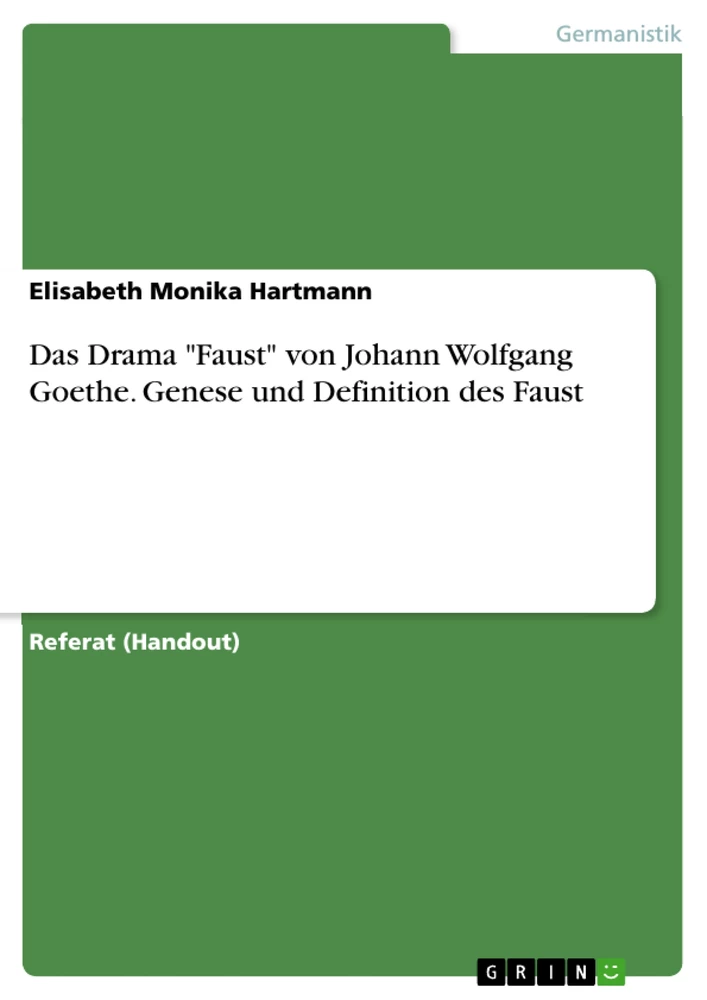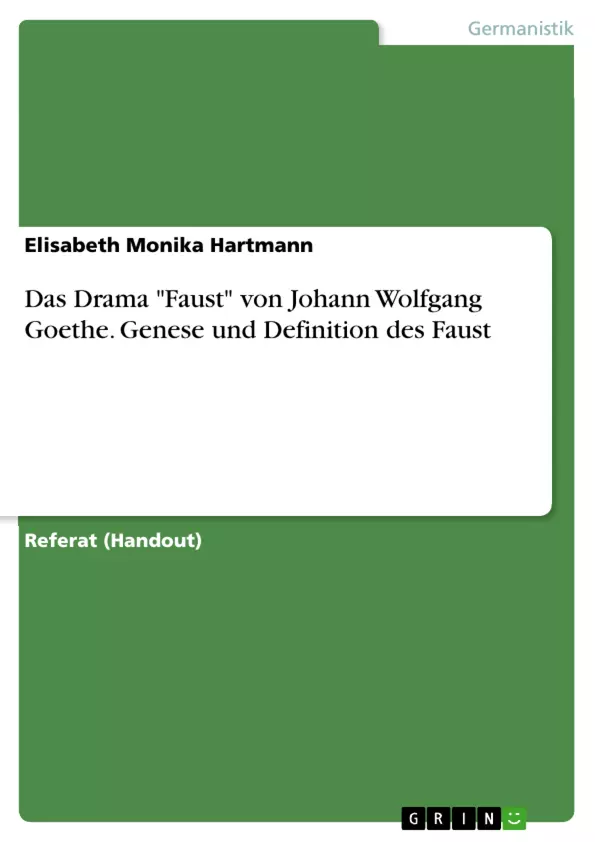Wer war Faust?
Die Beantwortung der Fragen, woher Faust denn käme, welche Rolle er innerhalb der Gesellschaft gespielt haben muss beziehungsweise ob man überhaupt ein historisches Profil des Faust erstellen kann, stellt in Forschungskreisen eine Schwierigkeit aufgrund der Pluralität an verschiedenen Fassungen dar.
Der Grund dafür liegt wiederum in der Diskrepanz zwischen der ursprünglichen oralen Tradition, denen die Sagen um den Zauberer Faust angehörten, und der späteren Schriftkultur.
Dies beeinflusste auch die Rezeption der Sagen in den verschiedenen Künsten, wie dem Puppenspiel, Ballett oder der Musik.
Kuno Fischer schlägt deshalb folgenden theoretischen Ansatz als geeignete Methode der Analyse vor:
„Es ist die historisch-kritische oder, deutlich zu reden, die entwicklungsgeschichtliche Methode, die wir auf unseren Gegenstand anwenden müssen, um die Wege unserer Untersuchung zu ordnen.“
Warum sich dieser Stoff, trotz ausländischer Einflüsse, zu einem nationalen Mythos entwickelt hat, liegt in der Tatsache, dass der Ursprung der Volkssagen auf deutschem Boden in den „Magussagen“ zu finden ist und Einflüsse aus der germanischen beziehungsweise nordischen Mythologie vorhanden sind.
Der Philosoph Kuno Fischer erklärt diesbezüglich in seiner Abhandlung über die Faustsage vor Goethe: „(…) das Wort „Zaubersage“ ist nicht üblich, darum brauche ich den Ausdruck „Magussage“.)“
Diese Magussagen wandeln ihre Gestalt nach der Gemütsart der Zeitalter, denen sie sich anpassen.
Inhaltsverzeichnis
- Die Faustsage vor Goethe
- Antike und Mittelalter
- Neuzeit/ 16. Jahrhundert
- 17. Jahrhundert
- 18. Jahrhundert
- Die Entstehung des Faustdramas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Faustsage vor Goethe und die Entstehung von Goethes Faustdrama. Sie beleuchtet die verschiedenen Versionen der Faustsage, ihre historischen und kulturellen Einflüsse, und analysiert die Einflüsse verschiedener Epochen auf die Gestaltung des Faustdramas.
- Die Entwicklung der Faustsage von der oralen Tradition zur schriftlichen Überlieferung
- Der Einfluss der Magussagen und der germanischen Mythologie auf die Faustfigur
- Die Veränderungen des Faustbildes im Laufe der Jahrhunderte
- Die Rolle der sozialen, religiösen und politischen Kritik in den verschiedenen Fassungen
- Die literarischen und philosophischen Einflüsse auf Goethes Faustdrama
Zusammenfassung der Kapitel
Die Faustsage vor Goethe: Dieses Kapitel erforscht die vielschichtigen Ursprünge der Faustsage, beginnend mit der oralen Tradition und deren Entwicklung durch die Jahrhunderte. Es analysiert, wie die Figur des Faust sich im Laufe der Zeit verändert hat, von einem Zauberer der Antike und des Mittelalters, über die Einflüsse der Reformation und des 16. Jahrhunderts, bis hin zu den lustigen Figuren des 17. Jahrhunderts, die soziale und politische Kritik vermittelten. Die Untersuchung unterstreicht die Vielfalt der Interpretationen und die Schwierigkeiten, ein eindeutiges historisches Profil des Faust zu erstellen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Sage als nationaler Mythos auf deutschem Boden, mit Einflüssen aus der germanischen Mythologie und den Magussagen.
Die Entstehung des Faustdramas: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung von Goethes Faustdrama und die Vielschichtigkeit seiner Grundidee. Es untersucht, wie Goethe den vorhandenen Stoff verarbeitete und mit eigenen Erlebnissen und Ideen bereicherte. Die Analyse zeigt, wie Goethes Faust ein dynamisches Werk ist, dessen Held ein Abbild des Dichters selbst darstellt. Das Kapitel beleuchtet den Einfluss verschiedener Epochen der Aufklärung – Sturm und Drang, Weimarer Klassik und Romantik – auf die Gestaltung des Dramas, sowie die philosophischen und religiösen Aspekte des Werkes. Die Analyse des Mephisto als repräsentative Figur für bestimmte menschliche Wesenszüge, und die Frage nach der Genrezugehörigkeit des Dramas (Tragödie, heroische oder komische Dichtung) werden ausführlich erörtert. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Überwindung des Zauberwesens und des christlichen Glaubens in Goethes Interpretation.
Schlüsselwörter
Faustsage, Magussagen, germanische Mythologie, Goethe, Faustdrama, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Romantik, Teufelspakt, Zauberei, Magie, religiöse Kritik, soziale Kritik, politische Kritik, literarische Entwicklung, nationale Mythos.
FAQ: Entwicklung der Faustsage und Goethes Faustdrama
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Dieser Text bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der Faustsage vor Goethe und die Entstehung seines Faustdramas. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel ("Die Faustsage vor Goethe" und "Die Entstehung des Faustdramas") sowie eine Liste der Schlüsselwörter.
Welche Epochen werden in Bezug auf die Faustsage behandelt?
Der Text behandelt die Faustsage von der Antike und dem Mittelalter über die Neuzeit (16. Jahrhundert), das 17. und 18. Jahrhundert bis hin zur Entstehung von Goethes Faustdrama. Die Entwicklung der Sage über die Jahrhunderte hinweg wird detailliert untersucht.
Welche Themen werden im Zusammenhang mit der Faustsage behandelt?
Die behandelten Themen umfassen die Entwicklung der Faustsage von der mündlichen Überlieferung zur schriftlichen Fixierung, den Einfluss von Magussagen und germanischer Mythologie, die Veränderungen des Faustbildes im Laufe der Zeit, die Rolle sozialer, religiöser und politischer Kritik in verschiedenen Fassungen sowie die literarischen und philosophischen Einflüsse auf Goethes Faustdrama.
Wie wird die Entstehung von Goethes Faustdrama behandelt?
Die Entstehung von Goethes Faustdrama wird im Detail analysiert. Der Text beleuchtet, wie Goethe den vorhandenen Stoff verarbeitete und mit eigenen Erfahrungen und Ideen bereicherte. Es werden die Einflüsse verschiedener Epochen (Aufklärung, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Romantik) sowie die philosophischen und religiösen Aspekte des Werkes untersucht. Die Rolle Mephistos und die Frage nach der Genrezugehörigkeit des Dramas werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text am besten?
Schlüsselwörter sind: Faustsage, Magussagen, germanische Mythologie, Goethe, Faustdrama, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Romantik, Teufelspakt, Zauberei, Magie, religiöse Kritik, soziale Kritik, politische Kritik, literarische Entwicklung, nationaler Mythos.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text besteht aus zwei Hauptkapiteln: "Die Faustsage vor Goethe" und "Die Entstehung des Faustdramas". Das erste Kapitel untersucht die Ursprünge der Faustsage und deren Entwicklung über die Jahrhunderte. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die Entstehung von Goethes Faustdrama und dessen vielschichtige Grundidee.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für akademische Zwecke gedacht und eignet sich zur Analyse der Themen in strukturierter und professioneller Weise. Er bietet eine umfassende Grundlage zum Verständnis der Entwicklung der Faustsage und Goethes Faustdrama.
Wo finde ich mehr Informationen?
Weitere Informationen können durch die Recherche der im Text genannten Schlüsselwörter und Epochen in akademischen Datenbanken und Bibliotheken gefunden werden. Die detaillierte Analyse der einzelnen Epochen und ihrer Einflüsse auf die Faustfigur erfordert weiterführende Literatur.
- Quote paper
- Elisabeth Monika Hartmann (Author), 2009, Das Drama "Faust" von Johann Wolfgang Goethe. Genese und Definition des Faust, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/963478