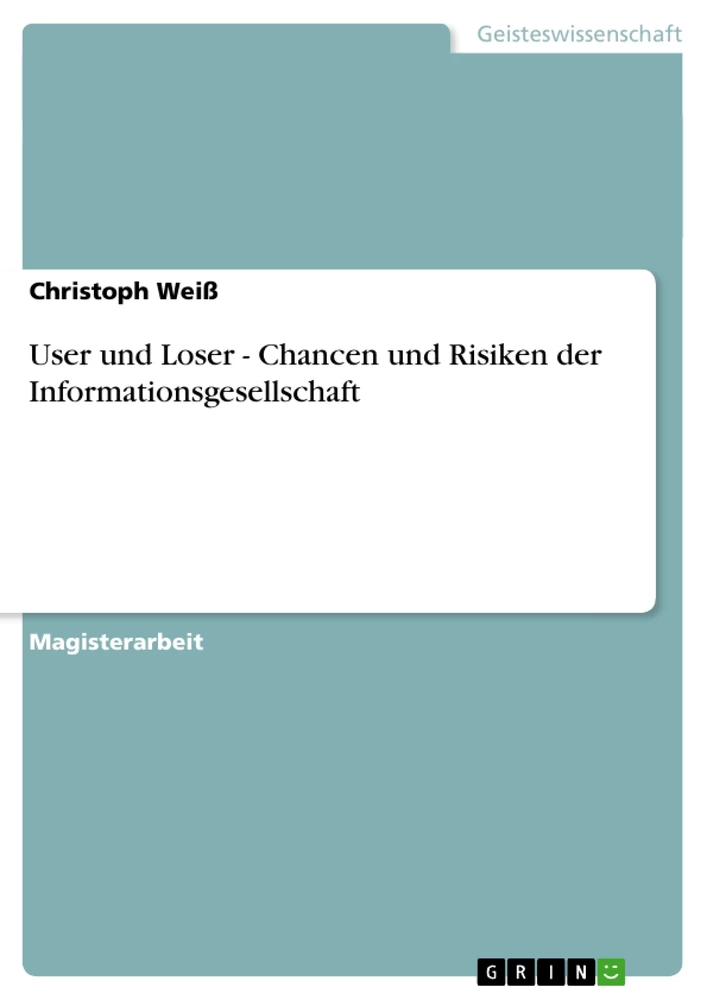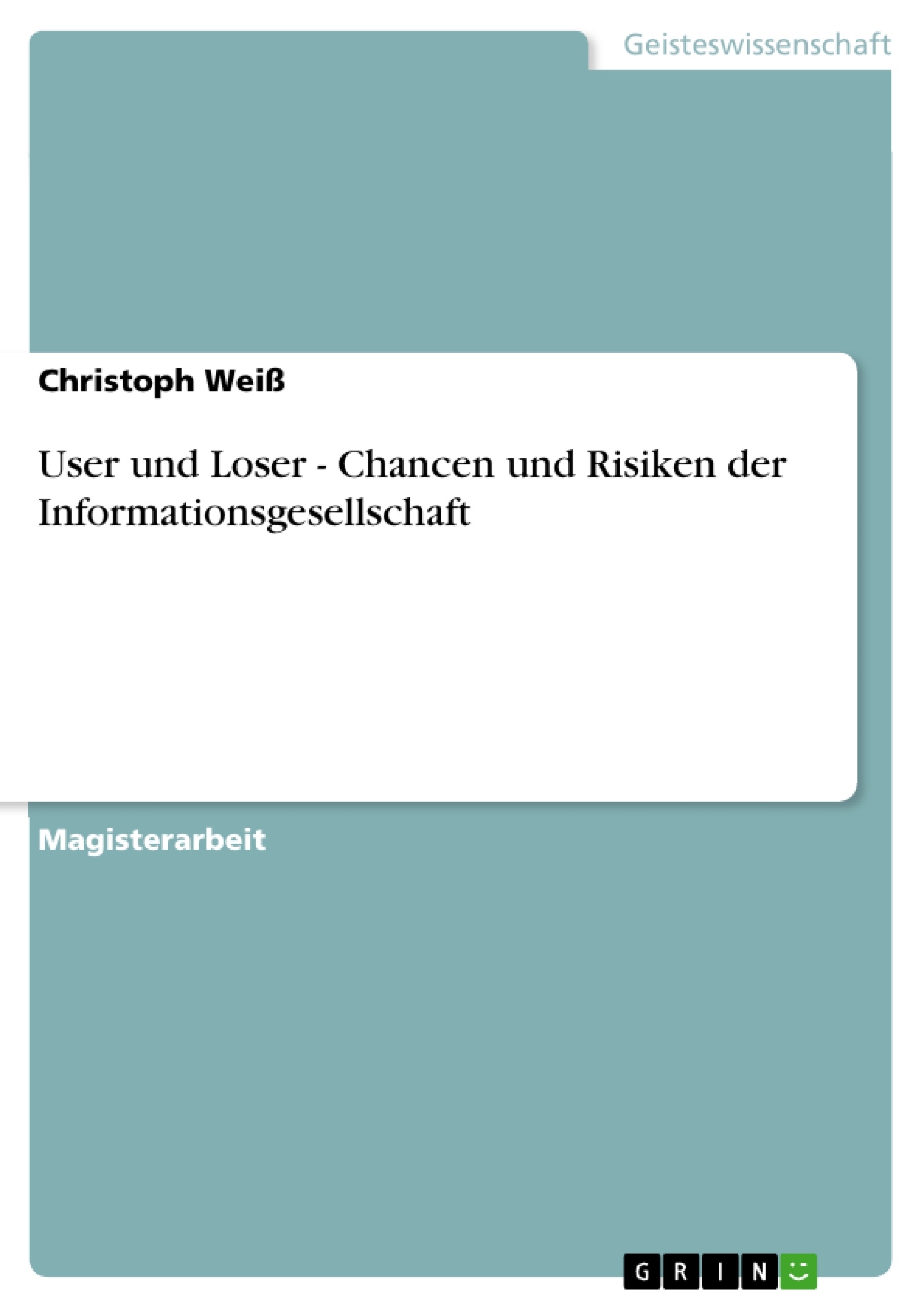In einer Ära, in der Daten im Überfluss vorhanden sind und die digitale Revolution unser Leben unaufhaltsam durchdringt, stellt sich die intriguerende Frage: Navigieren wir wirklich in Richtung einer aufgeklärten Informationsgesellschaft, oder steuern wir auf eine Zukunft zu, die von digitaler Kluft und ungleichem Zugang zu Wissen geprägt ist? Diese tiefgründige Analyse nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die komplexen Theorien der Informationsgesellschaft, von den ökonomischen Modellen, die Information als Handelsware betrachten, bis hin zu den soziologischen Perspektiven, die die potenziellen Risiken der Entfremdung und des Kontrollverlusts beleuchten. Im Fokus stehen die Entwicklung und die transformativen Eigenschaften von Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK), die Interaktivität, Multimedialität und globale Vernetzung ermöglichen. Es werden die vielschichtigen Anwendungsfelder der IuK-Technologien untersucht, von den ökonomischen Potenzialen des E-Commerce und der Virtualisierung des Geldes bis hin zu den flexiblen Arbeitsmodellen der Telearbeit und den innovativen Bildungsansätzen des Telelearnings. Doch diese technologischen Fortschritte sind nicht ohne Schattenseiten. Die Risiken der Informationsgesellschaft werden schonungslos offengelegt, darunter die wachsende Knappheit an Aufmerksamkeit, die potenziellen Folgen für die Arbeitswelt, die Gefahr neuer sozialer Ungleichheiten und die entscheidende Frage nach einem freien und gleichen Informationszugang für alle. Besondere Aufmerksamkeit wird den Schwellen und Barrieren des Informationszugangs geschenkt, von den technischen Voraussetzungen und wirtschaftlichen Hürden bis hin zur Bedeutung von Orientierungsinformationen und Medienkompetenz. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die die Chancen und Herausforderungen der Informationsgesellschaft verstehen und aktiv mitgestalten wollen, um sicherzustellen, dass der digitale Fortschritt nicht zu einer Quelle der Spaltung, sondern zu einem Motor des gesellschaftlichen Wohls wird. Die Schlüsselwörter hierbei sind Informationsgesellschaft, digitale Kluft, Medienkompetenz, Informationszugang, Telearbeit, E-Commerce, Wissen, Internet, Kommunikationstechnologien, soziale Ungleichheit, digitale Revolution und Globalisierung, welche die zentralen Themen des Buches widerspiegeln. Die Analyse mündet in der kritischen Auseinandersetzung mit der These der Informationsüberflutung und der Bedeutung von Orientierungsinformationen, um die komplexen Herausforderungen der digitalen Welt zu meistern und eine inklusive und gerechte Informationsgesellschaft zu gestalten. Die Quintessenz dieser Auseinandersetzung liegt in der Erkenntnis, dass der bloße Zugang zu Information nicht ausreicht, sondern vielmehr die Fähigkeit zur kritischen Bewertung, Selektion und Anwendung von Wissen entscheidend ist, um die Chancen der Informationsgesellschaft voll auszuschöpfen und ihre potenziellen Risiken zu minimieren.
INHALT
1. Einleitung
2. Theorien der Informationsgesellschaft
2.1. „information-economy“-Ansätze
2.2. Informationsgesellschaft als „Dritte Welle“
2.3. Informationsgesellschaft als „postindustrielle Gesellschaft“
2.3.1. „Theoretisches Wissen“ als axiales Prinzip
2.3.2. Die nachindustrielle Gesellschaft als eine Informations- oder Wissensgesellschaft
2.4. Informationsgesellschaft als Ziel der Komplexitätsreduktion
2.5. Zusammenfassung der Theorien zur Informationsgesellschaft
3. Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien
3.1. Die „Informatisierung“ der Gesellschaft
3.2. Die neuen Qualitäten der IuK-Technologien
3.2.1. Interaktiviät
3.2.2. Multimedialität
3.2.3. Globale Vernetzung
3.3. Anwendungsfelder der IuK-Technologien
3.3.1. Ökonomisches Potential
3.3.1.1. Homeshopping
3.3.1.2. Virtuaslisierung des Geldes
3.3.2. Telearbeit
3.3.3. Bildung und Weiterbildung
4. Die Risiken der Informationsgesellschaft
4.1. Die Knappheiten der Informationsgesellschaft
4.2. Folgen der Informationsgesellschaft für die Arbeit
4.3. Freier Informationszugang ?
4.3.1. Schwellen und Barrieren des Informationszugangs
4.3.2. Der Zugang zu Online-Diensten
4.3.3. Orientierungsinformationen
4.3.3.1. Die These von der Informationsüberflutung
4.3.3.2. Die Bedeutung von Orientierungsinformationen
4.3.4. Medienkompetenz
5. Resümee
6. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
“Die Wende zum dritten Jahrtausend unserer Zeitrechnung ist längst zu einer magischen Schwelle geworden, die Zahl 2000 zu einer mystischen Marge” (Vester, H.-G.; 1987; 85). Mit dem Eintritt in ein neues Jahrtausend verbinden sich Vorstellungen über einen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel. Alles wird sich verändern. So lautet das Credo. Der Schritt in das 21. Jahrhundert bringt Hoffnungen und Befürchtungen hervor. Was ist jedoch der Kern der Veränderungen, die wir zu erwarten haben? In was für einer Gesellschaft werden wir in Zu- kunft leben? Die Anworten auf diese Fragen fallen sehr unterschiedlich aus. Neben Begriffen wie Risikogesellschaft (Beck, U.; 1986), Kommunikationsgesellschaft (Münch, R.; 1991), Erlebnisgesellschaft (Schulze, G.; 1992) oder Multioptionsgesellschaft (Gross, P.; 1994) ist vor allem der Begriff der Informationsgesellschaft in den letzten Jahren verstärkt in den Vordergrund gerückt. Allen diesen Gegenwartsbeschreibungen ist gemein, daß sie den gesell- schaftlichen Wandel unter einem bestimmten Aspekt betrachten. Sie versuchen dabei, die zentrale Besonderheit hervorzuheben, welche die Gesellschaft am entscheidendsten bestimmt. Im Falle der Informationsgesellschaft liegt der Fokus auf dem Begriff Information. Es ist zwar klar, daß Information an und für sich “[...] kein neues Phänomen der Menschheitsge- schichte [darstellt]” (Vester, H.-G.; 1987; 85). Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, daß die qualitative und quantitative Bedeutung von Information in den letzten Jahren rapide angestiegen ist. Aus diesem Grund wird zukünftig die Gewinnung, Speicherung und Verar- beitung von Information eine wichtige Rolle spielen.
Der Begriff der Informationsgesellschaft selbst ist damit noch längst nicht hinreichend ge- klärt. Es existieren zahlreiche und teilweise sehr diffuse Vorstellungen darüber, was eigentlich damit gemeint ist.1 “It is still unclear what people mean when they talk about information society. The criteria for information society status are by no means obvious, nor are the characteristics which would set the information societies apart from industrial societies” (William, J. M.; 1995; 3). Hinzu kommt, daß zur Beschreibung der Informationsge- sellschaft eine Vielzahl weiterer Begriffe verwendet werden, mit denen man versucht, die Veränderungen, die auf uns zukommen, zu beschreiben. Eine wahre Flut von Bezeichnungen und Metaphern werden zur Kennzeichnung des “neue Zeitalter” herangezogen. Multimedia- zeitalter, digitale Revolution, Kommunikationsgesellschaft, Cyberspace, Information- Highway (Datenautobahn), Virtuelle Gemeinschaft, globales Dorf, Telepolis, Cybersociety u.a. machen die “babylonische” Sprachverwirrung komplett. All diese Metaphern versuchen, den selben Wandlungsprozeß begrifflich zu fassen. Für Achim Bühl ist dies ein Hinweis auf die Vielschichtigkeit der Veränderungen, die uns erwarten (vergl. Bühl, A.; 1996; 9). Der kleinste gemeinsame Nenner der unterschiedlichen Begriffe und Vorstellungen liegt vielleicht bei der wachsenden Bedeutung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK- Technologien), welche die Entwicklung begleiten und vorantreiben. Immer schneller entwi- ckeln sich diese Technologien und finden in den unterschiedlichsten Bereichen Einlaß. Somit dringen sie in viele Teile unseres alltäglichen Lebens vor und verändern diese nachhaltig.
Die Vorstellung über einen Übergang zu einem neuen Gesellschaftstyp, nämlich der Informa- tionsgesellschaft, beinhaltet Veränderungen in allen oder zumindest den meisten gesellschaftlichen Bereichen. Wodurch es zu einem solchen gesamtgesellschaftlichen Wandel kommt, wird von vielen Autoren meist nur ungenügend begründet. Sie verweisen lediglich auf den gewaltigen Zuwachs an neuen IuK-Technologien (z.B. auf die Wachstumsraten der Computerindustrie) und ihre wachsende Bedeutung für die Gesellschaft. Allein schon deshalb sei es unbestritten, daß sich die modernen Industriesaaten auf dem Weg in eine Informations- gesellschaft befinden. “Little doubt exists among many popular commentators that the advanced nations are entering a new phase: the information society. Forecasts abound of massive social impacts of new information technologies of computing and telecommunication” (Lyon, D.; 1988; VII). Informationsgesellschaft, als eine Revolution auf dem Informations- und Kommunikationssektor verstanden, wird somit lediglich mit sich selbst begründet (vergl. Schröder, K. T. u.a.; 1989; 22). Das allein kann nicht ausreichen, um gesellschaftlichen Wandel zu beschreiben. Oliver Hauf spricht von einem “definitorischen Brachland”. Soziologen, Ökonomen und Politikwissenschaftler “[...] bedienen sich nach Gus- to des amorphen Begriffs Informationsgesellschaft. Instrumentieren ohne zu definieren, scheint das Motto zu lauten. Als Folge einer derartigen ‘Eintopfauffassung der Informations- gesellschaft‘ gibt es keinen Konsens selbst über basale Fragen wie: Leben wir schon in einer Informationsgesellschaft? Oder befinden wir uns erst im Übergang? Wollen wir sie über- haupt? Können wir noch wollen?“ (Hauf, O.; 1996; 70).
Die Diskussion um die Informationsgesellschaft ist von einem großen Optimismus geprägt. Sie ist zum Sinnbild vieler Hoffnungen und Erwartungen geworden. Die Informationsgesellschaft eröffnet neue Handlungsperspektiven und wird als Chance gesehen, Krisen der Moderne zu überwinden. Probleme wie gestiegene internationale Konkurrenz durch einen globalen Weltmarkt, Arbeitslosigkeit, Umweltschäden, übervölkerte Städte, usw. scheinen sich mit der Informationsgesellschaft lösen zu lassen. Aber auch für den einzelnen verspricht die Informationsgesellschaft positive Effekte. Die neuen IuK-Technologien machen das Leben in vielen Bereichen reichhaltiger und komfortabler. Es stellt sich die Frage, ob alle an diesen neuen Handlungsoptionen in gleicher Weise teilhaben werden. Entstehen vielleicht gerade durch sie neue Abhängigkeiten und Zwänge?2
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich damit, die Veränderungen, die den Übergang zur Informationsgesellschaft begleiten, aufzuzeigen. Dabei soll sich die Betrachtung nicht allein auf die neuen technischen Möglichkeiten, die vor allem mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen, beschränken. Vielmehr soll der Blick auf die mit ihnen verbundenen Chancen und Risiken für die einzelnen Menschen gelenkt werden. Ausgehend davon schließt sich die Frage an, welche Voraussetzungen für den einzelnen entscheidend sind, um die neuen Chancen für sich nutzbar machen zu können.
Zunächst wird jedoch in Kapitel 2 der Begriff der Informationsgesellschaft selbst genauer beleuchtet. Anfangs ist bereits auf die Problematik der Begriffsbestimmung hingewiesen worden. Um trotzdem die wesentlichen Merkmale der Informationsgesellschaft herauszustel- len, ziehe ich vier unterschiedliche Theorieansätze zur Beschreibung der Informationsgesellschaft heran. Zunächst greife ich auf die sogenannten „information- economy-Ansätze“ zurück. Diese Theorien haben bei der Beschreibung der Informationsge- sellschaft vor allem die Informationsökonomie im Blick und versuchen, die Informationsgesellschaft mit Hilfe eines wirtschaftlichen Sektorenmodell quantifizierbar zu machen. Andere Ansätze versuchen, die Informationsgesellschaft im Kontext einer universa- len Stadientheorie zu beschreiben. Zu diesen gehört die Theorie von Peter Otto und Philipp Sonntag oder auch die Theorie der „Dritte Welle“ von Alvin Tofflers. Einen weiteren wichti- gen Beitrag für das Verständnis der Informationsgesellschaft leistete Daniel Bell mit seiner Theorie der „postindustriellen Gesellschaft“. Diese wird geprägt von „theoretischem Wissen“, welches als axiales Gesellschaftsprinzip zu einer Quelle von Innovation und zum Ausgangs- punkt gesellschaftlich-politischer Programmatik wird. Schließlich wird die Theorie von Gernot Wesig herangezogen. Angesichts einer wachsenden Komplexität in der modernen Ge- sellschaft sieht er in den Informations- und Kommunikationstechnologien ein Hilfsmittel zur Reduktion von Komplexität. Kapitel 3 beschäftigt sich mit diesen neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Dabei soll nicht nur auf ihren starken Zuwachs und ihre Verbreitung hingewiesen werden, sondern es sollen auch die qualitativen Eigenschaften be- trachtet werden, welche diese Medien zu „neuen Medien“ machen. Weiterhin werden beispielhaft einige Anwendungsfelder der neuen Technologien dargestellt. Schließlich geht es im vierten Kapitel um die Risiken, welche die Informationsgesellschaft in sich birgt. Es wird die Frage gestellt, ob mit der Informationsgesellschaft die Gefahr besteht, daß neue gesell- schaftliche Klüfte entstehen. Dies wird anhand von zwei Bereichen, nämlich dem der Arbeit und des Zugangs zu Information, diskutiert. her. Die neuen Technologien werden diese Probleme nicht lösen, sondern eher verschärfen” (Wersig, G.; 1993; 15).
2. Theorien der Informationsgesellschaft
2.1. „information-economy“-Ansätze
Die frühesten Hinweise auf den Begriff der Informationsgesellschaft finden sich bei den in- formationsökonomischen Ansätze. Diesen Theorien ist gemeinsam, daß sie hauptsächlich technische und ökonomische Aspekte der Informationsgesellschaft in den Vordergrund stel- len. Sie haben ihren Ursprung in den 60er und 70er Jahren in den USA und in Japan. Im Jahre 1963 veröffentlicht der japanische Biologe Tadao Umesao seine Studie mit dem Titel „Joho Sangyo Ron“: „Über Informationsindustrien“. Darin beschreibt er, daß die Informationsin- dustrie zukünftig eine Schlüsselrolle im Modernisierungsprozeß einnehmen würde, die vergleichbar sei mit der der Schwerindustrie beim Übergang zur Industriegesellschaft. Andere Annahmen gehen davon aus, daß in der Informationsgesellschaft neben Arbeit, Kapital und Rohstoffen Information zum vierten entscheidenden Wirtschaftsfaktor wird. Immer kürzere Innovationszyklen verlangen einen immer schnelleren und effektiveren Informationsaus- tausch. Informationsgesellschaft ließe sich demnach folgendermaßen charakterisieren: "Der Begriff ´Informationsgesellschaft´ steht für eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform, in der der produktive Umgang mit der Ressource ´Information´ und die wissensintensive Produktion eine herausragende Rolle spielen. Sie wird an den Entwicklungen und Veränderungen in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Arbeitswelt und Umwelt in besonderer Weise deutlich" (BMWI; 1996; 15).
Um die strukturellen Veränderungen, die mit der steigenden ökonomischen Bedeutung von „Information“ verbunden sind, zu veranschaulichen, wird oftmals auf die Drei-Sektoren- Hypothese 3 zurückgegriffen. Hierbei werden drei Wirtschaftssektoren unterschieden. Der primäre Sektor beinhaltet Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, der Viehhaltung und der Fischerei. Im sekundären Sektor sind Berufe der Industrie und Produktion zusammengefaßt. Schließlich bilden Handel, Dienstleistung und Handwerk den tertiären Sektor, den sog. Dienstleistungssektor (vergl. Wagner, R.; 1996; 2 ff).
Durch gesellschaftlichen Wandel bedingt, gewinnen und verlieren die einzelnen Sektoren an Bedeutung. Zwar ist die Güternachfrage im primären Sektor relativ konstant, jedoch sinkt durch gesteigerte Produktivität und durch technischen Fortschritt der Anteil der Beschäftigten hier stetig. Der Produktionssektor hat zunächst einen Anstieg zu verzeichnen. In der Indust- riegesellschaft sind die meisten Menschen in diesem Sektor tätig. Aber auch hier werden durch technische Neuerungen und Kapitaleinsatz Arbeitskräfte freigesetzt. In dem Maße, in dem der primäre und sekundäre Sektor zurückgeht, gewinnt der tertiäre Sektor immer mehr an Bedeutung. In der Informationsgesellschaft besitzt der Dienstleistungsbereich den größten Beschäftigungsanteil. „Der tertiäre Sektor ist nach Fourastié der arbeitsintensivste Sektor, da eine sehr elastische Nachfragekapazität auf der Basis steigender Einkommen das Erreichen einer Sättigungsgrenze sehr unwahrscheinlich erscheinen läßt“ (Wagner, R.; 1996; 3). Für Wagner entspricht der Dienstleistungssektor einem Informationssektor. Er begründet dies damit, daß Information im volkswirtschaftlichen Sinne mit Dienstleistung gleichzusetzen sei (ebd.; 3). Der Dienstleistungssektor wird jedoch damit zu einem „[...] Sammelsurium von allem, was nicht Schwielen an den Händen [hat]“ (Deutsch, K. W.; 1983; 69). Aus diesem Grund wird zur Beschreibung der Informationsgesellschaft das 3-Sektoren-Modell meistens um einen vierten Sektor, einen Informations- oder Wissenssektor, erweitert. Auch hierbei verläuft die Kurve des vierten Sektors ansteigend gegenüber eines Rückganges der anderen drei Sektoren, wie Abbildung 1 veranschaulicht.
Abbildung 1:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BMWi; 1996; 17.
Fritz Machlup unternimmt 1962 in seiner Studie „ The Production and Distribution of Know- ledge in the United Staates “ den Versuch , die Informationsgesellschaft quantifizierbar zu machen, indem er die „Informationsindustrie“ in fünf Hauptgruppen aufgliedert:
a) Bildung (z.B. Schulen, Büchereien, Universitäten)
b) Kommunikationsmedien (z.B. Massenmedien, wie Radio oder Fernsehen, Werbung)
c) Informationsgeräte (z.B. Computer, Musikinstrumente)
d) Informationsservice (z.B. Recht, Versicherungen, Medizin)
e) andere Informationstätigkeiten (z.B. Forschung und Entwicklung, Non-profit- Aktivitäten)
Mittels dieser Kategorien versucht Machlup den gestiegenen Anteil des Informationssektors am Bruttosozialprodukt der Vereinigten Staaten zu zeigen. Er stellt fest, daß der Anteil dieser Informations- und Wissensindustrien im Jahre 1959 in der USA bei 29 % lag, und dies mit steigender Tendenz.
Marc Porat unterscheidet dagegen in seiner Studie von 1977 zwei Informationssektoren (vergl. ebd.; 11 ff.). Der prim ä re Informationssektor beinhaltet alle Industriezweige, die In- formationen produzieren und verteilen. Hierzu gehören beispielsweise Massenmedien, Bildung, Werbung oder auch Computerhersteller. Mit dem sekund ä ren Informationssektor versucht Porat alle die Tätigkeiten zu erfassen, welche in anderen Industriezweigen vorkom- men, ihren Schwerpunkt jedoch in der Gewinnung und Verbreitung von Information haben. Darunter fallende Berufsgruppen sind zum Beispiel Manager, Sekretärinnen, Rechtsanwälte oder Makler. Diese Art von Informationstätigkeiten fanden bei Machlup noch keine Berück- sichtigung. Die beiden Sektoren grenzt Porat gegen Nicht-Informationsberufe ab. Nach seiner Einteilung lag 1977 der Anteil der Informationstätigkeiten am Bruttosozialprodukt der USA bei über 46 %.
Eine weitere Unterteilung des Informationssektors nimmt die OECD (Organisation for Eco- nomic Cooperation and Development) vor. Sie unterscheidet zwischen Infomationsproduzenten, Informationsverarbeitern, Informationsverteilern und Informations- Infrastruktur-Beschäftigten (verl.: Schröder, K. T. u. a.; 1989; 21 und Bühl, A.; 1996; 26 f.). Die Zuordnung einzelner Berufe zu diesen Informationsberufsgruppen, die die OECD vor- nimmt, ist jedoch problematisch. In der Gruppe der Informationsproduzenten finden sich zum Beispiel unter anderem auch Programmierer, Buchautoren, Rechtsanwälte, Ingenieure, Physi- ker und Soziologen. „So bleibt bei der OECD Fassung des „Informationsarbeiters“ völlig unklar, ab wann eine Tätigkeit als Informationsberuf zu klassifizieren ist“ (Bühl, A.; 1996; 27).
Ausgehend von den OECD Kriterien definiert der Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch die Informationsgesellschaft folgendermaßen: „[...] [Informationsgesellschaft] ist erstens eine nationale Ökonomie, in der mehr als 50% der Berufstätigen in überwiegend informationsorientierten Berufen tätig sind. [...] Die zweite Definition wäre, daß der Beitrag zum Bruttosozialprodukt, der aus überwiegenden Informationsbeschäftigungen der Industrie kommt, mehr als die Hälfte [...] beträgt. Diese beiden Anteile [...] sind oft miteinander korreliert“ (Deutsch, K. W.; 1983; 69 f.). Nach diesem 50%-Kriterium wären Länder, wie die USA, bereits seit geraumer Zeit als Informationsgesellschaften zu bezeichnen.
Neben den hier aufgeführten quantitativen Kriterien gibt es noch weitere, mit deren Hilfe ver- sucht wird, die Informationsgesellschaft zu messen. Dazu gehören z.B. der Ausgabe- Koeffizient, in den die anteilmäßigen Ausgaben für Informationsgüter und -dienstleistungen pro Haushalt eingehen oder der Sammelindex, der die Zahl der national verbreiteten Zeitungs- auflagen, der Computer und der Telefongespräche pro Kopf der Bevölkerung mißt (vergl. Löffelholz, M u. Altmeppen, K. D.; 1994; 573). Alle diese Ansätze haben jedoch eines ge- meinsam: Sie ziehen zur Beschreibung der Informationsgesellschaft lediglich wenige quantifizierbare Indikatoren heran.
2.2. Informationsgesellschaft als „Dritte Welle“
Der Übergang zur Informationsgesellschaft wird oftmals mit dem von der Agrar- zur Indust- riegesellschaft verglichen. Mit diesem Vergleich soll deutlich gemacht werden, daß die Veränderungen, die durch die Informationsgesellschaft angeregt werden, von ähnlicher Trag- weite sind. Ausgehend von dieser Ansicht wird die Informationsgesellschaft von einigen Theoretikern im Kontext einer allgemeinen Stadientheorie betrachten. Das bedeutet, daß die gesellschaftliche Entwicklung als ein kontinuierlicher historischer Prozeß verstanden wird. Peter Otto und Philipp Sonntag betrachten die Informationsgesellschaft als Entwicklungsstufe innerhalb der historischen Entwicklung von Gesellschaften. Sie ist für sie neben der Agrar- und der Industriegesellschaft ein gesellschaftlicher Grundtypus. Ähnlich wie bei den informa- tion-economy-Ansätzen bildet hier die Art und Weise, in der die überwiegende Zahl der Erwerbstätigen ihren Lebensunterhalt bestreiten, das Kriterium für die Informationsgesell- schaft. Dabei greifen Otto und Sonntag auf das 50%-Kriterium von Karl Deutsch zurück (vergl. Kapitel 2.1.).
Die Agrargesellschaft wurde durch ihre hohe Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Men- schen bestimmt. Industrielle und handwerkliche Arbeit nahmen in ihr nur eine untergeordnete Stellung ein. In der Industriegesellschaft dagegen stand der Umgang mit Materie und Energie im Vordergrund. Industrielle Arbeit war vorherrschend. Die nun aufkommende Informations- gesellschaft zeichnet sich im Unterschied dazu durch die wachsende Zahl derer aus, die „informationsbezogene“ Tätigkeiten ausführen. Anstatt mit Materie und Energie wird mit Information, Signalen, Symbolen, Zeichen und Bildern umgegangen. Dieser Wandel wird jedoch nicht von heute auf morgen stattfinden. Der Übergang von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft hat sich in einem Zeitraum von 100-300 Jahren vollzogen und dauert in einigen Ländern bis heute an. Otto und Sonntag gehen davon aus, daß der Wandel zu einer Informationsgesellschaft eine ähnlich lange Zeitspanne bis zu seiner Vollendung benötigt (Ot- to, P. u. Sonntag, P.; 1985; 7).
Alvin Toffler verwendet zur Beschreibung der Informationsgesellschaft den Begriff der Drit- ten Welle 4. Auch er geht dabei von einer Stadientheorie aus. Für ihn ist die Geschichte jedoch geprägt durch „Veränderungswellen“ (Innovationswellen), die sich überlagern, miteinander kollidieren und so gesellschaftlichen Wandel hervorbringen. Nach den ersten beiden Wellen, welche die Agrar- und die Industriegesellschaft hervorbrachten, wird mit der dritten Welle die Informationsgesellschaft eingeleitet. Mit dem Ausgang des 20. Jahrhunderts stehen wir somit nach Toffler an der Schwelle zur nächsten großen Transformation. Der Eintritt in die Informa- tionsgesellschaft bringt auch für ihn einen übergreifenden gesellschaftlichen Wandel mit sich. Die zentrale Ressource der „Dritten Welle“ ist für Toffler das „abrufbare Wissen“. Diese um- faßt für ihn sowohl Daten, Informationen, Bilder und Symbole, als auch Kultur, Ideologie und Wertvorstellungen (vergl. Dyson, E. u.a.; 1996; 99). Wurde die Agrargesellschaft durch den Acker und die Industriegesellschaft durch das Fließband symbolisiert, so ist das Symbol der Informationsgesellschaft der PC bzw. der Minicomputer (vergl. Bühl, A.; 1996; 33).
Im Gegensatz zu Otto und Sonntag zeichnen sich Tofflers „Innovationswellen“ nicht durch eine historische Kontinuität aus. Sie sind im Gegenteil von Diskontinuität und Entwicklungs- bruchstellen geprägt. „Andere Arbeitsrhythmen, neue Formen der Familie, Veränderungen im Liebes- und Sozialleben, bislang unbekannte politische Konflikte und eine neue Wirtschafts- ordnung zeichnen sich ab - und darüber hinaus eine tiefgreifende Änderung unseres Bewußtseins“ (Toffler, A.; 1980; 20). Aber auch Peter Otto und Philipp Sonntag räumen ein, daß selbst wenn “... die Zukunft sich zu einem technischen Paradies in sozial wünschenswer- ter Form entwickeln sollte, selbst in diesem Extremfall, wäre der Weg in die Informationsgesellschaft voller Probleme” (Otto, P. u. Sonntag, P.; 1985; 8).
Um den Krisen und Entwicklungsbrüchen entgegenzuwirken, plädiert Toffler dafür, die Möglichkeiten der Informationstechnologien dafür zu nutzen, um die Probleme in öffentlichen Debatten zu bewältigen. Es geht ihm dabei um eine Partizipation möglichst vieler in einem breit angelegten Diskurs: „Wir brauchen Konferenzen, Fernsehsendungen, Wettbewerbe, Rollenspiele und simulierte Verfassungskonvente, auf denen ein breites Spektrum an kreativen Vorschlägen und neuen Ideen zur politischen Neustrukturierung geschaffen wird. Wir sollten bereit sein, dazu die modernsten Mittel einzusetzen - Satelliten, und Computer, Videospiele und interaktive Fernsehsysteme“(ebd.; 439).
2.3. Informationsgesellschaft als „postindustrielle Gesellschaft“
Einen wichtigen Beitrag für die Theorien der Informationsgesellschaft leistete der Soziologe Daniel Bell mit seinem 1975 erschienenen Buch „The comming of the Post-Industrial- Society“. Sein analytisches Model der „nachindustriellen Gesellschaft“ geht entgegen den informationsökonomischen Ansätzen von einem multidimensionalen Wandlungsprozeß aus. In diesem Prozeß verändern sich die verschiedenen „Achsen“ der industriegesellschaftlichen Organisationen wie Berufsstruktur, Technologiegrundlagen oder gesellschaftliches Leitprin- zip grundlegend und führen somit zu einer „postindustriellen“ Gesellschaft. Für Bell sind fünf Komponenten bzw. Dimensionen ausschlaggebend, an denen sich die postindustrielle Gesell- schaft festmachen läßt (Bell, D.; 1976; 32):
1. Wirtschaftlicher Sektor:
Im wirtschaftlichen Bereich kommt es zu einem Übergang von einer güterproduzierenden zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Bell greift hier auf die bereits erwähnte Drei-Sektoren- Hypothese von Colin Clark zurück (vergl. Kap. 2.1.). Der Begriff „Dienstleistungen“ umfaßt dabei einen weit gefächerten Bereich an Tätigkeiten. In Industriegesellschaften steigt der Bedarf an Dienstleistungstätigkeiten, vor allem im Transport- und Distributionsbereich. Die postindustrielle Gesellschaft dagegen zeichnet sich nach Bell durch den Bedeutungszuwachs von Berufen in den Bereichen Gesundheit, Ausbildung, Forschung und Verwaltung aus. Er spricht von einer neuen „ Intelligentsia “ (Bell, D.; 1976; 33) , einer wachsenden Zahl an Akademikern und Hochschulabsolventen, welche die Berufsstruktur prägen.
2. Berufsstruktur:
Die nachindustrielle Gesellschaft bringt nicht nur einen Anstieg der Beschäftigungszahlen im Dienstleistungssektor. Darüber hinaus verändern sich auch Berufsstrukturen. Die Industriege- sellschaft beschäftigte eine große Anzahl angelernter Arbeiter. Um die routinierten Tätigkeiten am Fließband oder an einer Maschine auszuführen, war oftmals keine qualifizierte Ausbildung von Nöten. Der Industriearbeiter konnte innerhalb kürzester Zeit die erforderli- chen Handgriffe erlernen. Mit der postindustriellen Gesellschaft steigt die Nachfrage nach professionalisierten und technisch qualifizierten Berufen. Die Tätigkeiten verlagern sich auf Büroarbeit, Verwaltungsaufgaben oder Ausbildungstätigkeiten. Die Zahl der Berufe, die eine technisch qualifizierte Ausbildung oder sogar einen akademischen Abschuß fordern, nimmt zu. Eine Schlüsselrolle innerhalb dieser Gruppe nehmen nach Bell die Naturwissenschaftler und Ingenieure ein, welche einen besonders hohen Anstieg zu verzeichnen haben.5
3. Axiales Prinzip:
Theoretisches Wissen wird zum „ axialen Prinzip “ (gesellschaftliche Leitorientierung) der nachindustriellen Gesellschaft. Es wird zu einer Quelle von Innovationen und zum Ausgangspunkt gesellschaftlich-politischer Programmatik. Theoretisches Wissen, welches durch Universitäten und Forschungsinstitute generiert wird, bildet die Grundlage für Entwicklung und Fortschritt in der nachindustriellen Gesellschaft.
4. Zukunftsorientierung:
In der postindustrielle Gesellschaft soll es nach Bell verstärkt zu einer Planung und Steuerung von technischem Fortschritt kommen. Die Grundlage für ein anhaltendes Wirtschaftswachs- tum ist die Entwicklung neuer Technologien. Durch eine abwägende Beurteilung und Bewertung neuer Technologien soll vermieden werden, daß der technische Fortschritt unge- wollte Nebenwirkungen zur Folge hat bzw. daß die „sozialen Kosten“ gering gehalten werden. Bell geht davon aus, daß ein solcher bewußt geplanter technischer Fortschritt mög- lich ist, und sich das wirtschaftliche Wachstum zu einem gewissen Grad steuern läßt. „Eine solch abwägende Beurteilung [...] erforderte lediglich einen politischen Mechanismus, der die Durchführung einschlägiger Untersuchungen und die Aufstellung der für die neue Technolo- gie gültigen Kriterien erlaubte“ (ebd.; 43).6
5. Entscheidungsbildung:
Rationale Entscheidungen werden durch eine gestiegene „ organisierte Komplexit ä t “ immer mehr erschwert. Bell versteht darunter einerseits die Komplexität großer Organisationen und Systeme und andererseits Theorien mit einer großen Anzahl an Variablen. Wo früher die Be- trachtung weniger Variablen genügte, um zu einer Einschätzung eines Problems zu kommen, ist dies nun nicht mehr ausreichend. Im Umgang mit großen Systemen gilt es viele, aufeinan- der einwirkende Variablen im Blick zu behalten, um diese auf ein bestimmtes Ziel hin zu koordinieren. Mit der Entwicklung neuer „ intellektueller Technologien “ 7 sind für Bell neue Methoden entstanden, die es ermöglichen, Systeme von großer Komplexität oder auch Zu- sammenhänge mit einer großen Anzahl an Variablen zu handhaben. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Entwicklung des Computers, welcher das vornehmliche Werkzeug der intel- lektuellen Technologien ist. „Nur dank dem Computer als Werkzeug der intellektuellen Technologien ist es möglich, eine Kette multipler Kalkulationen durchzuführen, durch die verschiedensten Analysen die Wechselwirkungen vieler Variabler in allen Einzelheiten zu verfolgen und gleichzeitig mehrere hundert Gleichungen zu lösen “ (ebd.; 46). Zur Lösung von Problemen kann auf Algorithmen zurückgegriffen werden (z.B. um bestimmte Wahr- scheinlichkeiten eines Ereignisses auszudrücken). Entscheidungen orientieren sich dabei auf Regeln und „gesichertem Wissen“ anstatt auf intuitiven Urteilen.
Im Gegensatz zu den informationsökonomischen Theorien stellt die nachindustrielle Gesellschaft für Daniel Bell keine „Realkategorie“ dar. Sie ist lediglich ein gesellschaftlicher Idealtypus. „[Sie] ist keine Formel für eine spezifische oder konkrete Gesellschaft, sondern ein analytisches Konstrukt“ (ebd.; 370).
2.3.1. „Theoretisches Wissen“ als axiales Prinzip
Der Wandel von einer Industriegesellschaft zur postindustiellen Gesellschaft ist für Bell vor- rangig durch einen Wandel der sozialen Struktur gekennzeichnet. Diese umfaßt die Wirtschaft, die Technologie und die Berufsgliederung und beinhaltet so die Rollenverteilung und die Koordinierung der einzelnen Akteure zur Erreichung bestimmter Ziele.
Gesellschaften setzen sich für Bell analytisch aus drei Bereichen zusammen. Diese sind die soziale Struktur, die politische Ordnung und die Kultur (vergl. Bell, D.; 1976; 29). Wandel in einem dieser Bereiche hat nicht zwangsläufig entsprechende Veränderungen in den anderen zur Folge. Damit vertritt Bell eine anti-holistische Position. Seiner Ansicht nach, „sind Ge- sellschaften keine organischen Gebilde oder auch nur soweit integriert, daß sie als ein einziges System, ein geschlossenes Ganzes analysiert werden könnten“ (ebd.; 114). Zur Ana- lyse des Wandels innerhalb des Bereiches der sozialen Struktur verwendet Bell das theoretische Konzept des „ axialen Prinzipes “. Unter axialem Prinzip versteht er die zentrale gesellschaftliche Leitorientierung, die „Achse“, um die sich alle anderen Institutionen grup- pieren und nach der sie sich ausrichten. Jeder der drei genannten gesellschaftlichen Bereiche besitzt seine eigene Leitorientierung. Das axiale Prinzip der sozialen Struktur westlicher In- dustrienationen ist die Wirtschaftlichkeit . Der Wandel zu einer postindustriellen Gesellschaft zeichnet sich für Bell vor allem durch eine Veränderung dieses axialen Prinzips aus.
„Wenn hier von postindustrieller Gesellschaft die Rede ist, sind in erster Linie die Änderun- gen in der sozialen Struktur gemeint, also der wirtschaftliche Wandel, die Verschiebung innerhalb der Berufsgliederung und das neue Verhältnis zwischen Theorie und Empirie, vor allem Wissenschaft und Technologie.“ (ebd.; 30). Das axiale Prinzip, das mit Eintritt in die postindustrielle Gesellschaft aufkommt und die sozialen Strukturen determiniert, bezeichnet Bell als „theoretisches Wissen“. Dieses zeigt sich für ihn deutlich in dem engen Verhältnis zwischen Wissenschaft und Technologie. Theoretisch fundiertes Wissen nimmt eine immer stärkere Rolle ein. Es findet besonders dort Anwendung, wo es darum geht, technologischen Fortschritt und damit auch wirtschaftliches Wachstum gezielt und planmäßig voranzutreiben und zu koordinieren. In früheren Zeiten ging technische Innovation überwiegend von einfalls- reichen Tüftlern und Erfindern aus. Ihre Entdeckungen machten sie oftmals ohne Kenntnis des theoretischen Grundlagenwissens. Ein Beispiel dafür ist Thomas Edison, der die Entwick- lung des elektrischen Lichtes gänzlich ohne das theoretische Wissen über Elektromagnetismus zustande brachte. Diese Art der technischen Entwicklung und Entde- ckung neuer Verfahrensweisen hat sich nach Bell zwangsläufig geändert. „Ohne die mathematisch-physikalisch geschulten Ingenieure [...] wäre eine Weiterentwicklung der E- lektrodynamik, insbesondere die Ablösung der Dampfmaschine, undenkbar gewesen“ (ebd.; 37).
Theoretisches Wissen ist so gesehen die Grundlage für technologischen Fortschritt geworden. Die Industrie setzt auf „Forschung und Entwicklung“, um diesen Fortschritt zu steuern und weiter voranzutreiben. Die verstärkte Orientierung am theoretischen Wissen zeigt sich für Bell in abgewandelter Form auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Dort wird theoreti- sches Vorwissen und die Sammlung von Daten zwecks empirischer Bestätigung zum strategischen Hilfsmittel und zur Grundlage für Fortschritt. Damit begründet sich für Bell die Zentralität theoretischen Wissens als das axiale Prinzip der nachindustriellen Gesellschaft. So, wie theoretisches Wissen in seiner Bedeutung für technologische und gesellschaftliche Wei- terentwicklung steigt, bilden „[...] Universitäten, Forschungsstationen und wissenschaftliche Institutionen, wo dieses theoretische Wissen zusammengetragen und ausgebaut wird, [...]“(ebd.; 41) die „axialen Strukturen“ der nachindustriellen Gesellschaft.
2.3.2. Die nachindustrielle Gesellschaft als eine Informations- oder Wissensgesellschaft
Die Industriegesellschaft war geprägt vom Einsatz von Kapital und Energie zur Warenpro- duktion. Dagegen spielt für Bell in der nachindustriellen Gesellschaft theoretisches Wissen als umwandelnde Kraft und die Verarbeitung von Information (z.B. im Bereich der Datenverar- beitung) ein wesentliche Rolle (vergl. Abbildung 2). Diese bilden das Fundament für technische Neuerungen und wirtschaftliches Wachstum. Die postindustrielle Gesellschaft ist somit eine Informations- oder Wissensgesellschaft, in der Information zu einer wichtigen wirtschaftlichen Ressource wird. Dies führt Daniel Bell zu folgendem Schluß: „War die In- dustriegesellschaft eine güterproduzierende, so ist die nachindustrielle Gesellschaft eine Informationsgesellschaft“(Bell, D.; 1976; 353).
Abbildung 2:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Bell, D.; 1985; 12.
Der neue Stellenwert des Wissens erklärt sich für Bell aus dem exponentielle Wachstum des „Wissensumfangs“ und der steigenden „Verzweigung“ und Differenzierung des Wissens. Das Wissen der gesamten Menschheit ist soweit angewachsen, daß es für eine einzelne Person nicht mehr zu überschauen ist. Bell veranschaulicht diese Entwicklung am Beispiel der „En- cyclopaedia Britannica“. An deren ersten Auflagen (1745-88) arbeiteten beispielsweise zwei Gelehrte, während 1967 bereits 10.000 Experten an der Erstellung der Enzyklopädie beteiligt waren (vergl. ebd.; 181 f.). Bell führt eine Unterscheidung von fünf „Arten des Wissens“ an, welche auf Machlup zurückgeht (ebd.; 180 f.). Machlup geht dabei von der subjektiven Be- deutung aus, die Wissen für den Einzelnen haben kann. Diese fünf „Bedeutungstypen“ sind:
- Praktisches Wissen (z.B. berufliches Wissen)
- Intellektuelles Wissen (zur Befriedigung der „geistigen Neugier“ des Menschen)
- Wissen zum Zeitvertreib (zur Befriedigung der nichtgeistigen Neugier des Menschen, z.B. Klatsch)
- Geistliches Wissen (religiöses Wissen)
- Zufallswissen (Wissen außerhalb der eigenen Interessen und in der Regel ohne eigenes Zutun erworben)
Diese von Machlup vorgeschlagenen Begriffskategorien von Wissen sind für Daniel Bell je- doch zu weit gefaßt. In Abgrenzung zu Nachrichten oder Unterhaltung definiert er Wissen „[...] als eine Sammlung in sich geordneter Aussagen über Fakten oder Ideen, die ein vernünf- tiges Urteil oder experimentelles Ergebnis zum Ausdruck bringen und anderen durch irgendein Kommunikationsmedium in systematischer Form übermittelt werden [...]“ (ebd.; 180). Wissen umfaßt dabei für ihn sowohl durch Wissenschaft und Forschung generierte neue Urteile als auch neue Darstellungen älterer Ansichten (z.B. durch Lehrbücher oder im Unter- richt8 ).
Die neuen „intellektuellen Technologien“ sind dadurch gekennzeichnet, daß sie danach stre- ben, rationales Handel zu definieren und festzulegen, mit welchen Mitteln es sich realisieren läßt (vergl. ebd.; 46). Handeln unterliegt in jeder Situation gewissen Beschränkungen, z.B. durch die Kosten. Des weiteren stehen gegensätzliche Handlungsalternativen zu Verfügung, die das gewünschte Ziel mehr oder weniger erreichbar machen. Für Bell können Handlungen von Sicherheit, Risiko oder auch von Unsicherheit bestimmt sein. Sicherheit ist dann gege- ben, wenn die Grenzen des Handelns bekannt und festgelegt sind. Bei Risiko ist eine Reihe von möglichen Endergebnissen, deren Wahrscheinlichkeiten bekannt sind, vorhanden. Bei Unsicherheit lassen sich die möglichen Ereignisse zwar auch ausmachen, die einzelnen Wahr- scheinlichkeiten für ihr Eintreten sind jedoch nicht bekannt. Ziel rationalen Handels ist es, die Strategie zu wählen, die zur „besten“ Lösung führt. Das bedeutet, daß das Endergebnis maxi- miert und die Verluste möglichst minimiert werden. Darüber definiert Daniel Bell Rationaliät wie folgt: „Rationalität läßt sich [...] als das Vermögen definieren, von zwei Alternativen die- jenige zu wählen, die das angestrebte Endergebnis zu erfüllen verspricht“ (ebd.; 47). Die „intellektuellen Technologien“, die auf theoretischem Wissen beruhen, versuchen Rationalität auch angesichts komplexer Systeme zu verwirklichen. Unsicherheiten können zum Beispiel somit zu Risiken werden, indem man die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Endergebnisse bestimmt und damit kalkulierbar macht.
Obwohl die technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel im Computerbereich, für Bells nachindustrielle Gesellschaft eine wichtige Rolle einnehmen, sind sie für ihn nicht die primä- ren Schrittmacher des Wandlungsprozesses. Ausschlaggebend ist seiner Ansicht nach vor allem die Verdichtung des sozialen Systems (ebd.; 52). Neue technische Entwicklungen in den Bereichen des Transports- und Kommunikationswesens haben zu einer Aktivierung von Kontakten und zu einer starken Zunahme der zwischenmenschlichen Beziehungen geführt. Es sind neue wirtschaftliche und soziale Verflechtungen entstanden, die zu einem neuen dichte- ren Netz sozialer Beziehungen geführt haben.9 Damit steigt für Bell die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen untereinander. Die nachindustrielle Gesellschaft beruht deshalb auf dem „ Spiel zwischen Personen “ (ebd.; 116). In diesem Zusammenhang kann auch der Trend zur „Globalisierung“ gesehen werden. Im Zuge der Globalisierung wird das Indivi- duum Teil immer größerer Einheiten. Der einzelne muß sich zum Beispiel anstatt auf einem nationalen verstärkt auf einem internationalen Arbeitsmarkt behaupten. Das menschliche Handeln wird mehr und mehr durch zunehmende kommunikative Dichte und sozialen Aus- tausch geprägt. Da immer mehr Personen an dem „Spiel“ teilnehmen, kommt in der nachindustriellen Gesellschaft Koordination eine wichtige Rolle zu, damit der einzelne seine individuellen Interessen und Bedürfnisse realisieren kann.
Die „technische Intelligenz“ nimmt in der nachindustriellen Gesellschaft eine Vorrangstellung ein. Mit dem Anstieg der Bedeutung von theoretischem Wissen und Information gewinnen Wissenschaftler, Akademiker und Technokraten zunehmend an Einfluß. Information wird innerhalb der Organisationen zur Machtquelle. Technisches Know-How und berufliche Qualifikation lösen nach Bell Eigentum und politisches Amt als Grundlage von Macht ab. „[Da] mit dem Eintritt in die nachindustrielle Phase auch die Anforderungen an das technische und fachliche Können steigen, [wird] eine umfassende Schul- und Hochschulbildung zur Voraussetzung für den Aufstieg in der Gesellschaft“ (ebd.; 135).
Daniel Bells nachindustrielle Gesellschaft wird durch zwei Hauptmerkmale bestimmt. Einer- seits kommt es zu einem Übergewicht des Dienstleistungs- bzw. Informationssektors gegenüber der Güterproduktion. Weiterhin nimmt die Bedeutung von theoretischem Wissen und damit verbunden die Nutzung „intellektueller Technologien“ zu. Letztere ermöglichen es, ökonomischen, technischen aber auch gesellschaftlichen Fortschritt im Voraus zu planen und zu steuern. Dadurch erlangt für Bell theoretisches Wissen eine zentrale Stellung in der Gesellschaft und wird zu ihrem axialen Prinzip.
2.4. Informationsgesellschaft als Ziel der Komplexitätsreduktion
Das Konzept der Informationsgesellschaft impliziert, daß ihre Hauptdimension Information ist. Informationen spielen im Alltag bei der Interpretation von Situationen eine zentrale Rolle. Gernot Wersig weist darauf hin, daß Information im engen Zusammenhang mit Wissen und Kommunikation zu betrachten ist.10 In wieweit Information als grundlegende Dimension der gesellschaftlichen Veränderungen, die wir heute ausmachen, angesehen werden kann, bedarf jedoch einer näheren Betrachtung. Der Umgang mit Informationen ist nicht etwa erst seit kur- zer Zeit zu beobachten. Er war bereits immer von grundlegender gesellschaftlicher Bedeutung. Die Welt, in der wir leben, wird durch die Informationen, die wir über sie sam- meln, strukturiert. In ständiger Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und unter Zuhilfenahme bereits vorhandenen strukturierten Wissens, werden ständig neue Informatio- nen aufgenommen und unserem Bild von der Welt hinzugefügt. In diesem Sinne dienen sie der „Konstruktion“ der subjektiven und intersubjektiven Wirklichkeit (vergl. Berger, P. u. Luckmann T.; 1977; 24 ff). So gesehen ist jede Gesellschaft eine „Informationsgesellschaft“. Günter Streit schreibt: „Von einer solchen Sichtweise her erscheint es banal, heutzutage von der ´Wichtigkeit von Informationen für die Gesellschaft´ oder einer ´Informationsgesellschaft´ zu sprechen, denn letzterer Begriff kann in gewisser Weise eine universelle Anwendung auf alle Gesellschaften in allen Zeiten finden“ (Streit, G.; 1993; 52).
Der neue Stellenwert, der Information in der heutigen Zeit zukommt, kann nach Günter Streit deutlich gemacht werden, indem man versucht, ihre wachsende Bedeutung innerhalb der ver- schiedenen Entwicklungsstufen der Gesellschaft nachzeichnen (vergl. ebd.; 53 ff). Innerhalb primitiver Gesellschaften haben für ihn alle ihre Mitglieder grundsätzlich den gleichen Zu- gang zu allen relevanten Informationen. Die institutionelle Ordnung umfaßt das gesamte Leben des Einzelnen, wodurch auch der Grad an rollenspezifischem Wissen genauso wie die „Komplexitätstiefe“ innerhalb dieser Gesellschaften äußerst gering ist. Die Lebensführung der einzelnen Mitglieder orientiert sich an vorgegebenen verbindlichen Interpretationsmustern. Somit spielt der Prozeß der Gewinnung neuer Informationen eine eher untergeordnete Rolle.
In dem Maße, in dem die Differenzierung der Gesellschaft voranschreitet, ändert sich dieses Bild. Im Zuge der Arbeitsteilung bilden sich einzelne spezialisierte Tätigkeiten heraus. Der allgemeine Wissensvorrat, an dem bisher alle teilhatten, wird durch unterschiedliches spezifisches Rollenwissen ersetzt.11 Die „Komplexitätstiefe“ der Gesellschaft steigt damit stetig an.
Auch für Gernot Wersig ist der Übergang zur Informationsgesellschaft vor allem auch durch eine wachsende Komplexität einer individualisierten Gesellschaft gekennzeichnet. Die Hand- lungsfreiräume haben sich für den einzelnen vergrößert und die individuelle Lebensführung ist dadurch flexibler geworden. Die Welt ist damit zwar reichhaltiger, aber zugleich auch komplexer geworden. Das Individuum ist stärker auf sich allein gestellt und kann immer we- niger auf feste Orientierungsmuster zurückgreifen. Sicherheiten, die in der Industriegesellschaft noch Bestand hatten, haben sich aufgelöst. Die Zusammenhänge des Alltags sind vielfältiger, differenzierter und weitreichender geworden. Bereits Daniel Bell hat darauf hingewiesen, daß das Wissen über die Welt stark angewachsen ist und zu einer starken Ausdifferenzierung der einzelnen Wissenschaftsdisziplinen geführt hat. Mit der Ausdiffenzie- rung der Wissenschaft wächst für Ulrich Beck „[...] die unüberschaubare Flut konditionaler, selbstungewisser, zusammenhangloser Detailergebnisse“ (Beck, U.; 1986; 256). Beck nennt dies „Überkomplexität“ des Hypothesenwissen. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in hochkomplexe Teilsysteme führt zu einem Anstieg der Informationsmenge, deren Verarbei- tung durch eine einzelne Person kaum noch geleistet werden kann. Bei noch so hoher Informationsaufnahme stehen nur segmentierte Entwürfe von Weltbildern zur Verfügung. „Dieses Anwachsen der Informationen in einer Gesellschaft führt zwangsläufig zu Arbeitstei- lung und Spezialisierung; dies hat wiederum mehr Information zur Folge“ (Streit, G.; 1993; 60).
Durch die gestiegene Komplexität nimmt der Grad an Ungewißheit zu. Für Wersig liegt hier die Gefahr, daß dies bei den einzelnen Individuen in einem Gefühl der Überforderung mün- den kann. Komplexität selbst wirkt sich nach Wersig auf zwei „Komplexitätsrichtungen“ aus.
Horizontale Komplexität entsteht für ihn durch das Vorhandensein konkurrierender Verhal- tensoptionen, zwischen denen eine Entscheidung getroffen werden muß. Vertikale Komplexität dagegen basiert auf den verschiedenen Zeitschichten, mit denen wir zu tun haben. Handlungen bauen auf frühere Handlungen auf. Auf der anderen Seite bilden sie ihrerseits Bezugspunkte für spätere Handlungen. Jede Entscheidung für eine Handlungsalternative ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen eine andere. Damit beinhaltet jede Entscheidung Vorbild und Gegenbild für spätere Entscheidungen gegenüber dem Komplexitätsraum. Für Wersig zeigt sich der Anstieg der vertikalen Komplexität in der Zunahme am Interesse an Zukunfts- und Trendforschung (Wersig, G.; 1996; 12).
Beide Komplexitätsrichtungen erhöhen den Bedarf an Informationen zur Orientierung und zur methodischen Lebensführung innerhalb eines Systems. Für Streit gewinnt deshalb vor allem der zweckrationale Charakter von Information an Bedeutung (Streit, G.; 1993; 59 f.). In ei- nem kommunikativen und reflexiven Prozeß werden ständig Informationen gesammelt und in den vorhandenen Wissensvorrat integriert. Auf diese Weise erzeugen, verändern oder erhalten sie Orientierungs- und Handlungsmuster (vergl. ebd.; 49). Aus diesem Blickwinkel dienen Informationen der Reduzierung von Ungewißheit. Angesichts der gestiegenen Komplexität, die das Alltagsleben des einzelnen immer stärker bestimmt, stellt Wersig eine Definition von Informationsgesellschaft auf, deren Augenmerk auf den Umgang mit Information gegenüber einer komplexen Umwelt liegt. Demnach ist die „Informationsgesellschaft [...] die Gesell- schaft, auf die wir uns zubewegen müssen, in der die existierende Komplexität, die an vielen Stellen überfordert, durch geeignete, d.h. die Errungenschaften der Moderne nicht zurückfüh- rende, Hilfsmittel reduziert wird“ (Wersig, G.; 1996; 14). Information waren schon immer Hilfmittel, um sich gegenüber der Komplexität des Alltags zu behaupten. Entscheidend bei Wersigs Definition ist jedoch nicht die neue Bedeutung von Information an und für sich, son- dern die wachsende Bedeutung technisch vermittelter Information. „Natürlich benutzen Menschen in ihren alltäglichen Bedingungen Information [...], die Teil ihrer kommunikativen Welt ist: Medien, Ankündigungen, Freunde, etc. Die neuen Informations- und Kommunikati- onstechnologien versprechen, diese Information zukünftig auf einer technischen Basis bereitzustellen [...]“ (ebd.; 142). Vor allem diese Art der Information soll zu einer Orientie- rungshilfe gegenüber Verunsicherung und Überforderung der modernen Gesellschaft werden. „Informationsgesellschaft“ stellt für Wersig eine Zielkonzeption dar, die es dem Individuum ermöglicht, die Probleme einer komplexen Gesellschaft zu meistern.
Um die neuen Chancen der Verringerung von Komplexität zu betrachten, unterscheidet Wer- sig zwischen Handlungs- und Wissenskomplexität (ebd.; 15f.). Handlungskomplexität ergibt sich aus dem Zusammenspiel von gewachsenen Handlungsmöglichkeiten und dem Fehlen handlungsorientierender Konzepte. Vor allem in Bezug auf die zeitliche Dimension sind gesi- cherte Vorhersagen kaum noch möglich. Wissenskomplexität dagegen bezieht sich auf die Bruchstückhaftigkeit unseres Wissens gegenüber dem gestiegenen Wissen der Welt. Das Wissen der gesamten Menschheit hat sich zwar stark erhöht, der Einzelne hat jedoch nur zu einem geringen Teil Zugang dazu. Gleichzeitig sind bisherige Mittel zu Komplexitätsredukti- on, wie z.B. Religion, weggefallen. Die Komplexität des Unbekannten hat zugenommen und kann oft nur durch hohen Aufwand zu Bekanntem gemacht werden. Durch undurchschaubare komplexe Zusammenhänge orientiert sich Alltagshandeln immer öfter nur noch an wagen Ahnungen, anstatt an gesichertem Wissen. Nach Wersigs Ansicht können als Instrumente zur Reduzierung von Handlungskomplexität ein „Mangement des Lebensalltags“ oder die Ent- wicklung individueller Lebensstile als Schemata der individuellen Handlungsorientierung dienen.
Zur Überwindung der Wissenkomplexität bieten sich neue Möglichkeiten an, die durch die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien eröffnet werden. Dabei sind für Wersig besonders die neuen interaktiven Merkmale der Kommunikationsmedien, die erweiterten Möglichkeiten der bildhaften und damit „sinnlichen“ Darstellung oder auch die individuellen Präsentations- und Aneignungsmöglichkeiten, wie sie z.B. durch Hypertext geschaffen werden, von Bedeutung. Für Daniel Bell sind es im Gegensatz dazu vor allem die „intellektuellen Technologien“, die den Umgang mit komplexen Problemen erleichtern und somit rationales Handeln auf der Grundlage von theoretischen Wissen ermöglichen.
2.5. Zusammenfassung der Theorien zur Informationsgesellschaft
Die hier dargestellten unterschiedlichen Ansätze zur Beschreibung der Informationsgesell- schaft eröffnen den Blick auf die Vielschichtigkeit der Veränderungen, die mit ihr verbunden sind. Dabei hat sich gezeigt, daß die informationsökonomischen Erklärungsansätze, die sich ausschließlich auf einige wenige quantifizierbare Indikatoren beziehen, zu einseitig sind, um den gesellschaftlichen Wandel ausreichend zu begründen. Sie verkürzen dabei den komplexen gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozeß auf rein ökonomische und technische Aspekte. Aber auch die Zahlen, auf die sie sich beziehen, sind fragwürdig. Das Problem besteht darin, die „Informationsberufe“ eindeutig von den anderen abzugrenzen, da fast jeder Beruf in ir- gendeiner Weise informationsverarbeitende Tätigkeiten beinhaltet. Bei einer weit gefaßten Definition der Informationsberufe, wie sie z.B. die OECD vornimmt, findet sich zwangsläufig der Großteil der Beschäftigten im Informationssektor wieder. Auch die Einbettung der Infor- mationsgesellschaft in eine gesamtgesellschaftliche Stadientheorie, wie sie Alvin Toffler oder auch Otto und Sonntag vornehmen, hat ihre Problematik. Dieser Ansatz malt ein Bild einer gesellschaftlichen Entwicklung, die sich nach objektiv-historischen Gesetzmäßigkeiten voll- zieht. Dabei wird von einem linearen Fortschreiten der Gesellschaft ausgegangen, ohne dies ausreichend zu begründen.
Das Konzept der „nachindustriellen Gesellschaft“ von Daniel Bell geht von einem geplanten technologischen Fortschritt aus, der auf theoretischem Wissen basiert. Es zeigt sich jedoch gerade bei der Einführung und Diffusion neuer Informations- und Kommunikationstechnolo- gien, daß es nicht durch Theoriewissen erzeugte Technikfolgenabschätzung ist, welches im Vordergrund steht. In stärkerem Maß wird sich dabei an Regeln marktwirtschaftlich organi- sierter Systeme, Profitmaximierung, Wettbewerb und technologischem Anpassungsdruck orientiert. Aus diesem Grund ist der Begriff der nachindustriellen Gesellschaft nicht zutref- fend. Man könnte eher von einer „informatisierten Industriegesellschaft“ sprechen (vergl. Löfferholz, M. u. Altmeppen, K. D.; 575 f.). Trotz dieser Kritik bietet Bells Theorie im Ge- gensatz zu dem information-economy-Ansätzen wichtige Ansatzpunkte, um die Informationsgesellschaft innerhalb eines gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozesses zu verstehen.
Für Gernot Wersig erlangen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien als Hilfsmittel zur Komplexitätsreduktion eine starke Bedeutung. Allein die zunehmende Ver- breitung dieser Technologien und das erweiterte mediale Angebote durch sie sind jedoch nicht ausreichend, um diese Vorstellung einer Informationsgesellschaft zu verwirklichen. In- formations- und Kommunikationstechnologien, wie man sie z.B. im Multimediabereich vorfindet, besitzen lediglich die Potentiale, durch welche eine Komplexitätsbewältigung er- reicht werden kann. Wersig gesteht zu, daß durch den Anstieg von Multimediaangeboten die Komplexität zunächst eher noch zunimmt, als daß sie dadurch reduziert wird. Die Zunahme von Fernsehkanälen, Internet-Diensten und anderen Angeboten tragen zunächst dazu bei, daß die Orientierungslosigkeit ansteigt. Das Internet stellt beispielsweise ein so komplexes Ange- bot dar, daß es für viele schwierig ist, sich in ihm zurechtzufinden. Damit beinhaltet das Konzept der „Komplexitätsreduktion durch Multimedia“ bereits seinen eigenen Widerspruch. „Das Angebot an Kommunikationstechnologien, -diensten und -inhalten wird wuchern und selber zum Komplexitätsproblem werden (Wersig, G.; 1996; 23). Wersigs Hoffnung besteht jedoch darin, daß die zunächst durch die neuen Technologien multimedial vermittelte Erhö- hung der Komplexität mit der Zeit auch zu einem souveräneren Umgang mit dem erweiterten Medienangebot führt und somit doch zur Komplexitätreduktion beiträgt.
Wenn man nun die dargestellten Überlegungen zur Informationsgesellschaft betrachtet, könn- te eine Definition folgendermaßen lauten: Informationsgesellschaft w ä re danach zu verstehen, als eine komplexe und stark differenzierte Gesellschaft, in der angesichts einer exponential steigenden Wissensmenge die Produktion, Sammlung, Verarbeitung und Verteilung von In- formationen, unterst ü tzt durch neue Informations- und Kommunikationstechnologien, eine zentrale Rolle einnimmt.
Diese Definition ist natürlich kritisierbar, sie umfaßt jedoch einige wichtige Aspekte, die in den bisher dargestellten Theorien bereits aufgetaucht sind. Zunächst ist der zentrale Begriff der Informationsgesellschaft „Information“. Mit dem Anstieg des gesellschaftlichen Wissens und dem wachsenden Informationsangebot wächst der alltägliche Umgang mit Wissen und Informationen. Für Alvin Toffler ist es vor allem das „abrufbare Wissen“ in Form von Infor- mationen, Daten, Bildern und Symbolen, bei Daniel Bell der Einsatz „theoretischen Wissens“ für die gesellschaftliche Planung und bei Wersig der Umgang mit Information zum Zwecke der Beseitigung von Ungewißheit und zur Reduktion von Komplexität. Dabei stehen die In- formationen im Vordergrund, die rationales Handeln aufgrund von „gesichertem Wissen“ erlauben. Diese Entwicklung schlägt sich nicht zuletzt auch im Arbeitsbereich und in der Be- rufsstruktur nieder. Gewinnung, Verarbeitung und Verteilung von Information bestimmt dabei viele berufliche Aufgaben. Nicht nur bei den informationsökonomischen Ansätzen, sondern auch bei Otto und Sonntag sowie bei Daniel Bell spielt der Bereich der Arbeit eine wichtige Rolle. Schließlich geht aus dieser Definition hervor, daß den Informations- und Kommunikationstechnologien eine große Bedeutung zukommt. Durch sie wird der Zugang und Umgang mit Information gestaltet. Indem sie in den unterschiedlichsten gesellschaftli- chen Bereichen Anwendung finden, treiben sie den Prozeß der „Informatisierung der Gesellschaft“ voran. Auf die Informations- und Kommunikationstechnologien soll im folgen- den Kapitel noch detaillierter eingegangen werden. Dort soll auch der Frage nachgegangen werden, was die neuen Qualitäten der sogenannten „neuen Medien“ ausmachen.
3. Die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstech- nologien
3.1. Die „Informatisierung“ der Gesellschaft
Das Aufkommen neuer Informations- und Kommunikationstechnologien wird hauptsächlich unter den Gesichtspunkten von neuen Kommunikationsinfrastrukturen, neuen Markterschlie- ßungen und neuen Aktivitätsfeldern betrachtet. Dies alles sind jedoch nur Begleiterscheinung einer viel weiterreichenden Veränderung. Man kann diese Veränderungen in Anlehnung an Nora und Minc als die „ Informatisierung der Gesellschaft “ bezeichnen (vergl. Nora, S. und Minc, A.; 1979; 36 ff). Der Begriff der Informatisierung meint die Durchdringung aller ge- sellschaftlichen Lebensbereiche durch Technologieintegration. Noch bis vor ein paar Jahrzehnten war die Grenze zwischen der „Computerwelt“ und Alltagswelt noch klar gezo- gen. Bis in die 70er Jahre hinein beschränkte sich der Einsatz von Computern auf wenige militärische und universitäre Forschungs- und Entwicklungslabore (vergl. Rammert, W.; 1990; 15). Computer waren sperrig, teuer, kompliziert und wenig leistungsfähig. Erst mit der Herstellung kleinerer, leistungsfähigerer und billigerer Rechner, hat sich diese Situation grundlegend verändert. Durch ihre universelle Einsetzbarkeit haben Computer in die unter- schiedlichsten Bereiche Einlaß gefunden. Unser Alltag wird verstärkt durch den Umgang mit Geräten geprägt, die in irgendeiner Art Computerchiptechnologie beinhalten. „Computerchips stecken in Motoren, Uhren, Antiblokiersystemen, Faxgeräten, Fahrstühlen, Benzinpumpen, Kameras, Thermostaten, Fitneß-Steppern, Verkaufsautomaten, Alarmanlagen und tönenden Glückwunschkarten“ (Gates, B.; 1995; 18). Der Umgang mit intelligenten Selbstbedienungs- automaten beispielsweise, wie man sie in Banken vorfindet, ist für uns bereits zur Alltäglichkeit geworden. Dabei empfinden wir es als selbstverständlich, daß nicht ein menschlicher Bankangestellter, sondern eine Maschine uns über unseren Kontostand infor- miert oder uns einen gewünschten Betrag auszahlt. Der Prozeß der Informatisierung zeigt sich für Wersig (Wersig, G.;1993; 11) an vier Punkten:
- Computer und ihre Charakteristika dringen in alle Lebens- und Handlungsbereiche ein.
- Computer verbinden sich mit neuen Kommunikationstechnologien zu einem integrierten System (Stichwort: Telematik).
- Computer treten nicht nur als Computer auf, sondern sind in zunehmendem Maße nicht mehr als offen ausgewiesene Komponenten von Geräten und Prozessen zu den unter- schiedlichsten Zwecken.
- Computer, Netze und Geräte verbinden sich mit einer neuen Generation von Sensoren, wodurch sie einen eigenständigen Systemcharakter erhalten.
Mit einer hohen Geschwindigkeit haben sich in den letzen Jahren eine Reihe neuer Technolo- gien in den Bereichen der Information und Kommunikation entwickelt. Mit Schlagwörtern wie „neue Medien“ oder „Multimedia“ wird versucht, die Neuartigkeit der entstandenen Technologien zu erfassen. Oftmals werden diese technischen Innovationen unter dem Begriff „Informations- und Kommunikationstechnologien“ (IuK-Technologien) zusammengefaßt. Damit sind alle technischen Einrichtungen, Anlagen und Geräte gemeint, die Daten be- und verarbeiten, Leitungs- und Verbindungsnetze, die der Übermittlung von Daten dienen sowie verschiedene Übermittlungsdienste. Der Begriff der IuK-Technologien umfaßt demnach:
- Computertechnik,
- Mikroelektronik,
- Unterhaltungselektronik,
- Nachrichtentechnik (z.B. Übertragungstechnik, Satellitentechnik), Ø Industrieelektronik (z.B. Fertigungsautomaten)
- oder auch Bürotechnik (Hauf, O.; 1996; 31 f.).
Diese verschiedenen Techniken sind jedoch oftmals nicht klar zu trennen. Die Mikroelektro- nik ist zum Beispiel ein integrierter Bestandteil vieler anderer Techniken. Auch die Unterhaltungselektronik kann nicht unabhängig von der Nachrichtentechnik gesehen werden. Der große Entwicklungsschub, den die IuK-Technologien zu verzeichnen haben, beruht gera- de auf dem Zusammenwachsen verschiedener Technologien, die sich bisher getrennt voneinander entwickelt haben (vergl. Schulz, W.; 1997; 3). Die Verbindung von Nachrichten- technik und Computertechnik oder auch die Verschmelzung der Telekommunikation und In- formatik zur sog. „Telematik“12 haben zum Entstehen neuer Anwendungsmöglichkeiten auf dem Informations- und Kommunikationssektor geführt. Für Oliver Hauf markiert der Begriff der IuK-Technologien „[...] die enge Verflechtung der technischen Artefakte untereinander sowie mit diversen gesellschaftlichen Faktoren [...]“ (ebd.; 32). Besonders innerhalb der Techniksoziologie wird immer wieder auf die enge Wechselbeziehung zwischen Technik und Gesellschaft hingewiesen. Technologische Entwicklung folgt keinesfalls eigenen Gesetzmä- ßigkeiten, sondern ist immer in gesellschaftliche Zusammenhänge eingebettet. „Technische Entwicklungen erzeugen ’Sachzwänge’, die den Lauf sozialer Prozesse stark beeinflussen. Andererseits bewirken soziale Bewegungen bestimmte Formen von Technik“ (Jokisch, R.; 1982; X).
Der enge Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Prozessen und Technisierung zeigt sich auch bei Gernot Wersig. Für ihn wird die Entwicklung der Moderne von drei Triebkräften bestimmt. Diese drei Kräfte sind Rationalisierung, Autonomisierung und Technisierung. Durch ihr Zusammenspiel bedingen sie die Dynamik der Moderne (vergl. Wersig; 1993; 59). Wir nehmen unsere Welt als etwas wahr, das nach bestimmten Regelmäßigkeiten funktio- niert. Nach diesen richten wir unser Handeln aus. Dieses rationale Handeln wird dadurch legitimiert, daß es auf Vernunft basiert und somit für jedermann erkennbar und nachvollzieh- bar ist. Unser Wissen über die Gesetzmäßigkeiten der Welt wächst ständig. Dabei ist neues Wissen dem vorangegangenen stets überlegen. Wir sammeln neue Erkenntnisse und ersetzen durch sie altes Wissen. Somit wird der Prozeß der Rationalisierung immer weiter vorangetrie- ben. Gleichzeitig steigt jedoch damit auch ständig der Grad der Komplexität, die uns umgibt. Die Moderne schuf damit „[...] ihren eigenen Mechanismus des ständigen Komplexitätszu- wachses, der sein eigener Bewertungsmaßstab wurde“ (ebd.; 59). Für rationales Handeln haben sich unterschiedliche Handlungsbereiche herausgebildet, in denen unterschiedliche Rationalisierungsmuster verfolgt werden. Die Autonomisierung13 diese Handlungsbereiche kann auf unterschiedlichen Ebenen vonstatten gehen. Zum einen treten immer autonomer werdende Individuen hervor. Auch kommt es zu einer Autonomisierung der Rationalität selbst in Form von Wissenschaft. Des weiteren findet eine Trennung zwischen verschiedenen Sphären statt, wie zum Beispiel von Alltag und Nicht-Alltag, Privatsphäre und Öffentlichkeit oder System und Lebenswelt, wie Habermas es beschreibt. Technisierung schießlich steht in einem engen Verhältnis zur Rationalisierung und zur Autonomisierung. Rationalisierung bringt Technologisierung hervor, andererseits bestimmen Techologien auch, in welche Rich- tung die Rationalisierung vorangetrieben wird. Ein Merkmal vieler Technologien ist, daß sie einer spezifischen Anwendung dienen und somit auf ganz spezielle Handlungsbereiche ausge- richtet sind. Sie fördern damit die Autonomisierung der verschiedenen Handlungsbereiche. Auf der anderen Seite wirkt die Autonomisierung wieder auf den Prozeß der Technikbereit- stellung zurück. Sowohl die Herausbildung verschiedener Technikbereiche, als auch die Ausdifferenzierung der einzelnen Prozeßstufen (z.B. Grundlagenforschung, Konstruktion, Produktion) werden durch sie beeinflußt.
3.2. Die neuen Qualitäten der IuK-Technologien
Durch die Einführung und Distribution der IuK-Technologien verändern sich viele Bereiche des menschlichen Lebens. Wodurch zeichnen sich jedoch die neuen Informations- und Kom- munikationstechnologien aus? Was sind ihre neuen Qualitäten? Um diese Frage zu klären, greife ich zunächst auf Gernot Wersigs Modell der Entwicklung der Kommunikationsmittel zurück. Nach Wersig lassen sich Kommunikationsmittel in Hinblick auf folgende sechs Di- mensionen betrachten:
1. energetisch - materiell
2. räumliche Distanz
3. zeitliche Distanz
4. potentieller Streuungsgrad
5. Wechselseitigkeit
6. Bandbreite der Übertragung
Die erste Dimension bezieht sich auf die Übertragungsart, die zwischen Sender und Empfän- ger stattfindet. Die Übermittlung kann dabei materieller oder energetischer Art sein. Materiell meint dabei, daß in irgendeiner Form Materie transportiert wird, zum Beispiel in Form einer Zeitung, eines Videobandes oder einer CD. Auf der anderen Seite kann die Übertragung in energetischer Form erfolgen, indem Signale übermittelt werden. Diese Form der Übertragung findet vor allem bei den „elektronischen Medien“ statt, wie zum Beispiel beim Fernsehen, Radio oder auch beim Internet. Aber auch hier kann durch den Einsatz von Speichermedien wie Videokassette, Tonband oder Diskette auf materielle Übermittlung zurückgegriffen wer- den. Die zweite Dimension bezieht sich auf die räumliche Distanz, die durch das Medium überbrückt wird. Wersig unterscheidet der Einfachheit halber lediglich zwischen geringen, mittleren und großen Distanzen. Die Distanzen, die mittels Kommunikationsmittel überbrückt werden können, haben sich grundsätzlich durch die Entwicklung neuer Kommunikationsmit- tel, aber auch durch die Ausweitung bereits bestehender Medien, unweigerlich vergrößert. Kommunikationsmittel überbrücken jedoch nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche Dis- tanzen. Bei der zeitlichen Distanz unterscheidet Wersig zwischen zeitlicher Abhängigkeit und zeitlicher Unabhängigkeit. Zeitpunktabhängigkeit bedeutet, daß für eine erfolgreiche Über- mittlung Sender und Empfänger gleichzeitig am Kommunikationsprozeß teilnehmen. Zum Beispiel muß, um eine bestimmte Sendung im Fernsehen zu sehen, das Gerät zu einer be- stimmten Uhrzeit eingeschaltet sein. Die vierte Dimension bezieht sich auf den Streuungsgrad, den ein Medium erreicht. Damit ist die Anzahl der potentiellen Rezipienten gemeint, die auf das Medium zugreifen können. Beispiele für einen hohen Streuungsgrad sind die Massen- oder Verteilmedien wie Zeitung, Radio oder Fernsehen. Die Dimension der Wechselseitigkeit bezieht sich auf die Rückkanalfähigkeit eines Mediums. Diese ist bei reinen Verteil- oder Massenmedien eher gering gegenüber interaktiven Medien. Die sechste Dimen- sion erfaßt die Bandbreite der Übertragung von Kommunikationsmedien. Breitbandige Kommunikationskanäle erlauben dabei die gleichzeitige Übermittlung vieler unterschiedli- cher Dimensionen.
Wie Wersig selbst einräumt, ist dies Modell stark vereinfacht. Anhand dieser Dimensionen läßt sich jedoch die Entwicklung der Kommunikations- und Informationstechnologien veran- schaulichen. Besonders bei den Dimensionen räumliche Distanz, Streuunggrad und Bandbreite hat sich die Leistungsfähigkeit der „neuen Medien“ entscheidend erhöht (siehe Abbildung 3). Trotz der erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten der neuen Medien sind die bisherigen Medien nicht dem Untergang geweiht. So ist es in höchstem Maße unwahr- scheinlich, daß beispielsweise das Internet das Fernsehen oder das Radio verdrängen wird. Die „neuen“ Kommunikationsmedien erweitern vielmehr das verfügbare Spektrum. „[Ein] neues Medium löst ein altes nicht ab, aber es verändert seine Funktion, es führt zu Funktions- verschiebungen“ (Schneider, I.; 1997; 43).
Das hier angeführte Modell hat gezeigt, daß sich mit den neuen IuK-Technologien die Mög- lichkeiten in fast allen von Wersigs sechs Dimensionen erhöht haben. Die IuK-Technologien, allen voran das Internet mit all seinen Diensten, scheinen jedoch besonders durch drei Attri- bute geprägt, welche ihre „Neuheit“ ausmachen. Diese sind Interaktivität, Multimedialität und die Entwicklung globaler Netzwerke. Diese drei Attribute sollen im folgenden noch einmal genauer beleuchtet werden.
Abbildung 3: Leistungsfähigkeit von Kommunikationsmitteln
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an Wersig, G.; 1983; 23.
3.2.1. Interaktiviät
Viele machen die Neuartigkeit der IuK-Technologien vor allem an ihrer Fähigkeit zur Interak- tivität fest. Bei Wersig findet sich dieser Aspekt in der Dimension der Wechselseitigkeit. Interaktion kann zunächst als ein aufeinander bezogenes Handeln zweier oder mehrerer Per- sonen definiert werden. Diese wechselseitige Bezogenheit muß sich jedoch nicht unbedingt auf Personen beschränken. Im Falle von interaktiven Medien wird davon ausgegangen, daß das aufeinander bezogenes Handeln auch direkt zwischen Mensch und Maschine stattfinden kann. Der Mediennutzer hat dabei die im Hinblick auf Auswahl des Inhaltes, Struktur der Darstellung oder der Präsentationsgeschwindigkeit die Möglichkeit, auf das Medium einzu- wirken. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte „ Hypertext “. Mittels Verweisen und Verknüpfungen im Text kann der Nutzer zwischen den verschiedenen Seiten wechseln und somit auswählen, welche Informationen er aus dem Angebot abrufen möchte. Diese Art der „Interaktivität“ ist jedoch weder sehr weitreichend, noch unbedingt neu. Bei jedem Printme- dium hat der Leser die Möglichkeit, nur die Abschnitte zu lesen, die er für wichtig erachtet, oder aber andere Dinge zu überspringen. Wem die Zeit fehlt, eine Zeitung von vorne bis hin- ten zu lesen, wird sich die Artikel heraussuchen, die ihn am meisten interessieren. Auch in Bezug auf die Diskussion um ein interaktives Fernsehen stellt sich die Frage, ob diese Art der Interaktivität mehr bietet als eine erweiterte Selektivität, die bisher auch schon vorhanden war. Cliffort Stoll meint dazu: „Interaktives Fernsehen eröffnet die Wahl zwischen vielen verschiedenen Ereignisvarianten, die vorprogrammiert sind. Das Erlebnis ist ungefähr so in- teraktiv wie ein Zigarettenautomat“ (Stoll, C.; 1996; 42). Eine konkretere Definition von interaktiven Medien bietet Peter Seeger an. Er versteht unter Interaktivität, daß ein Medium es dem Empfänger gestattet, in technischer, inhaltlicher und sozialer Hinsicht potentiell auch zum Sender zu werden. Das bedeutet, daß zwischen Sender und Empfänger ein Rollentausch stattfinden kann (vergl. Seeger, P.; 1996; 339). Derartigen interaktiven Medien stehen unidi- rektionale Medien, wie die klassischen Massenmedien, gegenüber.14 Im Internet lassen sich auch für diese Art von Interaktivität Beispiele finden. Darunter würden E-Mails, Diskussions- foren (News-Groups), Chat-Gruppen oder auch MUDs (Multi-User-Dungeons)15 fallen. Diese lassen sich weiterhin im Hinblick auf die zeitliche Dimension unterscheiden. E-Mails und News-Groups stellen eine asynchrone Kommunikationsform dar und sind somit zeitpunktunabhängig. Dagegen setzt die Kommunikation innnerhalb von MUDs und Chat-Gruppen die gleichzeitige „Anwesenheit“ voraus. Eine weitere Definition, welche die bisher genannten einschließt, bieten Ulrich Riehm und Bernd Wingert an. Sie unterscheiden zwischen „drei elementaren Stufen der Interaktivität“ (Bollmann, S.; 1995; 29):
1. einfache, oft binäre (z.B. „ja“ oder „nein“) Interaktion als punktuelle Reaktion auf ein vorgegebenes Programm
2. Beeinflussung eines Programms durch die Gestaltung von dessen Ablauf im Rahmen vor- gegebener Möglichkeiten
3. eigenständige Gestaltung eines Programms, die gegeben ist, wenn der Rezipient jederzeit auch als Sender auftreten kann
Vor allem die dritte Stufe der Interaktivität wird in Bezug auf das Internet von wachsendem Interesse. Das Internet verbindet mit seiner Struktur nicht nur Menschen miteinander, sondern entsteht erst durch ihre Vernetzung miteinander. Somit ist die Person am heimischen Compu- ter „Nutzer des Netzwerks und zugleich Teil des Netzwerkes selbst“ (Hauf, O.; 1996; 84). Dies kann entweder durch die Teilname an einer Diskussions- oder Chat-Gruppe oder z.B. auch durch die Publikation eigener Dokumente im Netz geschehen. Verglichen mit anderen Medien ist durch das Internet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit entstanden, etwas zu publizieren und somit seine Individualität expressiv zu artikulieren (vergl. Wersig G.; 1985; 191 ff und 1996;113 f.). Dadurch sind neue Räume für die Erprobung der eigenen Kreativität entstanden. Zum Beispiel können selbst verfaßte Texte oder Gedichte mittels In- ternet einer großen Anzahl von Menschen zugänglich gemacht werden. Die Möglichkeiten, sich zu Wort zu melden, und sich anderen mitzuteilen, wachsen. Damit steigen die Chancen, Gleichgesinnte zu finden, um etwa Handlungen zur Umsetzung gemeinsamer Ziele zu koor- dinieren.
3.2.2. Multimedialität
1995 wählte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) „Multimedia“ zum „Wort des Jah- res“. Wie auch der Begriff der Informations- und Kommunikationstechnologien nahelegt, geht es dabei um eine Zusammenführung verschiedener Darstellungs- und Übermittlungsfor- men. Somit stehen die IuK-Technologien in einem engen Zusammenhang mit dem Begriff Multimedia. Unter Multimedia wird die Intergration bisher getrennter Kommunikationstech- niken wie Sprache, Text, Bild, Ton, etc. verstanden (vergl. Enquete-Kommission; 1998; 29, Bühl, A.; 1996; 47 und Boehringer, P.; 1995; 13 ff). Einige verbinden darüber hinaus mit dem Begriff Multimedia auch interaktive Nutzungsmöglichkeiten. Es geht jedoch beim Begriff Multimedia vorrangig um das, was Wersig mit der Dimension der Bandbreite benennt. Diese ist bei den IuK-Technologien erheblich größer als bei den bisherigen Medien. Ausschlagge- bend ist dabei vor allem der Prozeß der Digitalisierung, der es erlaubt, Text, Bild und Ton unabhängig vom Übertragungsweg in digitaler Form zu speichern, zu verarbeiten und zu transportieren. Die Übertragungsgeschwindigkeiten der Netze stellt bisher noch eine Barriere für eine effektive Nutzung multimedialer Möglichkeiten dar. So ist beispielsweise das Her- runterladen von Filmsequenzen aus dem Internet mit sehr langen Wartezeiten verbunden.
Einige vertreten die Ansicht, daß Dank der großen multimedialen Bandbreite, welche z.B. dem Internet eigen ist, die unterschiedlichen bisher getrennten Medien in einem „Hybridme- dium“ verschmelzen werden. Die Vorstellungen gehen dahin, daß man in Zukunft nur noch ein „multimediales Endgerät“ besitzt. „Telefon und Telefax, Bildschirmtext und Videotext, Radio und Fernsehen können [...] schon bald aus ein und demselben Übertragungsmedium zugeführt und in multifunktionalen Allzweckgeräten aufbereitet und verarbeitet werden“ (Hoffmann-Riem, W. und Vesting, T.; 1995; 12). Ob ein solches „multimediales Allzweck- medium“ in Zukunft Verbreitung findet, bleibt jedoch abzuwarten. Die Funktionalität medialer Geräte erweitert sich zwar ständig , dies muß jedoch nicht zwangsläufig zu einem „Alles-in-einem-Medium“ führen. Ausschlaggebend dafür ist nicht die technische Möglich- keit, ein solches Gerät herzustellen, sondern ob ein solches Gerät von den Menschen als sinnvoll angesehen wird oder nicht. Die Vorstellung von einer „multimedialen Zukunft“ läßt sich jedoch auch auf eine andere Weise interpretieren. Der durch die IuK-Technologien aus- gelöste Innovationsprozeß bringt gleichzeitig Differenzierungsprozesse mit sich. Die Zahl der Medienangebote ist in den letzten Jahrzehnten explosionsartig angestiegen. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn man die Vielzahl der Fernsehsender, die über Kabel oder Satellit zu empfangen sind oder auch die vielen verschiedenen Zeitschriften betrachtet, zwischen denen der Einzelne auswählen kann. Ein großes Publikum, wie es die klassischen Massenmedien anzusprechen vermochten, kommt nur noch selten zusammen. Gemeinschaftserlebnisse, die früher durch sie vermittelt wurden, werden immer mehr zur Seltenheit. Das bedeutet, daß der potentielle Streuungsgrad durch die gewachsene Medienvielfalt gesunken ist. Dies führt dazu, daß sich die Anbieter an immer kleineren Publikumssegmenten orientieren müssen. Der Ein- fluß der Massenkommunikation sinkt zugunsten einer Individualkommunikation, die z.B. durch Sparten-Progamme und Special-Interest-Angebote zum Ausdruck kommt. Mit der Ori- entierung der Medien an einzelnen Publikumssegmenten sind auch neue Konzepte der Medienangebote entstanden, wie z.B. pay-per-use oder video-on-demand. Die zunehmende Individualisierung und Differenzierung der Medienangebote bedeutet jedoch nicht, daß die integrierende Funktion der Medien verschwindet und es dadurch zu einer Segmentierung oder gar „Atomisierung“ der Gesellschaft kommt. Der einzelne Nutzer besitzt in der Regel eine große Anzahl an individuellen Bedürfnissen, die durch die Nutzung verschiedener unter- schiedlicher Kommunikationsangebote befriedigt werden. „Die Existenz eines Spartenprogrammes für Angler bedeutet eben nicht, daß Angler nur noch diesen Kanal nutzen; denn sie sind zugleich womöglich interessierte Staatsbürger, Fans von Hollywoodfilmen und intensive Reiseliteratur-Leser“ (Enquete-Kommission; 1998; 97).
3.2.3. Globale Vernetzung
Durch die Zusammenführung von Computer- und Telekommunikationstechnik ist die Ver- bindung bisher isoliert arbeitender, lokaler Rechner ermöglicht worden. Diese Entwicklung stellt die Grundlage für das Entstehen eines weltumspannenden Netzwerkes dar. Mit der Ent- wicklung des Internets ist die Vernetzung der einzelnen Rechner sprunghaft angestiegen. Zwischen 1989 und 1996 stieg die Zahl der weltweit vernetzten Rechner von 80 000 auf etwa 2,5 Mio. (vergl. Rehbinder; M. 1996; 89). Bezogen auf das Kommunikationsmodell von Wer- sig, bedeutet die fortschreitende globalen Vernetzung eine höhere Leistungsfähigkeit bei der Überbrückung von räumlicher Distanz. Damit wächst die Menge der weltweit verfügbaren Daten bei einer gleichzeitigen Verkürzung der Zugriffszeit auf sie. Eng verbunden mit der voranschreitenden Vernetzung durch IuK-Technologien ist der von Marshall McLuhan ge- prägte Begriff vom „global Village“. Im Gegensatz etwa zum Bild des „Information- Highways“ beschreibt McLuhans Metapher vom globalen Dorf jedoch nicht in erster Linie die Überbrückung großer räumlicher Distanzen. Sein Bild impliziert vielmehr ein Zusammen- rücken der Menschen, die weltweit mittels moderner Kommunikationstechnologie verbunden sind. Mit dem Internet sind neuartige soziale Räume entstanden, die vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation und Interaktion untereinander bieten. Dabei spielen die Entfernungen, die zwischen den einzelnen Personen liegen, kaum mehr eine Rolle. Der Kommunikationspartner kann sich dabei ebenso im Nachbarort, als auch in Australien aufhalten. Es besteht die Mög- lichkeit, eine Vielzahl virtueller „Treffpunkte“ und „Plätze“ aufzusuchen, um andere Personen kennenzulernen und mit ihnen zu interagieren. Das Internet „bringt [...] als virtuelles Forum gewisse Elemente des Markplatzes wieder, was einen Schritt zurück - nicht unbedingt aber einen Rückschritt - bedeutet“ (Rehbinder; M. 1996; 88). Die Möglichkeiten, global mit- einander zu kommunizieren und in „virtuellen Räumen“ zusammenzukommen, werden als Chance gesehen, für die Bildung von sogenannten „Online-Gemeinschaften“16. Dabei sollen sich nicht nur räumliche, sondern zugleich auch soziale Barrieren überbrücken lassen. Man muß sich jedoch zunächst fragen, in welcher Weise die Struktur des Internets überhaupt dazu geeignet ist, gemeinschaftsfördernd zu wirken.
Um der Frage nachzugehen, in wieweit sich durch das Internet Gemeinschaften bilden kön- nen, greife ich auf Max Weber zurück. Weber unterscheidet zwischen den beiden Begriffen Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung.17 Vergemeinschaftung definiert er als eine sozi- ale Beziehung, welche auf der subjektiv gefühlten Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kann affektueller, emotionaler oder traditionaler Natur sein. Im Gegensatz dazu versteht Weber unter dem Begriff Vergesellschaftung soziale Beziehungen, welche auf einem zweckrationalen oder wertrationalen Interessenausgleich bzw. Interessenzusammenschluß basieren (vergl. Weber, Max; 1972; 21). Wenn man nun die Webersche Definitionen von Vergemeinschaftung auf den sogenannten „virtuellen Gemein- schaften“ des Internets anwendet, muß man sich fragen, in wieweit hier überhaupt die Voraussetzungen für die Herstellung eines affektiven Zusammengehörigkeitsgefühls der Mit- glieder untereinander gegeben sind. Zunächst einmal ist die Kommunikation im Netz durch die große Vielfalt der Angebote geprägt, welche dem Nutzer zur Verfügung stehen und zwi- schen denen er zu wählen hat. Dies schafft die Voraussetzung für eine Differenzierung der Netzkommunikation. Das bedeutet, es bilden sich viele kleine Online-Gruppen, deren Mit- glieder ein spezifisches Interesse teilen. Dies kann ein ausgefallenes Hobby sein, aber auch nur das Interesse sich in einem Chat-Kanal oder in einer Diskussionsgruppe miteinander zu unterhalten. „Die Struktur des Netzes fordert geradezu dazu auf, sich immer weiter zu spezia- lisieren und die eigenen Interessen, Wünsche, Hobbys immer feiner mit den Netzreisenden auszugleichen“ (Heuser, U. J.; 1996; 135). Emotionale Bindungen unter den somit verbunde- nen Gleichgesinnten bleiben jedoch meistens aus, da das Internet die Menschen damit vorrangig „thematisch“ zusammenbringt. Daß dabei auch traditionelle soziale Barrieren ü- berwunden werden, liegt vor allem daran, daß das Thema und nicht die Person im Vordergrund steht. Das Internet dient dabei als ein „[...] kooperativ strukturiertes System zum Austausch von Informationen“ (Schneider, I.; 1997; 47). Somit entstehen zweckrationale Verbindung von Menschen, die gleiche Interessen haben und diese verfolgen. Dies verweist auf Webers Begriff der Vergesellschaftung.
Online-Kommunikation ist jedoch oftmals nicht auf reinen Informationsaustausch ausgerich- tet, sondern auch auf „[...] die Suche nach sozialen Beziehungen, nach ‘Gesprächspartnern‘, nach neuen Gruppen [...]“ (ebd.; 47). Diese Suche kann jedoch nur bedingt zum Ziel führen. „Die Idee einer elektronischen Vergemeinschaftung wird ja damit begründet, daß Kommuni- kation in den Netzen analog zur Kommunikation zwischen Personen sich rekonstruieren lasse“ (Gräf, L.; 1997; 142). Man geht dabei davon aus, daß sich bei der Online- Kommunikation in gleicher Weise durch geteilte Erfahrungen, Regeln und Rituale ein „Wir- Gefühl“ entwickeln kann. Es gibt jedoch zwei wesentliche Aspekte, welche die elektronische Kommunikation im Netz von der Kommunikation außerhalb des Netzes unterscheiden. Zu- nächst gestaltet sich der Aufbau einer affektiven Beziehung zwischen den Nutzern als problematisch, da der einzelne Teilnehmer während der Online-Kommunikation ein Pseudo- nym bleibt (vergl. Brauner, J. u. Brickmann, R.; 1996; 101). Die Kommunikation ist in den meisten Fällen rein textbasiert. Dies bietet Raum für Maskerade und Anonymität. Das Gegen- über bleibt immer zu einem gewissen Grad ungewiß, da „[...] die Möglichkeiten einer personalen Identifizierung fehlen [...]. Das Netz integriert keine Personen, weil es die Identi- tätsbedingungen einer Person nicht bereitstellt“ (Wehner, J.; 1997; 142 f.). Anonymität und Unsicherheit der elektronischen Kommunikation erschweren damit das Aufkommen eines emotionalen Zusammengehörigkeitsgefühls. Der zweite Punkt ist die „Flüchtigkeit“ innerhalb Netzkommunikation. Online-Gruppen unterliegen einer sehr viel höheren Fluktuation als Gemeinschaften außerhalb der Computernetze (vergl. Gräf; L.; 1997; 116). Sie besitzen eine hohe Offenheit. Es ist nicht nur leicht, sich einer solchen Gruppe anzuschließen, es existieren auch nur geringe Austrittsschranken. „Verglichen mit lange gewachsenen Gemeinschaften sind die Bindungen zwischen den Netzreisenden naturgemäß flüchtig. Easy come, easy go: Kontakte in der virtuellen Welt entstehen schnell und finden ebenso schnell ihr Ende“ (Heu- ser, U. J.; 1996;137).
Trotz dieser Schwierigkeiten ist es dennoch nicht auszuschließen, daß Online- Kommunikation neue Gemeinschaftbeziehungen stiftet. Brauner und Brickmann führen an, daß sich über die thematischen Diskussionen Bekanntschaften und Freundschaften entwickeln können. Der „virtuellen“ Begegnung folgt beispielsweise dann auch ein persönlicher Besuch. In diesem Sinne werden durch das Internet neue Türen für gesellschaftlichen Austausch ge- öffnet. „So gelingt eine erste Kontaktaufnahme ohne allzu förmliche Wege“ (Brauner, J. u. Brickmann, R.; 1996; 101). Aber auch hier gilt, daß die Anzahl der Personen, mit denen man eine enge Beziehung pflegt, begrenzt ist. Persönliche Beziehungsnetzwerke können zwar durch die Kommunikationsmöglichkeiten im Netz vergrößert werden, dabei verringert sich jedoch gleichzeitig ihre interne Dichte. „Die Mitgliedschaft in einer Diskussionsliste z.B. schafft einen Fundus von weak ties. Diese schwachen Beziehungen sind in der Regel nur po- tentielle Beziehungen und werden erst durch Inanspruchnahme zu Beziehungen“ (Gräf; L.; 1997; 117). Online-Kommunikation schafft keine neuen Gemeinschaften. Diese bilden sich wie bisher außerhalb der „virtuellen Netzwelten“. „Kommunikation in Netzwerken ist und bleibt [...] Fast-food-Kommunikation, eine tatsächliche interpersonale Bindung wird erst möglich, wenn neben die Netzwerkenkommunikation das persönliche Erleben tritt“ (Brauner, J. u. Brickmann, R.; 1996; 107).
3.3. Anwendungsfelder der IuK-Technologien
In vielen Bereichen finden heute IuK-Technologien mit all ihren Attributen Anwendung. Dort werden durch sie vor allem neue Handlungsoptionen geschaffen. Sie eröffnen zum Teil neue Möglichkeiten der Flexibilität und somit der individuellen Anpassung innerhalb des jeweili- gen Bereichs. Im Folgenden soll die Anwendbarkeit der IuK-Technologien innerhalb von drei verschiedenen Bereichen kurz erläutert werden. Dabei beziehe ich mich auf das wirtschaftli- che Potential der neuen Technologien, die Telearbeit sowie den Bereich der Bildung und Weiterbildung.
3.3.1. Ökonomisches Potential
Die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien gelten als neue Schlüsseltechno- logien der Wirtschaft. Neue Produkte und Dienstleistungen entstehen und somit auch neue Märkte. „Die Informationsgesellschaft mit all ihren Facetten stellt einen beispiellosen Wachs- tumsmarkt dar. Sie wird eine gewaltige Anzahl neuer Produkte schaffen, die unmittelbar auf Telekommunikation basieren (Hultzsch, H.; 1995; 77).“ Im Jahre 1993 erreichte die „Infor- mationswirtschaft“ weltweit ein Volumen von 3.281 Milliarden Mark (siehe Abbildung 4). Den größten Anteil daran hatte mit 787 Mrd. DM der Bereich der Telekommunikation. In den vergangenen Jahren konnte die „Informationswirtschaft“ einen enormen Zuwachs verzeich- nen. Dieser Trend wird schätzungsweise anhalten und sich nach den Vorhersagen noch verstärken. Das Bundesministerium für Wirtschaft geht von Wachstumsraten zwischen sieben und fünfzehn Prozent aus. Im Jahre 1994 lag der Gesamtumsatz der „Informationswirtschaft“ in Deutschland bei 382 Mrd. DM, was 11% des Bruttoinlandsproduktes entspricht (BMWi; 1995; 60).
Abbildung 4: Weltmarkt Informationswirtschaft 1993 gesamt 3.281 Mrd. DM
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BMWi; 1995; 60.
Man kann die Informations- und Kommunikationstechnologien als die Basisinnovation des ausgehenden Jahrhunderts betrachten. Durch sie wird eine langanhaltende wirtschaftliche Investitions- und Wachstumsphase eingeleitet, ein sog. Kontratieff-Zyklus18. Vier dieser Zyklen hat es bisher schon gegeben. Die Basisinnovationen, durch welche sie ausgelöst wurden, waren die Dampfmaschine, die Eisenbahn, das Auto und schließlich das Flugzeug und die Kunststoffe. Die neuen IuK-Technologien sollen nun den fünften Zyklus einleiten (vergl. BMWi; 1995; 2 und Wagner, R.; 1996; 3).
3.3.1.1. Homeshopping
Eine neue Möglichkeit, Produkte direkt dem Endverbraucher zur Verfügung zu stellen, bietet „Homeshopping“ bzw. „E-Commerce“. Voraussetzung für Dienste dieser Art ist ein Endgerät (z.B. Computer) und eine rückkanalfähige Kommunikationsstruktur, wie sie etwa das Internet besitzt. Der Kunde kann von zu Hause aus Angebote abfragen, sich über Produkte informie- ren und diese gegebenenfalls sofort bestellen. Diese Art des Einkaufs-Sevice wird bereits seit Jahren im Versandhandel oder auch mittels Fernsehen (Teleshopping) erfolgreich praktiziert. In der USA lag beispielsweise im Jahre 1994 der Umsatz durch Teleshopping bei über 75 Milliarden Dollar (siehe Boehringer P.; 1995; 27). Immer mehr wird auch auf die neuen IuK- Technologien zurückgegriffen, um Produkte zu vertreiben. Im Winter 1994/95 brachte z.B. der Versandhändler OTTO seinen Katalog als CD-ROM heraus (ebd.; 27). Immer häufiger werden auch Produkte direkt über das Internet angeboten und lassen sich darüber bestellen. Die Vorteile der neuen Medien liegen vor allem in den neuen multimedialen Darstellungs- möglichkeiten. Bilder, Töne und Videosequenzen können kombiniert werden, um die Angebote in möglichst ansprechender Form zu präsentieren. Auf der Nutzerseite liegen die Vorteile in der zeit- und ortsunabhängigen Zugangsmöglichkeit zu bestimmten Produkten und Diensten. Trotz dieser Vorteile stellt sich die Frage, in wieweit Kunden überhaupt gewillt sind, von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Peter Boehringer gibt an, daß bei gleichen Preisen wie im Versandhandel die Bereitschaft, Homeshopping-Angebote zu nutzen, in Deutschland bei lediglich 26 % liegt. Er geht davon aus, daß für die Akzeptanz von Home- shopping vor allem „[...] die Benutzerfreundlichkeit und die optische Gefälligkeit der Ange- bote via Bildschirm ausschlaggebend [sein wird]“ (ebd.; 27). Daneben ist auch die Frage nach dem Datenschutz von großer Bedeutung. Eine verstärkte Inanspruchnahme von Angeboten im Netz, wird nur dann erfolgen, wenn der Nutzer auch auf die Sicherheit seiner persönlichen Daten vertrauen kann.
3.3.1.2. Virtuaslisierung des Geldes
Mit der Vermehrung der Angebote, die online über das Netz verfügbar sind, kommt die Frage auf, auf welche Weise der Nutzer diese bezahlen soll. Um „virtuelle Käufe“ zu tätigen, braucht man auch eine Art „virtuelles Geld“. Daß man sich hier eines abstrakten Zahlungsmit- tel bedient, ist durchaus nicht neu. Patrick Schmidli führt an, daß Zahlungsmittel im Laufe der Entwicklungsgeschichte„ [...] im wahrsten Sinne des Wortes immer unfaßbarer und damit immer abstrakter [wurden]“ (Schmidli, P.; 1997; 289). Bereits vor zweieinhalbtausend Jahren ging man dazu über, den Tauschhandel durch die Einführung des Geldes als Zahlungsmittel zu vereinfachen. In unserem heutigen Alltag wird der Zahlungsverkehr immer häufiger bar- geldlos abgewickelt. Geld wird immer stärker zu einer „symbolischen Größe“. Wir verwenden Schecks, Überweisungen, Kreditkarten oder auch Chipkarten. Der Umgang mit dem „Plastikgeld“ ist uns vertraut und für uns alltäglich geworden. Es ist heute äußerst unüb- lich, daß größere Anschaffungen, wie zum Beispiel ein Neuwagen, mit Bargeld bezahlt werden. Man kann heute in den meisten Bereichen ganz auf Bargeld verzichten, wenn man die entsprechenden Plastikkarten besitzt „[...] - nur diejenigen, die wenig haben, werden [das Geld] noch sinnlich spüren, diejenigen, die etwas mehr haben, haben eher symbolische Nachweise“ (Wersig, G.; 1993; 18). Versuche gehen nun in die Richtung, „digitales Geld“ einzuführen. Ziel ist es, Online-Dienste „bezahlbar“ zu machen. Man möchte, daß „[...] der elektronische Zahlungsverkehr auch für den Internet-Dschungel zuverlässig [gemacht wird]“ (Schmidli, P.; 1997; 290). Die Schwierigkeit, die sich dabei ergibt ist, wie man diese „elekt- ronische Währung“ sicher gestalten und vor Mißbrauch schützen kann. Es gibt dafür verschiedene Lösungsansätze, die von Karten mit Mikrochips (Smartcard) über elektronische Verschlüsselungssysteme bis hin zu sog. „Cyberbucks“ reichen. Die Frage, ob digitales Geld wirklich ein zuverlässiges und sicheres Zahlungsmittel darstellt, bleibt jedoch bestehen. Der Wunsch jedoch, die kommerziellen Möglichkeiten der digitalen Netze zu nutzen, treibt die „Virtualisierung des Geldes“ voran. Gernot Wersig steht dieser Entwicklung skeptisch gegen- über. Der Geld- und Warenkreislauf wird „[...] für den Alltagsmenschen immer weniger offensichtlich und er wird immer anfälliger für Manipulationen und Irrtümer“ (Wersig, G.; 1993; 20).
3.3.2. Telearbeit
IuK-Technologien schaffen mit ihren technischen Möglichkeiten neue Arbeitsformen. Eine vieldiskutierte Anwendungsmöglichkeit ist die „Telearbeit“. Telearbeit hat zwar in den letzten Jahren starke Beachtung gefunden, ihre Bedeutung für die Arbeitswelt ist bis heute jedoch als eher gering einzustufen. Die Arbeit ist durch den Einsatz von IuK-Technologien nicht mehr zwingend an einen festen Arbeitsplatz gebunden. Telearbeit macht es möglich, daß die Arbeit räumlich entkoppelt werden kann. Korte definiert Telearbeit als „[...] wohnortnahe Arbeit unabhänig vom Firmenstandort unter hauptsächlicher Nutzung von I- und K-Technik“ (zit. nach Dostal, W.; 1995, 537). Im Rahmen dieser Definition sind verschiedene Spielarten der Telearbeit möglich. Zunächst kann Telearbeit im „klassischen“ Sinne in der häuslichen Um- gebung stattfinden. Das heißt, daß der größte Teil der Arbeitszeit zu Hause verbracht wird. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von „Teleheimarbeit“. Eine weitere Variante sind sogenannte „Telearbeitszentren“ oder „Nachbarschaftsbüros“. Bei diesem Konzept nutzen Mitarbeiter einer oder auch mehrerer Unternehmen gemeinsam Bürofläche, die z.B. durch Dritte für diesen Zweck bereitgestellt werden. Der Vorteil dieses Konzeptes für den Arbeit- nehmenden liegt darin, daß diese Telearbeitszentren in der Nähe seines Wohnorts liegen. Dies eröffnet vor allem Chancen für Arbeitnehmer in strukturschwachen Gebieten, die ansonsten einen sehr langen Anfahrtsweg zu ihrem Arbeitgeber hätten. Schließlich gibt es die Möglich- keit, daß mittels moderner Kommunikationstechnik ein vollständig „mobiler Telearbeitsplatz“ verwirklicht wird. Der Mitarbeiter hat dabei überhaupt keinen stationären Arbeitsplatz mehr und steht mittels Kommunikationsdienste (z.B. über Handy und Modem) mit seinem Arbeit- geber oder seinen Kunden in Verbindung.
Die folgende Tabelle stellt das Potential und den tatsächlichen Einsatz von Telearbeit in Eu- ropa dar (siehe Abbildung 5). Die Zahlen basieren auf einer 1994 veröffentlichten Umfrage, in deren Rahmen 5327 Personen über 14 Jahre und 2507 Führungskräfte befragt wurden. Nach dieser Untersuchung liegt Deutschland bei der Anzahl von Telearbeitern lediglich an dritter Stelle hinter Großbritannien und Frankreich. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, daß Deutschland mit seine Potiential möglicher Telearbeitsplätze eindeutig an der Spitze steht.
Abbildung 5: Realität und Potential von Telearbeitsplätzen in Europa
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dostal W.; 1995; 538.
Durch den Einsatz neuer IuK-Technologien wird ein hohes Maß an Flexibilität geschaffen.
Arbeit muß nicht mehr zwangsläufig an einen bestimmten Arbeitsplatz oder an eine festgelegte Arbeitszeit gebunden sein. Familie und Beruf werden durch Telearbeit in einer neuen Weise integrierbar. Es herrscht jedoch auch eine gewisse Skepsis, die sich in den Risiken, die man mit Telearbeit verbindet, manifestiert (siehe Abbildung 6).19
Abbildung 6: Vor- und Nachteile der Telearbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Dostal W.; 1995; 539.
Mit der durch Telearbeit neu gewonnenen Flexibilität weicht die Grenze zwischen Arbeitszeit und Freizeit auf. Die Trennlinie zwischen diesen beiden Sphären verschwimmt zunehmend. „Nicht mehr die Freizeitsphäre wird durch die Arbeitssphäre legitimiert (als „frei von Arbeit“) und als Gegenwelt verstanden [...], sondern in einer umfassenden Lebenssphäre werden gesellschaftliche und private Arbeitsanteile integrierbar und vom eigenen Interesse organisierbar“ (Wersig, G.; 1985; 179). Diese Art der Neustrukturierung erfordert zukünftig neue Organisationsformen gesellschaftlicher Arbeit.
3.3.3. Bildung und Weiterbildung
IuK-Technologien erlangen immer stärkere Bedeutung für Bildungsangebote unterschiedli- cher Art. Ihre möglichen Einsatzfelder liegen dabei sowohl in der Schule, der Hochschule als auch in der beruflichen Weiterbildung. Schon heute sind in vielen Bereichen computerge- stützte Schulungs- und Lernprogramme im Einsatz. Multimedialität, Interaktivität und Vernetzung sind auch in diesem Bereich von zentraler Bedeutung. Interaktive Elemente etwa innerhalb einer Lernsoftware, eröffnen einen Dialog zwischen Lernendem und Programm, welcher eine Anpassung an die individuellen Lernbedürfnisse zuläßt. Lernzeit, -tempo und - dauer können vom Lernenden selbst bestimmt werden. Ganze Lektionen lassen sich z.B. bei Bedarf wiederholen. Durch Multimedia wird es möglich, dem Lernenden die Lehrinhalte in unterschiedlicher Form anzubieten. Texte können durch visuelle und auditive Elemente wie Filme oder Tondokumente ergänzt werden. Dies bewirkt in erster Linie eine Motivationshilfe, die sich positiv auf den Lerneffekt auswirken kann. Peter Boehringer verweist auf Untersu- chungen, die eine Steigerung der Motivation und der Lerneffizienz durch Multimediaeinsatz um den Faktor drei feststellt haben (vergl. Boehringer, P.; 1995; 30). Edutainment ist das Stichwort, welches in diesem Zusammenhang in den Vordergrund rückt. Dahinter steht eine neue Vorstellung, wie Lernen zukünftig vonstatten gehen soll. Lernen mittels neuer IuK- Technologien soll eine spielerischen Vermittlung der Lehrinhalte ermöglichen. Zwar ist eine gewisse Skepsis angebracht, da die Qualität solcher Lehrinhalte nicht unbedingt auf hohem Niveau angesiedelt sein muß, die spielerische Komponente kann sich jedoch durchaus positiv auf das Lernen auswirken.
Lernangebote können sowohl „offline“ (z.B. als CD-ROM) als auch „online“ über Datenlei- tungen zugänglich sein. Mit der Vernetzung ergibt sich die Möglichkeit eines ortsunabhängigen Lernens über große Distanzen hinweg, sogenanntes „ Telelearning “. Die Mercedes-Benz AG nutzt diese Möglichkeit zum Beispiel dazu, um zentral von Frankfurt aus Mitarbeiter in 13 deutschen Niederlassungen per Videoübertragung zu schulen (ebd.; 31).20 „Vernetztes Lernen“ schafft viele Vorteile in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel kann Lernmaterial kostengünstig über das Netz versendet werden, Online-Recherchen im Internet durchgeführt werden, Lerngruppen über das Internet zusammenkommen oder per E-mail Rückfragen an den Professor gerichtet werden. Es existieren darüber hinaus auch Versuche zu einer „virtuellen Universität“, bei der ganze Seminare elektronisch über das Internet abgehal- ten werden.
Die Vorteile computerunterstützten Lernens liegen vor allem auf der technischen Seite. Indi- viduelle Anpassungsfähigkeit, Orts- und Zeitpunktunabhängigkeit erhöhen die Flexibilität für den Lernenden. Defizite zeigen sich jedoch besonders im sozialen Bereich, wie Abbildung 7 verdeutlicht.
Abbildung 7: Computerunterstützte Lernprogramme
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle; Schmidli, P.; 1997; 316.
Der Einsatz von IuK-Technologien im Bildungsbereich erleichtert nicht nur das Lernen im herkömmlichen Sinne. Es wird darüber hinaus auch eine ganz neue Art des Lernens eröffnet. Diese zeichnet sich durch die vergrößerte Flexibilität aus. Raum- und Ortsabhängigkeiten werden dabei aufgehoben. Lernen kann beispielsweise von Zuhause aus und zu einem belie- bigen Zeitpunkt stattfinden. Der Ablauf des Lernens muß nicht mehr fest vorstrukturiert sein. Meist stehen den Lernenden große Datenmengen zur Verfügung, die z.B. mittels Hypertext miteinander verknüpft sind. Der Lernende kann dadurch einzelne Themen aufgrund seiner eigenen Präferenzen noch weiter vertiefen. An die Stelle eines instruierenden Lernens tritt eine eigenverantwortliche und selbstorganisierte Lernform. Die wichtigste Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz von neuen IuK-Technologien beim Lernen ist die Vermittlung von entsprechenden Methoden des Lernens. Es geht darum, das Lernen zu lernen, bzw. die Technologien mit dem größten eigenen Nutzen einzusetzen. Wie bereits an mehreren Stellen herausgestellt wurde, steigt die Menge des verfügbaren Wissens stetig an. Immer schneller werden wir mit neuen Entwicklungen und Erkenntnissen konfrontiert. Ein rationales Handeln auf der Grundlage von zugänglichem Wissen erfordert eine immerwährende Anpassung und Erweiterungen der Wissensnetze des Einzelnen. „Lebenslanges Lernen“ gewinnt immer stär- ker an Bedeutung. Gerade hier bieten sich die neuen Technologien an, da sie eine flexible und individuelle Form des Lernens ermöglichen. Um diese technischen Lernmöglichkeiten effek- tiv nutzen zu können, müssen jedoch die Voraussetzung für den richtigen Umgang mit ihnen gegeben sein. Dazu gehört die bereits erwähnte Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen, aber daneben auch das, was oftmals mit dem Begriff der „Medienkompetenz“21 umschrieben wird.
4. Die Risiken der Informationsgesellschaft
Die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten von Informations- und Kommunikationstechno- logien ist längst noch nicht ausgeschöpft. Es wird weiterhin ständig nach neuen Bereichen für ihren Einsatz gesucht. Dadurch werden immer mehr Türen zu neuen Options- und Handlungs- räumen aufgestoßen. Das breite Spektrum medialer und kommunikativer Möglichkeiten schafft ein hohes Maß an Flexibilität. Vieles soll dadurch einfacher und komfortabler werden. Der allgemeine Zugang zu den unterschiedlichsten Informationsquellen soll dazu beitragen, viele unserer Probleme zu lösen. Diese Aussicht scheint die Phantasie vieler zu beflügeln. Euphorisch wird die Informationsgesellschaft oftmals als eine „Schöne Neue Medienwelt“ begrüßt. Es liegt auf der Hand, daß ein solches Bild der Informationsgesellschaft zu einseitig ist. Es wäre naiv zu glauben, daß der Wandel hin zu einer Informationsgesellschaft ohne Probleme vonstatten geht. Die Chancen, welche die Informationsgesellschaft eröffnet, gehen mit ihren Risiken einher.
Die Gesellschaft wird mit dem Aufkommen der Informationsgesellschaft immer stärker von den Technologien durchdrungen. Kommunikationskomfort und die Möglichkeit, auf immer mehr Daten zuzugreifen, hat zur Folge, daß immer mehr Rechner miteinander vernetzt wer- den. Immer mehr Bereiche wachsen zusammen. Gernot Wersig spricht in Anlehnung an Deleuze und Guattari von einem „Rhizom-Effekt“ (Wersig, G.; 1993; 25 ff). Der Begriff Rhi- zom entstammt ursprünglich der Botanik und bezeichnet weit verzweigte, überdauernde Wurzelgeflechte. Ihre oberirdischen Triebe der Rhizome sind dagegen in den meisten Fällen nur einjährig. Mit diesem Bild soll verdeutlicht werden, daß der Grad an Komplexität einer durch vernetzte Kommunikation geprägten Gesellschaft für Wersig soweit zunimmt, daß kla- re Voraussagen nicht mehr möglich sind. „Was an der Oberfläche sichtbar ist, ist nicht das, wovon die Gesellschaft lebt“ (ebd.; 26). Die informations- und kommunikationstechnischen Netzwerke durchziehen immer mehr unseren Alltag, werden jedoch dabei gleichzeitig immer weniger sichtbar. Wir machen uns immer stärker von den neuen Technologien abhängig und laufen damit Gefahr, allmählich die Kontrolle über sie zu verlieren. Alexander Roßnagels Befürchtungen lauten folgendermaßen: „Die Verletzlichkeit der Gesellschaft wird künftig ansteigen und zu einem zentralen Problem der ‘Informationsgesellschaft‘ werden“ (Roßnagel, A. u.a.; 1998; 208). Diese hier angesprochene Verletzlichkeit wird deutlich, wenn man das „Jahr-2000-Problem“22 betrachtet. Im vielen Unternehmen und öffentlichen Behörden wird fieberhaft an den notwendigen Umstellungen gearbeitet. Obwohl man zuversichtlich ist, das Problem rechtzeitig in den Griff zu bekommen, bleibt immer noch eine gewisse Unsicherheit, was tatsächlich bei der Jahrtausendwende mit vielen Daten geschehen wird. Mit der Zunahme der Nutzung von Informationssystemen wachsen Befürchtungen über die potentiellen Gefah- ren der Manipulation von Daten. Es wird die Gefahr gesehen, daß die neuen Technologien eine Art Überwachungsstaat hervorbringen, wie ihn George Orwell in seinem Roman „1984“ beschrieb. Es wird in diesem Zusammenhang vom „gläsernen Bürger“ bzw. „gläsernen Kon- sumenten“ gesprochen (vergl. Wagner R.; 1996; 129 ff). Die Diskussion, ob nun die neuen Technologien ein Segen oder ein Fluch sind, wird mit großer Heftigkeit geführt. Wersig stellt dem gegenüber fest, daß Technologien zunächst einmal „intentional neutral“ sind. Sie besit- zen lediglich „[...] Potentiale für die Eröffnung oder Verschließung von Optionsräumen, die sich auf ihre Leistungsmerkmale, Produktions- und Einsatzbedingungen etc. beziehen“ (Wer- sig, G.; 1985; 169). In welcher Weise eine neue Technologie angewandt wird, wird durch die Gesellschaft selbst bestimmt. Zum Beispiel läßt allein das Vorhandensein von Möglichkeiten der Überwachung durch neue Technologie nicht darauf schließen, daß sie auch wirklich in dieser Weise angewendet werden.
Neue interaktive Kommunikationsmedien brechen die Grenzen zwischen Medienmachern und Konsumenten auf und geben Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. „Mit der fast Komplettierung des Spektrums der technischen Kommunikationsmöglichkeiten und der Be- reitstellung technischer Alternativen für einzelne Teile des individuellen und gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses erweitert sich der Bereich der dem Menschen für Handlungen zur Verfügung stehenden Optionen innerhalb kürzester Zeit drastisch in allen Weltsegmenten“ (Wersig, G.; 1985; 171). Die neuen IuK-Technologien schaffen damit neue Freiheiten. Neu gewonnene Freiheiten können jedoch auch zu neuen Grenzen und Abhängig- keiten führen. Ulrich Beck schreibt: „Individualisierung [...] geht [...] einher mit Tendenzen der Institutionalisierung und Standardisierung von Lebenslagen. Die freigesetzten Individuen werden arbeitmarktabhängig, abhängig von sozialrechtlichen Regelungen und Versorgung, von Verkehrsplanungen, Konsumangeboten, Möglichkeiten und Moden in der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Beratung und Betreuung“ (Beck, U.; 1986; 119).
Gerade in Deutschland scheint es so, daß die möglichen Risiken der Informationsgesellschaft höher eingestuft werden, als ihre Chancen. Das BAT Freizeitforschungsinstitut führte eine Befragung unter 534 Personen im Alter zwischen 14 und 34 Jahren durch. Die Ergebnisse dieser Befragung sind in Abbildung 8 dargestellt. Dabei zeigt sich, daß bei den negativen Auswirkungen der Informationsgesellschaft vor allem die Sorge vor Vereinsamung und die Angst vor einer aufkommenden „Medienflut“ im Vordergrund stehen.
Abbildung 8:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BMWi; 1995; 62.
Manche meinen, daß sich durch die neuen Technologien viele unserer bisherigen Probleme lösen lassen (z.B. Massenarbeitslosigkeit), andere hingegen befürchten gerade durch die neu- en Technologien neue Probleme und wollen deshalb lieber ganz auf sie verzichten. Wersig schreibt dazu: „Die einen hoffen, die Fehler der Vergangenheit durch neue Technik zu besei- tigen („technischer Messianismus“), die anderen hoffen, durch die Ablehnung dieser Techniken die Beseitigung alter Fehler zu erreichen („technischer Schwarzer Peter“). Beide Seiten haben Unrecht [...] Wir müssen die neuen Techniken [...] als Herausforderung begrei- fen, die bisher gemachten Fehler zu suchen und zu korrigieren. Wir werden uns damit neue Fehler schaffen, aber so ist die Welt“ (Wersig, G.; 1993; 33). Die Informationsgesellschaft wird ihre „Gewinner“ und „Verlierer“ haben. Das heißt, es wird die Menschen geben, die in stärkerem Maße von den neuen Möglichkeiten profitieren und jene, welche sich nicht ausrei- chend an die neuen Bedingungen anpassen können oder wollen. Die Gefahr liegt darin, daß neue Klüfte entstehen, die sich durch die Gesellschaft ziehen. Wersig sieht vor allem drei Klüfte, die mit der Informationsgesellschaft auf uns zukommen (vergl. Wersig, G.; 1993; 31). Zunächst sieht er die Kluft, die zwischen denen entsteht, die Arbeit haben und denen, die auf- grund technischer Rationalisierung keine haben. Dabei werden die neuen Technologien die Tendenzen, die heute schon vorhanden sind, eher noch verstärken. Die zweite Kluft bezeich- net er als „Kapitalkluft“. Die Gewinne der Großunternehmen, die durch Technologien erwirtschaftet werden, werden nicht mehr im eigenen Land angelegt, sondern fließen im Zuge der Globalisierung in internationale Märkte. Wersig legt die Vermutung nahe, daß dadurch eine, wie er es ausdrückt; „internationale Klasse von Superreichen“ entstehen würde (ebd.; 31). Die dritte Kluft, die Wersig voraussieht, besteht zwischen denen, die den Umstieg auf die neuen Technologien schaffen und den „Computer-Analphabeten“. Es ist oft beschworen wor- den, daß die entscheidenden Ressourcen der Informationsgesellschaft Information und Wissen sind. Daneben wird ein allgemeiner und freier Informationszugang propagiert. Jeder soll die Informationen, die er benötigt, abrufen und benutzen können. Wem jedoch der Zugang zu den neuen Technologien verschlossen bleibt, bleibt zurück und muß mit Nachteilen rechnen. Die- jenigen, denen es gelingt sich die neuen Technologien anzueignen, werden die Gewinner der Informationsgesellschaft sein. Die anderen sind im wahrsten Sinne des Wortes die Dummen (vergl. Wersig, G.; 1993; 31). Ich werde mich im folgenden vor allem auf die erste und die letzte Kluft, die Wersig benennt, beziehen.
Halten wir fest: Die IuK-Technologien, die das Bild der Informationsgesellschaft prägen, be- sitzen viele Potentiale, die ein höheres Maß an Freiheit und Flexibilität schaffen. Zum Beispiel eröffnet Telearbeit neue Chancen, Beruf und Familie besser als bisher zu vereinba- ren. Die Informationsgesellschaft ist jedoch kein Patentrezept für die Lösung all unserer Probleme. Sie hat ihre Grenzen. Mit den neuen Möglichkeiten steigen gleichzeitig auch die Anforderungen an den Einzelnen. Es muß sich erst noch herausstellen, ob alle diesen neuen Anforderungen gewachsen sein werden. Werden zum Beispiel alle dazu bereit sein, die neuen IuK-Technologien anzunehmen, oder werden sich einige ihnen gegenüber weiterhin ableh- nend verhalten?
4.1. Die Knappheiten der Informationsgesellschaft
Mit der gestiegenen Bedeutung von Information wachsen auch die mit ihr verbundenen An- forderungen. Daniel Bell verweist darauf, daß die Realisierung eines bestimmten Wertes immer nur auf Kosten eines anderen geschehen kann. Er hält fest, „daß jedes Gut in der Regel Kosten verursacht, [...] und daß daher die Veranschlagung der relativen Kosten den Maßstab für den Mangel liefert“ (Bell, D; 1985; 352 f.). In Bezug auf die Kostenfrage sieht Bell das Entstehen neuer Mangelerscheinungen voraus. Diese neuen Knappheiten entstehen für ihn durch die Erhöhung der Informations-, Koordinations- und Zeitkosten (ebd.; 353 ff).
Aufgrund der gestiegenen Informationsmenge erhöhen sich die Informationskosten. Zu jedem Thema und zu jedem Wissensgebiet stehen eine Vielzahl von Informationen zur Verfügung. Ein Mehr an Information bedeutet jedoch keinesfalls eine umfassendere Informiertheit. Die Fülle an Informationen bedingt, daß man selektieren muß. Es kostet viel Zeit und Aufwand, sich über ein Thema umfassend und nach dem neuesten Stand zu informieren. Das Problem der Selektion von Information wird an einer späteren Stelle ausführlicher thematisiert werden. Das nächste Problem sieht Bell in dem zunehmenden fachlichen Charakter der Information. Viele Themen lassen sich nur noch dann verfolgen, wenn bestimmtes fachliches Vorwissen darüber vorhanden ist. Qualifizierte Urteile werden oft nur noch den Experten zugetraut. „Die Information wird mehr und mehr zu einer Art Geheimwissenschaft, die ein weitaus gründli- cheres Studium des jeweiligen Gegenstandes erfordert als früher (ebd.; 354). Eine weitere Knappheit ergibt sich für Bell durch die Grenzen der Aufnahme von Information. Eine Person kann nur eine beschränkte Zahl an Informationen gleichzeitig verarbeiten (vergl. Bell, D.; 1985; 354). Die Aufnahmefähigkeit von Ereignissen und die Zahl von Bereichen, über die man informiert sein kann, ist begrenzt. Der exponentielle Anstieg der verfügbaren Informati- onen führt somit paradoxerweise zu einem Gefühl des Nicht-Informiertseins. Für Florian Rötzer wird angesichts der Verdichtung der Angebote und Reize „Aufmerksamkeit“ zu einer knappen Ressource des Informationszeitalters (vergl. Rötzer, F.; 1996; 86 f.). „Wir können die Daten nicht so schnell aufnehmen, wie sie erzeugt werden. Das hat im digitalen Zeitalter zu einer Mangelökonomie besonderer Art geführt. Nicht an Waren oder Informationen, nicht an Ausdrucksmöglichkeiten oder an Einnahmequellen fehlt es uns, sondern an der Aufmerk- samkeit unserer Mitmenschen“ (Bollmann, S.; 1996; 88).
Ein wesentlicher Aspekt der Informationsgesellschaft sind die gewachsenen Möglichkeiten der Kommunikation und des Austausches untereinander. Bell nennt dies das „Spiel zwischen Personen“ (vergl. Kap. 2.3.2.). Mit der Verdichtung der sozialen Kontakte wird die Notwen- digkeit der Koordination untereinander immer größer. Durch den raschen sozialen Wandel muß man sich immer häufiger über politische Forderungen, soziale Rechte oder moralische Werte verständigen. Partizipation wird zu einem wichtigen Element des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Je mehr Personen oder politische Gruppen jedoch mit ihren unterschiedli- chen Interessen aufeinandertreffen und sich einigen müssen, um so größer werden die „Kosten“, die aufgewendet werden müssen, um Beschlüsse zu fassen und zu realisieren. Die Sorge, vom allgemeinen Diskurs ausgeschlossen zu werden, ist für Richard Münch der Grund für das Aufkommen von Kommunikationszwängen. „In einer Welt der totalen Kommunikati- on wird Kommunikation zum totalen Zwang. Wir können uns der Teilnahme an der Kommunikation nicht mehr entziehen, ohne fürchten zu müssen, bei der Konsensbildung zu kurz zu kommen, anderen das Feld zu überlassen und andere über uns bestimmen zu lassen.“ (Münch, R.; 1995; 83).
Durch den Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten ist die Zahl der Personen gestiegen, mit denen wir in Interaktion treten können. Man könnte meinen, daß damit auch die Zahl der sozialen Kontakte ansteigt. Jeder soziale Kontakt ist jedoch auch mit Kosten verbunden. Es existiert eine Grenze des zu bewältigenden Ausmaßes an Interaktionen. Deshalb ist es un- wahrscheinlich, daß durch die neuen Technologien die Anzahl an guten Bekannten ansteigt. Martin Shubik meint dazu, daß „[...] trotz aller Fortschritte der modernen Wissenschaft [...] ein Abend mit einem Freund auch im 21. Jahrhundert nicht weniger Zeit beansprucht als im 19. [...]“ (zit. nach: Bell, D.; 1985; 355). Man kann nur eine gewisse Zahl an engen Kontakten aufrecht erhalten. Ansonsten muß man sich damit begnügen, daß die Beziehungen oberfläch- lich bleiben. Auch die neuen IuK-Technologien werden daran nichts ändern. Andererseits steigt durch sie die Zahl der Personen, mit denen man in Kontakt treten kann. Man hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, mit wem man einen engeren Kontakt pflegen möchte.
4.2. Folgen der Informationsgesellschaft für die Arbeit
Neue Technologien im Informations- und Kommunikationsbereich haben erhebliche Auswir- kungen auf die Arbeitswelt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Auswirkungen, welche die Informationsgesellschaft auf die Beschäftigung haben wird. Ob sich die neuen Technologien positiv oder negativ auf die Beschäftigung auswirken, bleibt umstritten. Man sieht in ihnen sowohl „ Jobkn ü ller “ als auch „ Jobkiller “ (vergl. Dostal; W.; 1995; 531). Op- timisten erwarten, daß neue Technologien, wie z.B. im Multimediabereich, eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze schaffen werden. Die prognostizierten Zahlen variieren jedoch stark. Die Erwartungen des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Günter Rexrodt (FDP) lagen 1996 bei 1,5 Mio. neuen Arbeitsplätzen für die Bundesrepublik in den kommenden 15 Jahren. Der Unternehmensberater Roland Berger sprach 1994 von 5 Mio. neuen Arbeitsplätzen, die bis zum Jahr 2000 europaweit entstehen sollen. Der Managing Director Europe von Arthur D. Little International, Tom Sommerlatte, ging sogar von bis zu 10 Mio. neuer Arbeitsplätze bis zur Jahrtausendwende aus (siehe Hauf, O.; 1996; 42)23. Dieses hoffnungsvolle Bild läßt sich jedoch nicht aufrecht erhalten. Neuere Prognosen sind inzwischen vorsichtiger geworden. „Waren die ersten Voraussagen der [IuK-Technologien] noch von starkem Optimismus ge- prägt [...], so fallen entsprechende Analysen mittlerweile deutlich zurückhaltender und wohl auch realistischer aus“ (Enquete-Kommission; 1998; 51).
Unter dem Blickwinkel des anhaltenden Stellenabbaus und dem in den letzten Jahren gewach- senen Problem der Massenarbeitslosigkeit lassen sich solche positiven Zukunftsvisionen nur schwerlich aufrechterhalten. Diese Tendenz erstreckt sich auch (oder gerade) auf den „Zu- kunftsmarkt“ Telekommunikation. So gab die Deutsche Telekom 1996 an, daß sie bis zum Jahr 2000 eine Reduzierung um 60 000 Stellen plane (Hauf, O.; 1996; 42). Dies wird als not- wendige Maßnahme gesehen, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Die Frage nach dem Beschäftigungseffekts durch IuK-Technologie stellt sich sehr gegensätzlich dar. „Einer- seits sind innovative Techniken und Dienste wie Multimedia wichtig, um Beschäftigung halten oder ausbauen zu können, andererseits führen sie immer auch zur Gefährdung beste- hender Arbeitsplätze“ (Dostal, W.; 1995; 531). Es sind gerade auch die neuen Technologien, die neue Möglichkeiten der Rationalisierung und der Stelleneinsparung schaffen. Mikroelekt- ronik ersetzt immer mehr Bereiche der mechanischen Produktion, „maschinelle Intelligenz“ hilft Produktionsvorgänge zu steuern und zu überwachen (Stichwort Robotik), physische Transportwege werden durch energetische Übertragungsmöglichkeiten unnötig und Computer übernehmen geistige Routinearbeiten (vergl. Wersig, G.; 1985; 175 f.). Sie tragen somit zu einem Beschäftigungsabbau bei. Es zeigt sich, „daß die Potentiale der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien hier vor allem darin liegen, Tätigkeiten, die bisher als ge- sellschaftliche Arbeit organisiert und von Menschen verrichtet wurden, abzulösen durch maschinelle Systeme“ (ebd.; 175).
Daß menschliche Arbeit durch Maschinen abgelöst wird, ist keine neue Entwicklung. Für Jeremi Rifkin enthält jedoch diese Form von Rationalisierung eine neue Qualität. „Als erstes wurde die menschliche Muskelkraft durch Maschinen ersetzt, jetzt verdrängen Computerpro- gramme den menschlichen Verstand“ (Rifkin, J.; 1995; 19). Die Informationsgesellschaft ist für ihn der Höhepunkt einer „Dritten Industriellen Revolution“. Die Erste Industrielle Revolu- tion brachte die Nutzung der Dampfenergie zur Güterproduktion, die bisher durch Handarbeit geprägt war. Die zweite Stufe (Zweite Industrielle Revolution) wurde mit der Erfindung neuer Energiequellen (Öl statt Kohle, Elektrizität, Elektromotoren, energetische Kommunikations- formen) erreicht. Das führte dazu, daß die menschliche Arbeitskraft noch weiter zurückgedrängt wurde. Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahm nach Rifkin die „Dritte Industrielle Revolution“ ihren Anfang. Es wurden immer leistungsfähigere „Denkmaschinen“ entwickelt, die alle möglichen Planungs-,Steuerungs- und Verwaltungsaufgaben bewältigen können. Rifkin beschreibt diese Entwicklung so: „Rechnergesteuerte Roboter und hochentwi- ckelte Computer dringen in die letzte Domäne des Menschen ein - in das Reich des Verstandes“ (ebd.; 20). Was wir nun zu erwarten haben ist „[...] die ‘Automatisierung und Informatisierung‘ der Sektoren und Berufe [...], die bislang weitgehend ‘verschont‘ geblieben waren, nämlich der Dienstleistungsbereiche“ (Hauf, O.; 1996; 43). Für Rifkin haben wir mit dieser Entwicklungsstufe das „Ende der Arbeit“ erreicht. Seine Negativutopie beschreibt er folgendermaßen: „Die Dritte Industrielle Revolution wird zu einer weltweiten Wirtschaftskri- se gigantischen Ausmaßes führen, wenn Millionen Menschen ihren Job verlieren und die Kaufkraft weltweit einbricht. Wie in den 20er Jahren stehen wir kurz vor einer Katastrophe, aber kein Politiker scheint wahrhaben zu wollen, daß die Weltwirtschaft unausweichlich auf ein Zeitalter ohne Arbeit zusteuert und daß das weitreichende Konsequenzen für unsere Zivi- lisation haben wird“ (Rifkin, J.; 1995; 63).
Ob wirklich von einem „Ende der Arbeit“ auszugehen ist, wird sich noch zeigen müssen. Es entsteht hier dennoch ein neues Konfliktpotential, dem wir uns wohl in Zukunft stellen müs- sen. Der „[...] klassische gesellschaftliche Widerspruch zwischen ‘Kapital‘ und ‘Arbeit‘ [...] [wird] durch den neuen Widerspruch ergänzt, wenn nicht sogar ersetzt [...], den zwischen Be- sitzern gesellschaftlicher Arbeit und den Nicht-Besitzern“ (Wersig G.; 1985; 177). Beschwerliche und eintönige Arbeit wird durch den Einsatz neuer Techniken verschwinden. Dafür werden andere Aufgaben mit anderen Anforderungen aufkommen. Wersig sieht die neuen Aufgaben vor allem in der kognitiven Beherrschung dieser neuen Techniken und ihrer Auswahl entsprechend der gegebenen Problemlage (Wersig, G.;1993; 27 f.). Peter Drucker spricht von sogenannten „Wissensarbeitern“24, die benötigt werden und deren Hauptaufgabe es ist, Ideen produktiv ein- und umzusetzen. Einen solchen Wandel der Arbeitsstruktur hat bereits Daniel Bell hervorgehoben, indem er auf die wachsende Bedeutung von wissenschaft- lichen und technisch qualifizierten Berufen hinwies. Viele derjenigen, die heute aufgrund des Einsatzes neuer Technologien ihren Arbeitsplatz verlieren, besitzen die Qualifikationen, wel- che die neuen „Wissens-Jobs“ erfordern, nicht und können diese nur schwer erwerben. Die Aufgaben erfordern ein gewisses Maß an formaler Bildung und auch analytische Fähigkeiten. Der „Wissensarbeiter“ muß sich ständig neues theoretisches Wissen aneignen und dieses Wissen umsetzen können (vergl. Heuser, U. J.; 1996; 20 f.). Peter Drucker befürchtet das Aufkeimen eines neuen Klassenkonflikts. Nämlich zwischen den traditionellen Industriearbei- tern und der sich neu formierenden Elite der Wissensarbeiter (vergl. Rifkin, J.; 1995; 24). Uwe Jean Heuser hält dem entgegen, daß dieses Szenario nicht zwingend eintreten muß. Zu- nächst einmal würde ein Klassenkonflikt nicht ohne weiteres durch einen neuen ersetzt. Weiterhin lasse sich das traditionelle Konzept von gesellschaftlichen Klassen auf die Informationsgesellschaft nicht mehr anwenden (vergl. Heuser, U. J.; 1996; 23).
Die Informationsgesellschaft bringt einen Wandel der Arbeit und der Arbeitsverhältnisse mit sich. Handwerksarbeit tritt in den Hintergrund und macht „geschicktem Informationshandeln“ Platz. An die Stelle des Handwerkers tritt „[...] der mit dem Handy und vernetzten Notebook ausgestattete ‘Informationsbroker‘“ (Bühl, A.; 1996; 30). Immer wieder wird betont, daß heutzutage zum Erhalt der beruflichen Qualifikation „lebenslanges Lernen“ unerläßlich ge- worden ist. Es bleibt zu hoffen, daß Angesichts der veränderten Anforderungen diejenigen, welche diese nicht erfüllen können, nicht auf der Strecke bleiben. Aber gerade hier bieten sich mit den IuK-Technologien, etwa mittels Telelearning, neue Möglichkeiten, um die nötigen Qualifikationen zu erlangen. Um jedoch diese Chancen auch nutzen zu können, muß der Zugang zu ihnen gewährleistet sein. Hier können sich unterschiedliche Barrieren auftun, die deren Nutzung für einige zumindest erschwert.
4.3. Freier Informationszugang ?
4.3.1. Schwellen und Barrieren des Informationszugangs
Die Möglichkeiten, Wissen und Informationen kostengünstig und schnell zu erhalten, sind durch die neuen Medien, voran das Internet, erheblich gestiegen. Internet und Online- Datenbanken eröffnen ihren Nutzern Zugang zu einer fast unbegrenzten Menge von Informa- tionen. Gleichzeitig erhebt sich jedoch die Frage, ob alle an diesem neuen Vorrat an Informationsressourcen teilhaben können. Eine mögliche Gefahr, besteht darin, daß es zu ei- ner Spaltung der Gesellschaft kommt, nämlich zwischen denen, „[...] die den Umstieg auf die neuen Technologien schaffen, und denjenigen, die ihn nicht schaffen. Heute sagt man [zu letzteren] ‘Computer-Analphabeten‘ [...]“ (Wersig, G.; 1993; 31). Ähnliche Befürchtungen sind auch den Empfehlungen für die Europäische Union zu entnehmen: „Die Hauptgefahr liegt in einer Zweiteilung der Gesellschaft in ‘Wissende‘, die den Zugang zu den neuen Tech- nologien haben, sie problemlos nutzen und von ihnen profitieren können, und ‘Nichtwissende‘, denen dies nicht möglich ist“ („Bangemann-Report“; 1994; 6). Die Vermu- tung liegt nahe, daß gewisse Schwellen existieren, die es verhindern, daß das Internet von einer breiten Masse genutzt wird. Um neue Dienstleistungen wie z.B. Angebote des Internets privat nutzen zu können, bedarf es mehrerer Voraussetzungen. Für Herbert Kubicek sind sechs Grundvoraussetzungen bzw. Dimensionen entscheidend (siehe Abbildung 9). Anhand dieser Dimensionen versucht er bestimmte technische, ökonomische und sozio-kulturelle Bar- rieren aufzuzeigen, welche die Nutzung von Online-Diensten beeinflussen können. Kubicek bezieht sich dabei teilweise beispielhaft auf die Stadt Bremen.
Abbildung 9: Barrieren der Internetnutzung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Enquete-Kommission; 1998; 143.
1) Zunächst muß ein Zugang zu einem Kommunikationsnetz gegeben sein. Für das Internet findet dies in der Regel über das Telefonnetz statt. Die Verbindung zum Computer wird entweder über ein Modem oder eine ISDN-Karte hergestellt. Größere Bilder (bzw. Bilder mit einer hohen Auflösung), Audio- und Videosequenzen bereiten durch begrenzte Über- mittlungsraten noch Probleme und benötigen viel Zeit für die Übertragung.
2) Neben dem Zugang zum Telekommunikationsnetz muß weiterhin ein Zugang zu einem Internet Service Provider (z.B. AOL, CompuServe, T-Online, ...) vorhanden sein. Die Kosten für den Zugang belaufen sich meist auf eine monatliche Grundgebühr und ein nutzungsabhängiges Entgelt. Im Vorteil sind diejenigen, die über ihre Firma oder über die Universität Zugang zum Internet haben und diesen auch privat nutzen können.
3) Nachdem der Zugang zum Internet gegeben ist, stellt sich das Problem, die Informationen oder Dienstleistungen zu finden, die man benötigt. Bei der Fülle von Informationsangebo- ten, die zur Verfügung stehen, ist diese Voraussetzung nicht selbstverständlich. Im Netz finden sich zahlreiche Suchhilfen, die in den meisten Fällen leicht zu bedienen sind. Suchmaschinen liefern jedoch bei der Eingabe eines Begriffes oft gleich hunderte von Fundstellen, die nicht unbedingt den tatsächlich gesuchten entsprechen. Im alltäglichen Umgang mit Printmedien fällt es uns nicht schwer, zwischen Zeitung, Flugblatt oder Sachbuch zu unterscheiden. Informationsangebote im Internet lassen sich hingegen schwerer auf ihre Qualität hin überprüfen. Herbert Kubicek stellt fest, daß Orientierungs- informationen eine wachsende Bedeutung zukommt, um die Qualität der Informationsangebote zu bewerten. Für ihn könnten thematisch oder regional strukturierte Leit- und Verweissysteme eine solche Orientierungshilfe schaffen. Einige Städte bieten solche Orientierungssysteme bereits an (z.B. bremen-online).
4) Auf der Seite der Anbieter von Online-Angeboten bedarf es auch bestimmter Vorausset- zungen. Auch für sie muß die Erstellung und Veröffentlichung von Informationen und Angeboten bequem und erschwinglich sein. Unternehmen, die sich durch die Bereitstel- lung solcher Angebote einen Nutzen versprechen, werden gern geneigt sein, im Rahmen von Marketingaktivitäten entsprechend zu investieren. Oft werden dafür externe Firmen beauftragt, die Präsentation der Unternehmen im Internet zu gestalten. Etwas schwieriger stellt sich die Situation für Vereine, Initiativen und gemeinnützige Einrichtungen dar. Obwohl in diesem Bereich das Interesse, das Internet zu nutzen, sehr groß ist, sind teil- weise die Mittel und das Wissen dafür nicht vorhanden. Trotzdem sind viele Vereine und gemeinnützige Organisationen im Netz vertreten. Dies ist oftmals auf die Initiative Ein- zelner zurückzuführen, die z.B. im Rahmen ihres ehrenamtlichen Engagements ihr berufliches Wissen dazu einsetzen, auf ihrer privaten Homepage auch Informationen über diese Organisationen anbieten.
5) Die nächste Voraussetzung ist, daß der Zugang zu interessanten und relevanten Informati- onen bezahlbar ist. Bisher sind die meisten Informationen im Internet noch kostenlos zugänglich. Kubicek befürchtet, daß sich dies in absehbarer Zeit ändern könnte. Es ist vorstellbar, daß zukünftig bestimmte Informationen nur noch gegen Bezahlung zugänglich sind. Die Voraussetzung dafür ist, daß Möglichkeiten der elektronischen Bezahlung ge- schaffen werden. Wie im Kapitel 3.2.1.2. gezeigt, existieren dafür bereits verschiedene technische Lösungsansätze. Sollte das Internet auf solche Weise kommerzialisiert werden, stellt sich die Frage nach einer „Grundversorgung“ von Informationen. Kubicek sieht hier Anlaß „ [...] grundsätzlich über ein Recht der Bürgerinnen und Bürger auf den Zugang zu Verwaltungsinformationen zu diskutieren und dies ggf. gesetzlich zu verankern“ (Enque- te-Kommission; 1998; 143).
6) Im Umgang mit den Online-Diensten bedarf es schließlich auf Seiten des Anwenders ei- ner Befähigung, die neuen Möglichkeiten adäquat zu nutzen. Er muß über “ Medienkompetenz “ verfügen. Er muß wissen, welche Angebote zur Verfügung stehen, wo man sie finden kann und wie man seriöse und weniger seriöse Angebote unterscheiden kann. Medienkompetenz kann auf unterschiedliche Weise erworben werden. Sie kann als Teil der Aus- und Weiterbildung vermittelt werden, durch „routinierte Nutzer“ an Neuein- steiger weitergegeben werden oder aber durch die Nutzung selbst erworben werden. Kapitel 4.3.4. wird sich genauer mit der Medienkompetenz befassen.
4.3.2. Der Zugang zu Online-Diensten
Die Internetnutzer sind bisher immer noch eine Minderheit. Die meisten der deutschen Haus- halte sind weder mit einem PC, noch mit einem Modem oder einer ISDN-Karte ausgestattet. Eine Befragung von 1995 ergab darüber hinaus, daß damals ca. 95% der Haushalte auch nicht planten, sich innerhalb der folgenden zwei Jahre ein Modem oder eine ISDN-Karte anzu- schaffen (vergl. Zimmer, J.; 1996; 487). Es existieren jedoch auch Alternativen für diejenigen, die keinen Internetzugang von Zuhause aus haben. Zum Beispiel sind sogenannte „Internet-Cafés“ entstanden, in denen man für eine stündliche Gebühr im Internet „surfen“ kann. Teilweise findet man solche Internet-Terminals auch schon in großen Kaufhäusern. Vielleicht können durch den Ausbau solcher Angebote Zugangsschwellen überwunden wer- den. Es gibt bereits auch Überlegungen, öffentliche Internet-Terminals im Stil von Telefonzellen einzurichten. Viele derjenigen, die das Internet nutzen, haben ihren Zugang über den Arbeitsplatz oder im Fall der Studierenden über die Universität. In der IST-Online- Studie von 1996 lag der Anteil dieser beiden Gruppen bei 58% aller Online-Nutzer (IST- Online-Studie; 1996; 14). Ohne eine solche Zugangsmöglichkeit steigen die Nutzungskosten, da die Dienste eines privaten Providers in Anspruch genommen werden müssen.
Grundvoraussetzung für den Zugang zu Online-Diensten ist zunächst einmal das Vorhanden- sein eines Computers und eines Modems. Das IRIS Institut ermittelte für 1996, daß 27% der deutschen Haushalte mit einem PC ausgestattet waren, 6% verfügten zusätzlich über ein Mo- dem. Davon hatten 4% einen Internetzugang über ihren Arbeitsplatz (siehe: Batinic B. u.a.; 1997; 199 f.). Laut Umfrage besaßen zu Beginn des Jahres 1998 in Deutschland bereits 13% der Befragten eine Zugangsmöglichkeit und nutzten Online-Medien.25 Wenn man sich die Altersstruktur ansieht fällt auf, daß es nicht etwa die „Computer-Kids“ sind, die das Bild der Onlinenutzer bestimmen. Im Gegenteil bilden die unter 20-jährigen eine eher kleine Gruppe unter ihnen (je nach Studie zwischen 2 und 6,9%). Das Durchschnittsalter des Onlinenutzers liegt zwischen 28 und 30 Jahren (vergl. Batinic, B. u.a.; 1997; 203 und Zimmer; J.; 1996; 488). Frauen sind unter den Online-Nutzern unterrepräsentiert. Ergebnisse verschiedener Stu- dien sprechen von 80 bis 90% Anteil an männlichen Online-Nutzern.
Bei den Indikatoren Bildungsniveau und Einkommen zeigte sich, daß Personen mit höheren Bildungsabschlüssen und höheren Einkommen dominieren. MC Online-Monitor I/96 ermittel- te, daß 57% der Onlinenutzer mindestens Abitur, davon 26% sogar einen Universitätsabschluß hatten. Mit mittlerer Reife nutzten lediglich 28% und mit einem Haupt- oder Volksschulabschluß nur 13% das Internet (siehe Zimmer J.; 1997; 489). Dies identifi- ziert eine vorwiegend gebildete, akademische Nutzergruppe (siehe Abbildung 10). In der IST- Online-Studie von 1996 lag der Prozentsatz der Studierenden bei 45%. Bei den Einkommens- verhältnissen zeigte sich ein ähnliches Bild. 44,4% der Haushalte hatten ein monatliches Nettoeinkommen von über 5000 DM. In der Kategorie 4000-5000 DM fanden sich 19,9%, 3000-4000 DM gaben 18,9% an und 11,0% hatten bis zu 2000 DM netto monatlich zur Ver- fügung (siehe Abbildung 11).
Abbildung 10: Bildungsgrad der Online-Nutzer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Zimmer J.; 1997; 489.
Die meisten Untersuchungen zur soziodemographischen Zusammensetzung der Onlinenutzer basieren auf WWW-Fragebögen. Das bedeutet, daß die Fragebögen im Internet online ausge- füllt und zurückgesendet werden. Die Teilnehmer der Umfrage mußten diese Fragebögen aktiv aufsuchen. Durch diese Selektion sind diejenigen überrepräsentiert, welche sich für die Umfragen interessierten. Weiterhin ist die Hinweishäufigkeit entscheidend. „Vielsurfer“ ha- ben größere Chancen, auf eine Seite mit einem Hinweis auf den Fragebogen zu stoßen.26 Diese Tatsachen können zu Verzerrungen führen und müssen deshalb berücksichtigt werden (vergl. Batinic, B.; 1997; 199). Trotz der Einschränkungen, die man bei der Zuverlässigkeit der Erhebungen machen muß, läßt sich zusammenfassend ein Bild des durchschnittlichen Onlinenutzers zeichnen. Der „typische“ Onlinenutzer ist demnach männlich und um die 30. Er hat Abitur oder sogar einen Hochschulabschluß und bezieht ein überdurchschnittliches Einkommen. Die Überrepräsentation dieser Gruppe von Nutzern läßt die anfängliche These der Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer der neuen Technologien glaubhaft erscheinen. Es war jedoch schon immer so, daß bei der Diffusion von neuen innovativen Technologien bestimmte Gruppen, die sogenannten „early adopters“, das Bild der Benutzer anfangs bestimmten. Man kann annehmen, daß diejenigen, die derzeit vor allem das Internet nutzen, neuen Medien grundsätzlich aufgeschlossener gegenüberstehen und Freude daran haben, damit zu „experimentieren“. Es ist also durchaus denkbar, daß sich mit der weiteren Verbreitung von Onlineangeboten die Zusammensetzung der Nutzer weiter an den Bevölke- rungsdurchschnitt annähert. Dazu muß sich jedoch zunächst ein allgemeines Interesse für die Online-Dienste entwickeln, welches über die alleinige Faszination der Nutzung neuer techni- scher Möglichkeiten hinausgeht. „Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben letztlich ein Interesse an bestimmten Dienstleistungen. Technik ist im Gegensatz zu den early adopters für sie nicht selbst Quelle der Befriedigung, sondern Mittel zum Zweck“ (Enquete-Kommission; 1998; 142).
4.3.3. Orientierungsinformationen
Wissen und Informationen besitzen eine grundlegende Bedeutung für das alltägliche Handeln. Um in einer bestimmten Situation rational zu Handeln, benötigt der Mensch Informationen, auf die er seine Handlung gründen kann. In der Regel steht jedem ein gewisser Wissensvorrat zur Verfügung, ein „Rezeptwissen“, welcher es ihm ermöglicht, alltägliche Situationen zu handhaben (vergl. Berger, P. u. Luckmann T.; 1980; 44 f.). Wenn dieses Alltagswissen in einer Situation nicht ausreicht, da sie zum Beispiel zu komplex ist, müssen zusätzliche Infor- mationen beschafft werden. Eine häufig genutzte Möglichkeit in einer solchen Situation ist, daß auf das Wissen anderer Menschen des persönlichen Netzwerks zurückgegriffen wird. Die Informationsgesellschaft besitzt darüber hinaus eine Fülle weiterer Kanäle, die Informationen zur Verfügung stellen. Online-Datenbanken oder auch das Internet mit all seinen Diensten machen viele Informationen zeit- und ortsunabhängig verfügbar. Es kommen immer mehr Quellen hinzu, so daß sich das Angebot an potentiell abrufbaren Informationen ständig ver- größert. Durch dieses riesige Informationsangebot wachsen die Anforderungen an den teter das Internet einsetzen, da für sie nicht das technische Medium, sondern der Nutzen, den sie davon haben, im Vordergrund steht. Dies könnte eine Erklärung für den äußerst geringen Frauenanteil bei der Umfrage sein.
„Informationssuchenden“. Er steht vor dem Problem der Beschaffung quantitativ und qualita- tiv ausreichender Informationen aus einer wahren „Informationsflut“.
4.3.3.1. Die These von der Informationsüberflutung
Viele befürchten, daß die aufkommende „Informationsflut“, die über uns hereinbricht, eine Überforderung der Menschen zur Folge hat. Orrin E. Klapp nimmt an, daß es zu einem „In- formation Overload“ kommt (siehe: Vester, H.-G.; 1987; 88). Seiner Ansicht nach hat die Zunahme des Angebots zur Folge, daß Informationen zu einem sogenannten Rauschen ver- kommen. Unter Rauschen versteht er alles, was in einem Kanal übertragen wird und die gesuchte Information störend überlagert. Dieses Verständnis von Information zeigt sich auch bei dem Informationsmodell von Claude Shannon und Warren Weaver, das sie 1949 in dem Buch „The Mathematical Theorie of Communication“ veröffentlicht haben. Ihr Modell orientiert sich vor allem an der technischen Effizienz der Übertragung von Informationen (vergl. Hauf, O.; 1996; 62 ff und Schmidli, P.; 1997; 20 f.). Für Shannon und Weaver ist da- bei entscheidend, daß eine zu übermittelnde Nachricht mit Hilfe eines Senders in ein elektrisches Signal umgeformt, also enkodiert wird. Auf der Rezipientenseite muß ein Emp- fangsgerät dieses Signal wieder dekodieren. Information ist für sie alles, was codiert über einen Kanal übertragen wird, unabhängig von seinem semantischen Gehalt. Es geht ihnen dabei hauptsächlich um eine leistungsfähige, schnelle und störungsfreie Übertragung. Diese Betrachtungsweise von Information führt zu der vermeintlichen Annahme, daß je mehr Daten und Signale störungsfrei übertragen werden automatisch die Menge der Informationen auf der Empfängerseite ansteigt. So gesehen ist dieses Modell ein Trichtermodell, bei dem Informati- onen lediglich umgefüllt werden. Zwischen Information und Wissen wird keine klare Unterscheidung getroffen, da der semantische und pragmatische Gehalt der übertragenen Sig- nale außer Acht gelassen wird. Übermittelte Signale und Daten sind jedoch zunächst nichts anderes als energetische Zustände. Sie erlangen erst durch das Interpretationsvolumen des Empfängers Bedeutung.27 „Information selbst entsteht [...] erst - und das ist der entscheiden- de Punkt - im Zusammenspiel mit menschlichen Wahrnehmungs- und Interpre- tationsleistungen. Erst diese garantieren, potentiell zumindest, daß in einer Art Veredelungsprozeß aus Daten und Signalen Bedeutung, Sinn und Kontext generiert werden und somit Informationen entstehen können“ (Hauf, O.; 1996; 65). Daraus ergibt sich eine neue Betrachtungsweise des Problems der „ Informations ü berflutung “. Nicht die Quantität der Informationen ist das Problem, sondern unter einem anhaltenden „Dauerbeschuß“ von Daten Informationen zu selektieren, zu interpretieren und in einen sinnhaften Kontext zu stellen. Auswahl und Aufbereitung von Daten sind jedoch sehr zeit- und kostenintensiv. Um diese Kosten möglichst gering zu halten, sind Orientierungshilfen von Nöten.
4.3.3.2. Die Bedeutung von Orientierungsinformationen
Unser Alltagswissen gliedert sich nach Relevanzstrukturen (Berger, P. u. Luckmann T.; 1980; 46 f.). Dem Einzelnen ist bewußt, welche Informationen für ihn wichtig sind und welche für ihn irrelevant sind. Je mehr handlungsrelevantes Wissen für eine bestimmte Situation vorhan- den ist, um so geringer ist die Notwendigkeit, nach neuen Informationen zu suchen (vergl. Wersig G.; 1996; 71). Informationssuche hat zum Ziel, bei Bedarf relevantes Handlungswis- sen zu generieren. „Nicht in der Information liegt das Problem, sondern in der Selektion. Die Frage nach ihrer Relevanz usw. wird erst interessant und wichtig, wenn das eigentliche Prob- lem gelöst ist: die Selektion“ (Schneider, I.; 1997; 51). Wie gelingt es nun, aus dem scheinbar endlosen Informationsangebot, wie es etwa im Internet besteht, relevante Informationen her- auszufiltern? Es existieren verschiedene technische Hilfsmittel im Softwarebereich, welche bei der Orientierung und Selektion helfen können und dabei bestimmte Suchfunktionen über- nehmen. Der Microsoft-Chef Bill Gates nennt fünf technische Selektionshilfen, denen er zukünftig eine wichtige Rolle bei der Informationssuche beimißt (Gates B.; 1995; 121 ff):
a) Abfragen (queries): Suchprogramme können das Meer von Daten nach einem bestimmten Suchkriterium durchforsten, um die gewünschte Information zu liefern. Nach Hartmut Winkler lassen sich drei Typen von Suchmaschinen (search engines) unterscheiden (Winkler H.; 1997; 188 ff). Der erste Typus arbeitet mit einem System vordefinierter und hierarchisch strukturierter Schemata. Menschliche Fachkräfte ordnen neue Internetdoku- mente vordefinierten Kategorien zu, über welche sie dann auffindbar sind. Ein Beispiel für eine solche Suchhilfe ist „Yahoo“, dessen Orientierungssystem 20.000 Schlagwörter umfaßt. Ein zweiter Typus sind Suchmaschinen, die nach dem Prinzip der „Volltextsu- che“ arbeiten(z.B. „Alta Vista“ oder „Lycos“). Jeder einzelne Begriff eines Textes ist im Index enthalten und ist somit abrufbar. Man spricht hier von einem „ inverted index “. Schließlich gibt es Suchmaschinen wie „Excite“, die versuchen, Begriffe eines Textes, welche häufig gemeinsam auftreten, semantisch zu verknüpfen. Dadurch werden bei der Suche nach Dokumenten z.B. zum Thema „Film“ auch die Dokumente mit dem Wort „movie“ angezeigt, weil diese Texte viele andere Wörter gemeinsam haben, die sich semantisch verknüpfen lassen (vergl. Winkler, H. 1997; 192 f.).
b) Filter: Im Unterschied zu den Suchmaschinen versteht Gates unter „Filter“ eine ständige Abfrage. Spezielle Filterprogramme durchsuchen rund um die Uhr neue Informationsan- gebote. Dabei können die Filter so programmiert werden, daß speziell nach den Informationen gesucht wird, die für den Nutzer interessant sind.
c) R ä umliche Navigation: Mit Hilfe eines visuellen Modells, in dem man sich interaktiv be- wegen kann, kann man sich an den Ort begeben, an dem sich die gewünschte Information befindet. Die räumliche Darstellung kann dabei zur Orientierung beitragen.
d) Hyperlinks: Hyperlinks bieten die Möglichkeit, von einem Informationsplatz augenblick- lich zu einem anderen Informationsplatz zu springen. Es wird möglich, zusätzliche Informationen (z.B. auch Video- oder Audiosequenzen) aufzurufen oder auch von Thema zu Thema zu springen. Wenn diese Verweise sinnvoll strukturiert sind, können auch sie dabei helfen, für den Einzelnen relevante Informationen schnell auffindbar zu machen.
e) Berater (agents): Bill Gates geht davon aus, daß der Computernutzer zukünftig durch eine lernfähige Software unterstützt wird. Ein programmierter „Berater“ hilft ihm dann dabei, mühelos mit dem Computer umzugehen. Er gibt Hinweise und kann bei Problemen wei- terhelfen. Frühere Aktivitäten des Nutzers könnten gespeichert werden, und aufgrund dieser Informationen ist der „Berater“ in der Lage, Vorschläge zu unterbreiten.
Die hier angesprochenen Hilfsmittel können zwar der Selektion dienen, sie sind jedoch in gewisser Hinsicht problematisch. Dies zeigt sich für Harmut Winkler zum Beispiel im Um- gang mit den Suchmaschinen im Internet. „Wir benutzen sie täglich, und wir wissen nicht, wer sie betreibt und warum, nicht wie sie aufgebaut sind und wenig darüber, wie sie funktio- nieren; der klassische Fall einer black box [...]“ (Winkler H. 1997; 185). Nichtsdestotrotz verzeichnen die verschiedenen Suchmaschinen täglich Millionen Zugriffe. Die Suchmaschi- nen sind ohne Zweifel die wichtigsten Selektionshilfen im Internet. Diese zentrale Rolle können sie nach Winklers Ansicht nur dadurch einnehmen, daß man ihnen eine rein dienende Funktion zuschreibt; man unterstellt ihnen in gewisser Weise „Neutralität“ (vergl. ebd.;.188). Suchmaschinen sind jedoch keineswegs vollkommen neutral. Ordnungssysteme, wie sie z.B. bei Yahoo Verwendung finden, arbeiten mit vordefinierten Hierarchiesystemen, mit denen die Dokumente vercodet werden. Bei der großen Anzahl der Webdokumente ist die Umsetzung eines einheitlichen und in sich stimmigen Ordnungssystems fast unmöglich. Selbst die 20.000 Schlagworte, welche Yohoo verwendet, stoßen dabei an ihre Grenzen. Aber auch die Ver- wendung von Konzepten einer Volltextsuche ist problembehaftet. Bereits kleinste Veränderungen des Suchbegriffes kann zur Folge haben, daß ein und dasselbe Dokument mit höherer oder niedrigerer Priorität oder aber auch überhaupt nicht angezeigt wird. Die Ver- wendung der „richtigen“ Suchbegriffe ist ein entscheidender Faktor für das Auffinden relevanter Informationsquellen. Besonders schwierig erweist sich dieses Problem, wenn unzu- reichende oder lediglich diffuse Vorstellungen über ein Thema vorliegen, zu dem man Informationen sucht. Hier spielt das bereits vorhandene Wissen eine große Rolle. Wer zusätz- liche Information über einen Themenkreis sucht, in dem er sich auskennt, wird es leichter haben, seine Suche zu präzisieren. Schließlich erfordert es auch bestimmte Vorkenntnisse, die Ergebnisliste von Abfragen in Bezug auf ihre Qualität hin zu beurteilen. Man kann erkennen, daß die Annahme der Neutralität von Suchmaschinen nicht aufrecht erhalten werden kann. Es sind mehr als nur zwei Instanzen, welche die Internetkommunikation bestimmen. Nämlich nicht nur die schriftlichen Dokumente im Netz und der recherchierende Nutzer, „[...] sondern zusätzlich eine dritte Instanz, ein [...] Erschließungssystem, das als ein Gitter oder Raster zwi- schen beide getreten ist“ (ebd.; 200). Um trotzdem gewünschte Suchergebnissen zu bekommen, ist ein gewisses Vorwissen erforderlich. Dieses beinhaltet beispielsweise, in wel- cher Weise Suchbegriffe zu formulieren sind oder auch, wie die Ergebnislisten zu bewerten sind.
Orientierungswissen spielt nicht nur beim Gebrauch von Suchmaschinen eine Rolle. Die mei- sten Texte, mit denen wir bisher im Alltag zu tun haben, folgen einer gewissen Linearität. Dies wird zumindest zum Teil durch Hypertext aufgelöst. Die Verknüpfungen fordern gera- dezu dazu auf, von Seite zu Seite zu springen und sich zwischen verschiedenen Themen im Netz hin und her zu bewegen. Das hat zur Folge, daß zusammengehörige Informationen teil- weise in viele kleine Portionen aufgesplittert werden können. Sie sind dann auf unterschiedlichen Internetseiten abgelegt, welche durch Hyperlinks verknüpft sind. Diese „In- formationsfragmente“ können sich bei dem Gewirr von verweisenden Links in ganz unterschiedlichen Kontexten wiederfinden. Die Hyperlinks setzen der Linearität der Schrift das Prinzip der freien Assoziation entgegen (Wersig, G.; 1996; 75). Patrick Schmidli ver- gleicht das Internet mit einem orientalischen Basar. Alles ist bunt zusammengewürfelt, überraschend und verwirrend und lädt zu einem eher planlosen Herumstöbern ein (vergl. Schmidli, P.; 1997; 322). Gerade hier sind Orientierungsinformationen notwendig, um sich innerhalb dieses „Hyperraums“ planmäßig bewegen zu können. Genot Wersig schreibt dazu: „Die Navigation in diesen Räumen ist ein besonderes Problem in mehrfacher Hinsicht - wir sind an dieses Navigieren nicht gewöhnt, wir haben keine Navigationsinstrumente [...]“ (Wer- sig, G; 1996; 75).
Ein weiteres Problem der Bewertung abrufbarer Information aus dem Netz ist die Bewertung der Glaubwürdigkeit der Informationen. Bevor Informationen in die eigenen Wissensstruktu- ren Eingang finden, muß man sich ein Bild über ihre Richtigkeit machen. Wissen ist dabei immer überprüfbares Wissen (vergl. Wersig, G.; 1996; 99). Der Gehalt von Information wird stets aufgrund ihrer Quelle beurteilt. „Da Online-Quellen in der Regel nicht in ‘trivial‘ und ‘wissenschaftlich‘ getrennt werden (können), stehen sie meist harmonisch in ein und dersel- ben Datenbank. Es bleibt auch in Zukunft dem Anwender selber überlassen, sich die für ihn passenden Quellen auszuwählen“ (Boehringer, P.; 1995; 44). Bin ich auf der Suche nach be- stimmten Informationen und greife dabei auf mein persönliches Netzwerk zurück, werde ich versuchen, die gewünschten Informationen von der Person zu erhalten, welche ich in dieser Frage als kompetent einstufe bzw. für glaubwürdig halte. Diese Grundregel, die für persönli- che Netzwerke gilt, erweist sich bei der Informationsbeschaffung online oft als problematisch. Bei den vielen Informationen, die im Internet zu finden sind, bleibt die Quelle der Informatio- nen oftmals schemenhaft oder gänzlich unbekannt. Wersig spricht hier von einer „De- Personalisierung“ von Wissen, durch welche eine handlungsrelevante Qualitätseinschätzung der Informationen erheblich erschwert wird (Wersig, G.; 1996; 99). Vertrauen und Glaubwür- digkeit wird nicht im Internet, sondern außerhalb des Netzes geschaffen. Wer zum Beispiel die neuesten Nachrichten im Internet sucht, wird dies auf den Seiten der etablierten Printme- dien tun. Diese Unsicherheit den neuen Informationskanälen gegenüber kann nur überwunden werden, wenn man ihnen einen Vertrauensvorsprung einräumt.
Selektionshilfen wie Suchmaschinen können zwar einen Beitrag dazu leisten, sich in dieser Unübersichtlichkeit des Internets besser zurechtzufinden, sie können dem Anwender jedoch nicht die Evaluierung der Informationen in Bezug auf ihre Relevanz und Qualität abnehmen (vergl. Boehringer, P.; 1995; 44). Das gestiegene Informationsangebot erweist sich für viele Bereiche als eine Erleichterung, da bestimmte Informationen schnell und kostengünstig zu- gänglich werden, wobei gleichzeitig dadurch neue Anforderungen entstehen. Dabei besteht das Problem nicht darin, daß wir von einer „Informationsflut“ überrollt werden, sondern die Herausforderung liegt darin, aus dem riesigen „Datenmeer“ die Informationen herauszufi- schen, die für den Nutzer Relevanz besitzen. Menschen, die über ein höheres Bildungsniveau und damit verbunden einem höheren Maß an Vorwissen verfügen, wird es voraussichtlich leichter fallen, diese Aufgabe zu bewältigen. Die Entstehung einer neuen Wissenskluft ist somit zumindest annehmbar. Sie entsteht zwischen denen, welche über einen Vorsprung an Orientierungsinformationen für eine effektive Filterung, Evaluation, Selektion und Struktu- rieung von Informationen verfügen und denen, die diese nicht besitzen. Zur Bestätigung dieser These bedarf es jedoch weiterer Untersuchungen, welche vor allem auch die Hand- lungsrelevanz der Online-Informationssuche mit berücksichtigen.
4.3.4. Medienkompetenz
Neben dem Vorhandensein von Orientierungsinformationen ist der erfolgreiche Umgang mit den neuen Medien von weiteren Fähigkeiten abhängig. Sind bestimmte Vorkenntnisse und Erfahrungen nicht vorhanden, können sich etwa schon bei der Installation der nötigen Soft- ware unüberwindbare Hindernisse auftun. Verglichen mit den „traditionellen“ Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen, erfordert das interaktive Medium Internet eine erhöhte Aktivität auf Seiten des Nutzers. Er muß beispielsweise zwischen den verschiedenen Angeboten und Diensten im Netz auswählen oder sich aktiv auf die Suche nach einem (Informations-) Ange- bot begeben. Entscheidend für den Gebrauch der neuen IuK-Technologien ist eine sogenannte „Medienkompetenz“ auf Seiten des Nutzers. Dieser Begriff umfaßt nicht nur das Wissen über die technische Handhabbarkeit, sondern grundsätzlich die Fähigkeit, mit den neuen Medien wie z.B. dem Internet aktiv, verantwortungsbewußt, kritisch und in adäquater Form umzuge- hen. Der Begriff der Medienkompetenz kann dabei unter vier Aspekten betrachtet werden (vergl. Enquete-Kommission; 1998; 67):
- Technische Kompetenz
- Kompetenz zum Wissensmanagement
- Soziale Kompetenz
- Kompetenz zur persönlichen Entscheidungsfindung
Die technische Kompetenz stellt die grundlegende Qualifikation im Umgang mit den neuen Technologien dar. Darunter fallen technische Routinefertigkeiten und technisches Basiswis- sen für den alltäglichen Umgang mit ihnen. Es hat sich bereits bei anderen technischen Neuerungen gezeigt, daß für ihre erfolgreiche Einführung und Verbreitung die benutzer- freundliche Bedienbarkeit eine entscheidende Rolle spielt. Damit sich neue Medienangebote durchsetzen können, ist es von entscheidender Bedeutung, daß sie vom Anwender einfach zu handhaben sind. Andernfalls besteht die Gefahr, daß diejenigen, die ohnehin gegenüber den neuen IuK-Technologien eine ablehnende Haltung einnehmen, in ihrem Verhalten bestärkt werden. Unter dem Aspekt der technischen Kompetenz sind auch persönliche Netzwerke von Bedeutung. Wie Michael Schenk u.a. festgestellt haben, spielen interpersonale Netzwerke bei der Diffusion von Kommunikationstechnologien eine entscheidende Rolle (Schenk, M. u.a.; 1997; 35). „Early adoptors“ besitzen dabei in der Regel überdurchschnittlich große persönli- che Netzwerke, auf die sie zurückgreifen können. Darüber hinaus verfügen sie über „Innovatorennetzwerke“ in denen ein Austausch über neue Technologien stattfindet. Auf die- se wird aufgrund von Anwendungserfahrungen und technischer Kompetenz oftmals als Ratgeber zurückgegriffen. Die Kompetenz zum Wissensmanagement umfaßt den Bereich, der im vorangegangenen Kapitel unter dem Begriff der Orientierungsinformationen behandelt wurde. Aus diesem Grund wird hier nicht weiter darauf eingehen.
Wie bereits erwähnt, ist die Informationsgesellschaft durch ein hohes Maß an Koordination geprägt. Dies erfordert Fähigkeiten zu Teamarbeit und zur Kooperation, um an dem „Spiel zwischen den Personen“ erfolgreich teilzunehmen. „Gefordert ist soziale Kompetenz, die sich zum einen auf die direkte Kommunikation und Kooperation bezieht, zum anderen aber auch den Bereich der Telekommunikation und Telekooperation umfaßt“ (Enquete-Kommission; 1998; 68). Mit der zunehmenden Bedeutung neuer Medien für das private Leben ist anzu- nehmen, daß sie sowohl die kommunikativen Gewohnheiten, als auch den sozialen Alltag beeinflussen. „Mit den neuen Technologien wird auch Handeln insgesamt mit mehr Options- räumen ausgestattet, die zumindest prinzipiell mehr Freiräume schaffen“ (Wersig, G. 1985; 195). Der Einzelne steht vor der Aufgabe, diese Veränderungen in seinem Handeln zu integ- rieren. Die gestiegenen Handlungsoptionen erzwingen eine Wahl. Er muß in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen, welche sich an seinen persönlichen Wertvorstellungen orientiert und welche er gegenüber seiner Umwelt vertreten kann. Genot Wersig ist der Ansicht, „Leben würde [...] durch die Vervielfältigung von Alternativen, die technologisch realisierbar wären, nicht einfacher werden, aber bewußter [...]“ (ebd.; 197).
Je weiter die neuen Technologien in alle möglichen lebensweltlichen Bereiche hineindringen, desto größer wird die Bedeutung von Medienkompetenz, um adäquat mit ihnen umzugehen. Medienkompetenz wird damit zu einer Art „Grundlagenwissen der Informationsgesellschaft“. Wenn man von dieser Annahme ausgeht, stellt sich die Frage, was mit denjenigen passiert, die diese Fertigkeiten nicht erworben haben. Gerade älteren Menschen wird es nicht leicht fallen, sich den schnell voranschreitenden Neuerungen anzupassen. Die Hoffnungen bestehen darin, daß die jüngere Generation mit den neuen Technologien aufwächst und somit den Um- gang mit ihnen als alltäglich empfinden wird. „Denn auch in der Alltagswelt ist Technik immer schon eingebaut, nur mit dem Unterschied, daß wir uns an die alte Technik gewöhnt haben. Sie ist veralltäglicht“ (Rammert, W. ; 1990; 17). Diejenigen, welche die Fertigkeiten für den Umgang mit den neuen Technologien bisher noch nicht erworben haben, werden diese in Zukunft nicht leichter erlernen.
Mit der Initiative „Schulen ans Netz“ wird versucht, die Ausbildung von Medienkompetenz zu unterstützen. Die Deutsche Telekom AG und das Bundesministerium für Bildung, Wissen- schaft und Forschung riefen 1996 diese Initiative mit dem Ziel ins Leben, bis zum Jahr 2000 etwa 10.000 Schulen den Zugang zum Internet zu eröffnen. Es sind jedoch bisher vor allem die Gymnasien, die dadurch Zugriff auf das Internet erhielten. Haupt- und Realschulen sind hierbei eine Minderheit. Der Leiter des BAT-Freitzeit-Forschungsinstitutes Horst Opa- schowski sieht Grund zur Besorgnis. Eine repräsentative Befragung des Instituts ergab, daß lediglich 6% aller Hauptschüler regelmäßig zu Hause einen PC nutzen. Opaschowski befürch- tet, daß wenn es nicht gelingt, alle allgemeinbildenden Schulen ans Datennetz anzuschließen sich die Informationsgesellschaft in Deutschland in "User" (Anwender) und "Loser" (Verlie- rer) spalten wird. Derzeit hätten nur die höheren formalen Bildungsschichten die Möglichkeit sich den Anforderungen des Multimedia-Zeitalters anzupassen; die übrigen laufen seiner Meinung nach Gefahr, ihn in ihrer Medienkompetenz stehenzubleiben.28 Die meisten der er- forderlichen Fähigkeiten können durch die Erfahrungen im Umgang mit dem Internet selbst erworben werden. Diejenigen, die bereits jetzt verstärkt das Internet nutzen, sichern sich da- mit einen Vorsprung, der für die anderen nicht leicht aufzuholen sein wird. „Die soziale Verbreitung neuer Medien über die ursprünglichen Kontexte der ‚early adopters‘ hinaus erfordert deshalb, abgesehen von der Verfügbarkeit technischer Geräte und Infrastrukturen, das Vorhandensein von Akteursnetzen (Nutzergruppen), die über eine entsprechende Medienkompetenz verfügen“ (Schmid, U.; 1997; 90).
Die Vielzahl der Online-Angebote stellt den Nutzer immer wieder unter Entscheidungszwang. Durch Anklicken eines Hyperlinks im Internet gelangt man zu immer wieder neuen Doku- menten mit einer Schar von Verknüpfungen. Um sich in dieser Fülle zurechtzufinden, ist es wichtig, daß grundlegende Kenntnisse für einen kompetenten Umgang und ausreichend Ori- entierungshilfen zur Verfügung stehen. Dies trifft vor allem zu, wenn man berücksichtigt, daß die für die Nutzung von Online-Diensten benötigten Ressourcen Geld und Zeit nur in be- grenzter Menge zur Verfügung stehen. Wie Michael Schenk gezeigt hat, kommt der Kommunikation innerhalb der persönlichen Netzwerke eine entscheidende Bedeutung zu, um die Herausbildung von Medienkompetenz zu unterstützen. Hier zeigt sich, daß die Befürch- tungen einiger, daß mit der Verbreitung der IuK-Technologien die zwischenmenschliche Kommunikation zerstört wird, unbegründet sind.
5. Resümee
Der Prozeß, den Nona und Minc als „Informatisierung der Gesellschaft“ bezeichnen, bringt entscheidende Veränderungen mit sich. Obwohl es verschiedene Ansätze zur Beschreibung der Informationsgesellschaft gibt, fehlt bisher immer noch ein übergreifendes theoretisches Modell zur Erklärung der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse. Der Übergang zur Infor- mationsgesellschaft wird in seiner Bedeutung oft mit dem von der Argar- zur Industriegesellschaft verglichen. Dieser Wandlungsprozeß veranlaßte damals viele Vertreter der Soziologie, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Um so erstaunlicher ist es, daß sich die Soziologie bisher nur vereinzelt und eher zögerlich zum Phänomen der Informations- gesellschaft geäußert hat. Ob sich, wie einige annehmen, alles in der Informationsgesellschaft ändern wird bleibt abzuwarten. Zum Beispiel werden sich trotz moderner Kommunikations- technologien soziale Gemeinschaften und engen zwischenmenschliche Beziehungen auch weiterhin vorrangig auf persönlichen Kontakt gründen.
Auch wenn in der Informationsgesellschaft nicht alles anders wird, wird unser alltägliches Leben doch immer stärker durch das wachsende Angebot der Informations- und Kommunika- tionstechnologien tangiert werden. Diese neuen Technologien, die vor allem auf Computertechnologie basieren, finden in immer mehr Bereichen des alltäglichen Lebens An- wendung. Lernen, Beruf und Freizeit werden immer mehr durch sie geprägt. Mit ihren Charakteristiken Interaktivität, Multimedialität und Vernetzbarkeit erschließen sie dabei für den Einzelnen viele neue Handlungsoptionen und schaffen damit Raum für mehr Flexibilität und Autonomie. Mit den neuen Freiheiten steigen jedoch gleichzeitig auch die Anforderun- gen. Es müssen verstärkt Informations-, Koordinations- und Zeitkosten aufgewendet werden, um sich gegenüber dem gestiegenen Informationsangebot zu behaupten. Dadurch entsteht die Gefahr, das die neuen Chancen der Informationsgesellschaft nur von einigen wenigen effektiv genutzt werden können, und die anderen auf der Strecke bleiben. Es läßt sich vermuten, daß eine „Wissenselite“ entsteht, die im verstärkten Maße die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt für sich zu nutzen wissen. Klaus Lenk spricht in diesem Zusammenhang von einem „Matthäus-Effekt“: Wer hat, dem soll gegeben werden (vergl. Hauf, O.; 1996; 155). Damit es nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft in „User“ und „Loser“ kommt, ist es nötig, daß tech- nische, ökonomische und sozio-kulturelle Schwellen und Barrieren für den Zugang zu den IuK-Technologien abgebaut werden. Wenn eine Masse von Menschen vom Internet profitie- ren soll, muß die Voraussetzung geschaffen werden, daß möglichst viele zu allen seinen Diensten Zutritt erhalten. Es muß sichergestellt werden, daß der Zugang zum Netz bezahlbar ist und qualitativ hochwertige Informationen auch weiterhin kostenfrei im Netz verfügbar sind. Das bedeutet, daß eine Art Grundversorgung mit Information gewährleistet werden muß. Aber auch der Schutz persönlicher Daten im Netz muß gewährleistet werden, damit sich nicht die Vision vom „gläsernen Menschen“ verwirklicht. Weiterhin sind Medienkompetenz und Orientierungsinformationen von zentraler Bedeutung. Um Orientierungen im Netz zu schaf- fen, sind vor allem auch die Anbieter von Online-Diensten gefordert, um den „orientalische Basar“ des Internets für den Nutzer übersichtlich zu gestalten. Um die Chancen der neuen IuK-Technologien nutzen zu können, ist es erforderlich, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sich die nötigen Fähigkeiten für den Umgang mit ihnen anzueignen. Für die Nutzers von Online-Diensten ist das Vorhandensein von einer Medienkompetenz, die einen adäquaten und kritischen Umgang mit den neuen Medien ermöglicht, von entscheidender Bedeutung. Des weiteren benötigt man Orientierungsinformationen, die dabei helfen, sich angesichts des stän- dig wachsenden Angebots zurechtzufinden. Technische Selektionshilfen können zwar auch einen Beitrag dazu leisten, sich im Netz zurechtzufinden, sie stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen. Die Nutzung des Internet als riesige Quelle an Informationen erfordert die Fähig- keit, aus dem übergroßen Angebot zu selektieren, zu bewerten und in einen sinnhaften Kontext zu stellen. Nur so können die neuen Möglichkeiten technisch übermittelter Informa- tionen mithelfen, eine Hilfestellung gegenüber dem exponential angewachsenen Wissen zu geben bzw. Ungewißheit zu verringern. Andernfalls tragen sie zusätzlich zum Anstieg von Komplexität und Überforderung bei. Bei der Aneignung dieser Fähigkeiten und Kenntnisse spielen vor allem auch die persönlichen Netzwerke eine wichtige Rolle, über die man Erfah- rungen mit neuen den Medien austauschen kann.
Medienkompetenz ist auch ein entscheidender Faktor, wenn es um neue Lernkonzepte unter dem Stichwort „lebenslanges Lernen“ geht. Selbstorganisiertes und eigenverantwortliches Lernen ist ohne Medienkompetenz und ein gewisses Maß an Orientierungsinformationen nur schwer denkbar. Das Vorhandensein von Fähigkeiten für den Umgang mit den neuen Medien trägt darüber hinaus dazu bei, sich besser den ständig wachsenden Anforderungen der Be- rufswelt anzupassen. Wer zukünftig nicht über sie verfügt, wird es zumindest schwer haben, sich in vielen Bereichen der Arbeitswelt zu behaupten. Immer mehr berufliche Tätigkeiten sind heute ohne den Einsatz von Computern überhaupt nicht mehr vorstellbar. Auch die Vor- teile, welche neue Arbeitsformen, wie z.B. Telearbeit ermöglichen, stehen nur denen offen, die den Umgang mit den IuK-Technologien erlernt haben. Um ein genaueres Bild über die aktuelle Nutzung von Onlinemedien und die über Verteilung von Medienkompetenz zu erhal- ten, sind jedoch noch umfangreiche Untersuchungen nötig. Bisherige Untersuchung, wie die des BAT-Freitzeit-Forchungsinstituts, haben gezeigt, daß wohl noch ein großer Handlungsbedarf besteht, um dafür zu sorgen, daß der selbstverständliche und kompetente Umgang mit neuen Technologien nicht nur Personen aus höheren formalen Bildungsschichten vorbehalten bleibt. Deshalb ist es wichtig, daß Projekte zur Schaffung von Internetzugängen an Schulen und Universitäten auch weiterhin gefördert werden. Horst Opaschowski empfiehlt darüber hinaus die Förderung neuer leicht bedienbarer technischer Systeme und neuer Lernprogramme, die zum Ziel einen kompetenten Mediennutzer haben.
Gerade für die jüngere Generation wird zukünftig Medienkompetenz eine entscheidende Rol- le spielen. Der Umgang mit Informationen wird immer stärker dadurch geprägt sein, daß sie immer einfacher, schneller und preiswerter zugänglich werden. Die Aussage, daß in der In- formationsgesellschaft die Bedeutung von Information ansteigt, ist jedoch zu allgemein. Die Bedeutung einer Information ist abhängig von der subjektiven Relevanz, welche sie für die einzelne Person besitzt. Von entscheidender Bedeutung sind vielmehr die vermehrten Mög- lichkeiten des raschen Zugangs zu handlungsrelevanten bzw. zweckrationalen Informationen. Diese Art von Informationen gewinnen vor allem angesichts der Komplexität einer von Glo- balisierung und Individualisierung geprägten Welt einen immer stärkeren Stellenwert. Durch sie wird rationales Handeln ermöglicht, welches auf gesichertem Wissen und nicht auf intuiti- ven Urteilen beruht. Der Einsatz der neuen Informations- und Kommunikationsmedien muß deshalb unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, welchen individuellen Nutzen er für den Einzelnen hat.
Vor allem das Internet ist zu einem Symbol für die voranschreitende Informationsgesellschaft geworden. Mit der fortschreitenden Etablierung des Internets formiert sich zunehmenden sei- ne funktionale Struktur. Diese „Verfestigung“ spiegelt sich in der Metaphorik wieder, die auf das Internet angewendet wird. Das Internet wird von vielen mit einer Art „Datenmeer“ vergli- chen. Im Umfeld dieser „flüssigen“ Metapher finden sich viele Begriffe, die sich innerhalb diese Bildes bewegen. So wird z.B. die Nutzung des Internets mit dem Begriff „Surfen“ um- schrieben. Auch viele Softwarehersteller benutzen bei der Namengebung ähnliche Metaphern, wie „ Netscape Navigator “ oder „ Internet Explorer “. Diese „nautische Metaphorik“ ist nach Birkenbach und Maye fest im kulturellen Gedächtnis verankert (Odyssee, Argonauten, ...) und beschreibt eine Gleichzeitigkeit von Desorientierung und Innovationschancen (vergl. Birken- bach, M. u. Maye, H.; 1997; 88). Dem gegenüber ist in den letzten Jahren verstärkt die Meta- pher von der „Datenautobahn“ in den Vordergrund gerückt. Dieser Begriff entstand in Anlehnung an den Begriff „information highway“, den der amerikanische Vizepräsident AL Gore anläßlich einer Regierungserklärung 1993 prägte. Der „information highway“ ist zu ei- ner Vision für die Verwirklichung der Informationsgesellschaft geworden. Mit diesem Bild sind weitestgehend Vorstellungen über einen schnellen und zielgerichteten Verkehr in den Datennetzen verbunden. Die Metapher der Autobahn beinhaltet darüber hinaus einen durch Regelmentierungen und Beschränkung geordneten Verkehr. Das Bild der Datenautobahn be- schreibt eine Art Straßennetz, auf dem Datenreisen sicherer werden, die Routen klarer und die Ziele dadurch schneller erreichbar. Im Zusammenhang mit der Metapher der Datenautobahn wird auch von einem „Führerscheins für das Internet“ gesprochen, womit nichts anderes als Medienkompetenz gemeint ist. Gegenüber dem „Datenmeer“ hat das Bild der Datenautobahn den Vorteil, daß es deutlich macht, daß das Internet als Informationsmedium erst dann für den Alltag Sinn macht, wenn es die Möglichkeit bietet, an die Informationen zu gelangen, die für den Nutzer Relevanz besitzen. Um das zu erreichen, ist „Fahrkönnen“ erforderlich, aber auch „Wegweiser“ in Form von Orientierungsinformationen müssen vorhanden sein. Anderenfalls besteht die Gefahr, daß der neue Umgang mit Informationen mittels Internet und anderen IuK-Technologien für viele eine „Odyssee“ bleibt.
6. Literaturverzeichnis
- „Bangemann-Report“; Europa und die globale Informationsgesellschaft. Empfehlungen f ü r den Europ ä ischen Rat; Brüssel; 1994.
- Bagemann, Martin; Europas Weg in die Informationsgesellschaft. In: Informatik Spekt- rum 18 ; Spinger Verlag; 1995.
- Batinic, Bernad u.a. ; Der „ Internetler “ - Empirische Ergebnisse zum Nutzungsverhalten. In: Gräf, L. u.a.; 1997 .
- Beck, Ulrich; Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne; Surkamp; Frank- furt; 1986.
- Becker, Barbara u. Paetau, Michael (Hrsg.); Virtualisierung des Sozialen. Die Informati- onsgesellschaft zwischen Fragmentierung und Globalisierung; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1997.
- Bell, Daniel; Die nachindustrielle Gesellschaft; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1985.
- Belzer, Volker und Hilbert, Josef; Personenbezogene Dienste. Motor der Informationsge- sellschaft? In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis; Nr. 4, 19. Jg .; 1996 .
- Berger, Peter und Luckmann, Thomas; Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklich- keit; Fischer Taschenbuch Verlag; Frankfurt a. M.; 1980.
- Birkenbach, Matthias und Maye, Harun; Zwischen fest und fl ü ssig - Das Medium Internet und die Entdeckung seiner Metaphern. In: Gräf, L. u.a.; 1997.
- BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft); BMWi Report: Die Informationsgesellschaft. Fakten, Analysen, Trends; Bonn; 1995.
- BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft); Bericht der Bundesregierung: „ Info 2000 “ Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft; Bonn; 1996.
- BMWi (Bundesministerium für Wirtschaft); Fortschrittsbericht der Bundesregierung: „ Info 2000 “ Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft; Bonn; 1997.
- Boehringer, Peter; Gesellschaftliche Auswirkungen von Information-Highways; S. Ro- derer Verlag; Regensburg; 1995.
- Bollmann, Stefan (Hrsg.); Kursbuch Neue Medien; Bollmann Verlag; Mannheim; 1995.
- Bollmann, Stefan und Heibach, Christiane (Hrsg.); Kursbuch Internet; Bollmann Verlag; Mannheim; 1996.
- Brauner, Josef u. Bickmann, Roland; Cyber Society. Das Realszenario der Informations- gesellschaft: Die Kommunikationsgesellschaft; Metropolitan Verlag; München/ Düsseldorf; 1996.
- Brunner, Reinhard; Die Fragmentierung moderner Gesellschaften. In Becker, B. u.a.; 1997.
- Bühl, Achim; Cybersociety: Mythos und Realit ä t der Informationsgesellschaft; PapyRos- sa-Verlag; Köln; 1996.
- Bühl, Achim; Die virtuelle Gesellschaft - Ö konomie, Politik und Kultur im Zeichen des Cyberspace. In: Gräf, L. u.a.; 1997 .
- Deutsch, Karl W.; Soziale und politische Aspekte der Informationsgesellschaft. In: Sonn- tag, P.; 1983.
- Dostal, Werner; Die Informatisierung der Arbeitswelt - Multimedia, offene Arbeitsformen und Telearbeit. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 28.Jg.; 1995.
- Dyson, Esther u.a.; Eine Magna Charta f ü r das Zeitalter des Wissens. In: Bollmann, S. und Heibach, C. ; 1996.
- Enquete-Kommission: „Zukunft der Medien“ ; Schlu ß bericht zum Thema Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft; Bonn; 1998.
- Flusser, Vilém; Verb ü ndelung oder Vernetzung. In: Bollmann, S.; 1995 .
- Gates, Bill; Der Weg nach vorn. Die Zukunft der Informationsgesellschaft; Hoffmann und Campe Verlag; Hamburg; 1995.
- German, Christiano; Politische (Irr-)Wege in die globale Informationsgesellschaft In: Aus Politik und Zeitgeschichte B32; 1996 .
- Gibson, William; Neuromancer; Heyne; München; 1987.
- Gräf, Lorenz ; Locker verkn ü pft im Cyberspace. Einige Thesen zur Ä nderung sozialer Netzwerke durch die Nutzung des Internets. In: Gräf, L. u.a.; 1997 .
- Gräf, Lorenz und Krajewski, Markus (Hrsg.); Soziologie des Internet. Handeln im elekt- ronischen Web-Werk; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1997.
- Hamm, Ingrid; Medienkompetenz. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis; Nr. 4, 19. Jg.; 1996.
- Hasse, Raimund und Wehner, Josef; Vernetzte Kommunikation. Zum Wandel strukturier- ter Ö ffentlichkeit. In: Becker, B. u.a.; 1997.
- Hauf, Oliver; Die Informationsgesellschaft. Anatomie einer Lebensl ü ge; Verlag Peter Lang ; Frankfurt a. M. u.a.; 1996.
- Heilmann, Klaus; Die betrogene Gesellschaft. Kommunizieren im Informationszeitalter; Orell Füssli Verlag; Zürich und Wiesbaden; 1990.
- Heuser, Uwe Jean; Tausend Welten. Die Aufl ö sung der Gesellschaft im digitalen Zeital- ter; Berlin Verlag; Berlin; 1996.
- Hilty, Reto M. (Hrsg.); Information Highway. Beitr ä ge zu rechtlichen und tats ä chlichen Fragen; Stämpfli und Beck; Bern und München; 1996.
- Hilty, Reto M.; Information Highway - eine Einf ü hrung in die Problematik In: Hilty, R. M.; 1996.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang und Vesting, Thomas (Hrsg.); Perspektiven der Informations- gesellschaft; Nomos Verlagsgesellschaft ; Baden-Baden/ Hamburg; 1995.
- Hoffmann-Riem, Wolfgang und Vesting, Thomas; Ende der Massenkommunikation? Zum Strukturwandel der technischen Medien. In: Hoffmann-Riem; W. u.a.; 1995.
- Holtz-Bacha, Christina; Das fragmentierte Medien-Publikum. Folgen f ü r das politische System. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B42; 1997.
- Hörisch, Jochen und Raulet, Gérard; Sozio-kulturelle Auswirkungen moderner Informati- ons und Kommunikationstechnologien. Der Stand der Forschung in der BRD und in Frankreich; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1992.
- Hultzsch, Hagen; Die existierende Informationsgesellschaft - Realit ä t, Chancen und M ö g- lichkeiten. In: Informatik Spektrum 18; 1995 .
- IST-Online-Umfrage; Umfrage ü ber die Nutzung des Internets und kommerzieller Online- Dienste;; Karlsruhe/ Baden-Baden; 1996.
- Jokisch, Rodrigo (Hrsg.); Techniksoziologie; Surkamp; Frankfurt a. M.; 1982.
- Jones, Steven; Kommunikation, das Internet und Elekromagnetismus. In: Münker, S. u.a.; 1997.
- Lichtenberg, Peter und Lohmar, Ulrich; Gutenbergs Erben - Die Bundesrepublik Deutsch- land auf dem Weg zur Informationsgesellschaft; Seidel Verlagsgesellschaft; Bonn; 1986.
- Löffelholz, Martin und Altmeppen, Klaus-Dieter; Kommunikation in der Informationsge- sellschaft. In: Merten, K.; 1994.
- Lyon, David; The information soiety: issues and illutions; Policy Press; Cam- bridge/Oxford/New York; 1988.
- Mai, Manfred; Soziologie und neue Medien. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis; Nr. 4, 19. Jg.; 1996 .
- Mai, Manfred; Neue Medien - Alte Gesellschaft. Die ewige Herausforderung. In: Sozial- wissenschaften und Berufspraxis; Nr. 4, 19. Jg.; 1996 .
- Marschall; Stefan; Politik „ online “ - Demokratische Ö ffentlichkeit dank Internet ? In: Publizistik, Heft 3, 42 Jg.; 1997 .
- Merten, Klaus; Die Wirklichkeit der Medien; Westdeutscher Verlag; Opladen; 1994.
- Münch, Richard; Dialektik der Kommunikationsgesellschaft; Suhrkamp; Frankfurt a. M.; 1991.
- Münch, Richard; Dynamik der Kommunikationsgesellschaft; Suhrkamp; Frankfurt a. M.; 1995.
- Münker, Stefan und Roesler, Alexander (Hrsg.); Mythos Internet; Suhrkamp; Frankfurt a. M.; 1997.
- Murdock, Graham und Golding, Peter; Information Poverty and Political Inequality: Citi- zenship in the Age of Privatized Communications. In: Siefert, M. u.a.; 1989.
- Noelle-Neumann, Elisabeth; Ü berflu ß oder Mangel an Information. In Lohmar, U. u.a.; 1996.
- Nora, Simon u. Minc, Alain; Die Informatisierung der Gesellschaft; Campus Verlag; Frankfurt a.M./ New York; 1979.
- Otto, Ulrich (Hrsg.); Die Informationsgesellschaft als Herausforderung an den Menschen: Beitr ä ge zur Folgenabsch ä tzung von Informationstechnologie; Haag + Herchen Verlag; Frankfurt a. M.; 1984.
- Otto, Peter u. Sonntag, Philipp; Wege in die Informationsgesellschaft; dtv; München; 1985.
- Peach, Joachim; Medien-Macht und interaktive Medien; ZV Zeitungs-Verlag Service; Bonn; 1997.
- Plateau, Michael; Sozialit ä t in virtuellen R ä umen. In: Becker, B. u.a.; 1997.
- Poster, Mark; Elektronische Identit ä ten und Demokratie. In: Münker, S. u.a.; 1997.
- Rammert, Werner (Hrsg.); Computerwelten - Alltagswelten. Wie ver ä ndert der Computer die soziale Wirklichkeit?; Westdeutscher Verlag; Opladen; 1990.
- Rammert, Werner; Soziologie und k ü nstliche Intelligenz. Produkte und Probleme einer Hochtechnologie; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1995.
- Raulet, Gérard; Neue Medien- Neue Ö ffentlichkeit. . In: Hoffmann-Riem u.a.; 1995 .
- Rehbinder, Manfred; Soziologisches zum Information Highway. In: Hilty, R. M.; 1996.
- Rifkin, Jeremy; Das Ende der Arbeit und ihre Zukunft; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1995.
- Rosenberg, Richard S.; The Social Impact of Computers; Academic Press; Bosten u.a.; 1992.
- Roßnagel, Alexander u.a.; Die Verletzlichkeit der ‘ Informationsgesellschaft ‘ ; Westdeut- scher Verlag; Opladen; 1989.
- Rost, Martin; Anmerkungen zu einer Soziologie des Internets. In: Gräf, L. u.a.; 1997.
- Rötzer, Florian; Interaktion - das Ende der herk ö mmlichen Massenmedien. In: Bollmann, S.; 1995 .
- Rötzer, Florian; Aufmerksamkeit - der Rohstoff der Informationsgesellschaft. In: Boll- mann, S. und Heibach, C.; 1996.
- Sandbothe, Mike; Interaktivit ä t - Hypertextualit ä t - Transversalit ä t. Eine medienphiloso- phische Analyse des Internets. In: Münker, S u.a.; 1997.
- Schäfers, Bernhard (Hrsg.); Grundbegriffe der Soziologie; Leske + Budrich; Opladen; 1998.
- Schäfers, Bernhard u. Zapf, Wolfgang (Hrsg.); Handw ö rterbuch zur Gesellschaft Deutschlands; Leske + Budrich; Opladen; 1998.
- Schenk, Michael u.a .; Die Bedeutung sozialer Netzwerke bei der Diffusion neuer Kommu- nikationstechniken. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie; Jg.49, Heft 1, 1997.
- Schmid, Ulrich; Medien - Innovation - Demokratie: Zu den Entwicklungs- und Institutio- nalisierungsprozessen neuer Medien. In: Becker, B. u.a.; 1997.
- Schmidli, Patrick; Das Zeitalter der Telekommunikation: historische und soziale Aspekte einer zuk ü nftigen Telekommunikationsnutzung; Peter Lang AG, Europäischer Verlag der Wissenschaften; Bern u.a.; 1997.
- Schmutzer, Rupert; Vorstellungen ü ber die Merkmale und Folgen von neuen Medien. . In: Gräf, L. u.a.; 1997 .
- Schneider, Irmela; Neue Medien in Mediendiskursen. Einige Ü berlegungen zur Analyse von Netzkommunikation. In: Becker, B. u.a.; 1997; Campus Verlag; Frankfurt/ New York; 1997.
- Schröder, Klaus T. u.a.; Die Bundesrepublik auf den Weg zur Informationsgesellschaft? In: Aus Politik und Zeitgeschichte B15, 1989 .
- Schulz, Winfried; Neue Medien - Chancen und Risiken. In: Aus Politik und Zeitgeschich- te B42, 1997 .
- Seeger, Peter ; Interaktive Medien zwischen digitalem Fernsehen und Internet. Der My- thos der Interaktivit ä t. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis; Nr. 4, 19. Jg.; 1996 .
- Siefert, Marsha u.a.; The Information Gab - How Computers and other Communication Technologies Affects the Social Distribution of Power; Oxford University Press; New Y- ork/ Oxford; 1989.
- Sonntag, Philipp (Hrsg.); Die Zukunft der Informationsgesellschaft; Haag + Herchen Ver- lag; Frankfurt a. M.; 1983.
- Spinner, Hartmut F.; Informations- und Kommunikationsgesellschaft. In: Schäfers, B.; 1998.
- Spinner, Hartmut F.; Informationsgesellschaft. In: Schäfers, B. u. Zapf, W.; 1998 .
- Stoll, Clifford; Die W ü ste Internet. Geisterfahten auf der Datenautobahn; S. Fischer Ver- lag; 1996.
- Streit, Günther; Computer und Informatisierung der Gesellschaft. Sozialethische Ü berle- gungen zur dritten Phase der Industriellen Revolution; Verlag Peter Lang; Frankfurt a. M.; 1993.
- Toffler, Alvin; Die Zukunftschance. Von der Industriegesellschaft zu einer humaneren Zivilisation; C. Bertelsmann Verlag; München; 1980.
- Toffler, Alvin; Machtbeben. Der globale Vorsto ß der Informationseliten; Econ Taschen- buch Verlag; Düsseldorf/ Wien; 1990.
- Vester, Heinz-Günter; „ Informationsgesellschaft “ : Mythos und Realit ä t. In: Angewandte Sozialforschung 14,1; 1987 .
- Wagner, Robert; Die Informationsgesellschaft: Chancen f ü r eine neue Lebensqualit ä t am Beginn des dritten Jahrtausends; Waxmann Verlag; Münster; 1996.
- Weber, Max; Wirtschaft und Gesellschaft;; Tübingen; 1972.
- Webster, Frank; Theories of the information society; Routledge; London; 1995.
- Wehner, Josef; Medien als Kommunikationspartner - Zur entstehung elektronischer Schriftlichkeit im Internet. In: Gräf, L. u.a.; 1997 .
- Wersig, Gernot (Hrsg.); Informatisierung der Gesellschaft. Wie bew ä ltigen wir die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien; K. G. Saur Verlag KG; München; 1983.
- Wersig, Gernot; Die kommunikative Revolution: Strategien zur Bew ä ltigung der Krise der Moderne; Westdeutscher Verlag; Opladen; 1985.
- Wersig, Gernot; Fokus Mensch: Bezugspunkte postmoderner Wissenschaft: Wissen, Kommunikation, Kultur; Verlag Peter Lang; Frankfurt a. M.; 1993.
- Wersig, Gernot; Die Komplexit ä t der Informationsgesellschaft; Universitätsverlag Kon- stanz; Konstanz; 1996.
- William, J. Martin; The global information society; Aslib Gower; Hampshire; 1995.
- Willke, Helmut; Organisierte Wissensarbeit. In: Zeitschrift für Soziologie, Heft 3, 27. Jg.; 1998.
- Winkler, Hartmut; Suchmaschinen. Metamedien im Internet In: Becker, B. u.a.; 1997.
- Zimmer, Jochen; Profile und Potentiale der Onlinenutzung. In: Mediaperspektiven, Nr.9; 1996 .
- Zittel, Thomas; Ü ber Demokratie in der vernetzten Gesellschaft. Das Internet als Medium politischer Kommunikation. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B42; 1997 .
Versicherung
Hiermit erkläre ich, daß ich die Magisterarbeit mit dem Titel
„User und Loser - Chancen und Risiken auf dem Weg in die Informationsgesellschaft“
selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit sowie beigefügte Abbildungen und grafische Darstellungen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle als Entlehnung kenntlich gemacht.
Düsseldorf, den
Unterschrift des Kandidaten
[...]
1 Bisher fehlt es an einem theoretischen Erklärungsmodell, das die strukturellen Merkmale einer Informationsgesellschaft aufzeigt. Für Niklas Luhmann ist deshalb der Begriff der Informationsgesellschaft nur ein Schlagwort. Seiner Ansicht nach könne die Moderne “[...] sich selbst noch nicht ausreichend beschreiben, also markiert sie ihre Neuheit durch Bestempelung des Alten und verdeckt damit zugleich die Verlegenheit, nicht zu wissen, was eigentlich geschieht” (zit. nach Löffelholz, M. u. Altmeppen, K.-D.; 1994; 570).
2 In seinen Buch “Die kommunikative Revolution”(1985) sieht Gernot Wersig die Informationsgesellschaft zu- nächst noch als eine Art positive Utopie (Wersig, G.; 1985; 14 ff). Unter Utopie versteht er in diesem Zusammenhang eine Leitlinie zur Bewältigung der Krisen der Moderne. Dies könne durch den „richtigen“ Ein- satz neuer Technologien erreicht werden (ebd.; 5). In späteren Ausführungen trennt er sich jedoch von dieser äußerst optimistischen Sichtweise: “Unsere Gesellschaft schiebt momentan viele ungelöste Probleme vor sich
3 Die Drei-Sektoren-Hypothese geht auf Colin Clark bzw. Jean Fourastié zurück und entstand bereits in den 40er Jahren. Sie dient häufiger auch als Erklärungsmodell für die „ Dienstleistungsgesellschaft “ . 9
4 Alvin Tofflers 1980 erschienene Buch „ The Third Wave “ wurde unter dem deutschen Titel „ Die Zukunfts chance “ veröffentlicht.
5 Daniel Bell belegt die steigende Nachfrage nach akademischen-technischen Berufen am Beispiel der USA. Von 1960 bis 1975 stieg die Zahl der Natur- und Sozialwissenschaftler in den Vereinigten Staaten von 275 000 auf etwa 550 000. Im gleichen Zeitraum nahm die Zahl der Ingenieure von 800 000 auf ca. 1,5 Mio zu (vergl. Bell, D.; 1976; 36).
6 In dieser Vorstellung von einer „planbaren Technologie“ spiegelt sich der Fortschrittsglaube der 80er Jahre wieder, der heute kaum noch geteilt werden kann. Die durch technischen Fortschritt hervorgerufenen Nebenfolgen sind in den meisten Fällen nur schwer vorhersagbar, geschweige denn planbar. Gerade bei den neuen Informations- und Kommunikationstechnologien zeigt sich, daß ihre Einführung und Verbreitung in einer solchen Geschwindigkeit von Statten geht, die gar keine Zeit für abwägende Untersuchungen über mögliche Folgen läßt. Wie Ulrich Beck in seinem Buch über die „ Risikogesellschaft “ hingewiesen hat, sind es gerade die unka l- kulierbaren Risiken, welche das Bild der Moderne prägen.
7 Bell versteht darunter neue „Techniken“, besonders im Bereich der Mathematik, die entstanden sind, um das Problem der organisierten Komplexität zu lösen. Er nennt als Beispiele die Informationstheorie, die Entschei- dungstheorie, die Wahrscheinlichkeitstheorie, die Kybernetik oder auch die Spieltheorie. Bell vergleicht die Bedeutung der intellektuellen Technologien mit der der Maschinenindustrie in der Industriegesellschaft.
8 Der Aspekt der neuen Darstellungsformen gewinnt vor allem auch in Hinblick auf die sogenannten „neuen Medien“ an Bedeutung. Mittels ihrer erweiterten Darstellungsmöglichkeiten wie z.B. durch Multimedia; können sie bereits bekannte Sachverhalte in völlig neuer Form präsentieren und werden damit zu einer Quelle für „neues Wissen“.
9 Auch Richard Münch geht in seiner Konzeption einer „Kommunikationsgesellschaft“ davon aus, daß die Zunahme von Kommunikation bestimmend für die gesellschaftliche Veränderung ist. „Die Entwicklung der Kommunikationsgesellschaft bringt eine ungeheure Vermehrung, Beschleunigung, Verdichtung und Globalisierung von Kommunikation mit sich und eine außerordentliche Durchdringung der Gesellschaft durch Kommunikation“ (Münch, R.; 1991;22). Intersystemische Kommunikation, Vernetzung, Aushandeln und Kompromißbildung werden für Münch zu wichtigen Grundlagen der zukünftigen Gesellschaft.
10 Daniel Bell maß bereits dem Begriff des Wissens eine zentrale Bedeutung zu. Wersig greift bei seiner Analyse der Informationsgesellschaft auf die Arbeiten von Jürgen Habermas, Ulrich Beck, Anthony Giddens und JeanFraçois Loytard zurück. Er hebt dabei hervor, daß in allen vier Ansätzen zur Gegenwartsbeschreibung Information, Wissen und Kommunikation einen großen Stellenwert einnehmen.
11 Diese Herleitung der zunehmenden „Komplexitätstiefe“ aus der Differenzierung einer arbeitsteiligen Gesellschaft, welche Günter Streit vornimmt, erinnert an die Arbeiten Emil Durkheims zum Wandel von der mechanischen zur organischen Solidarität. Auch bei ihm wird Gleichheit der einzelnen Gesellschaftsmitglieder und gesellschaftliche Verbindlichkeit durch die Differenzierung einer arbeitsteiligen Gesellschaft aufgelöst. Durkheim bezieht seine Analyse jedoch vorrangig auf das „kollektive Bewußtsein“ der Gesellschaft und dessen Auswirkungen auf die vorhandenen Rechtsnormen.
12 Der Begriff der Telematik geht hauptsächlich auf Nora und Minc zurück (vergl. Nora, S. u. Minc, A.; 1979; 35). Die „Ehe“ zwischen Computern und Übertragungsnetzen hat zu einer Zusammenführung der Funktionen der Nachrichtentechnik (Übertragung von Signalen) und der Computertechnik (Digitalisierung und Speicherung von Daten) geführt.
13 Wersigs Begriffsverständnis von Autonomie ist sehr weit gefaßt. Er versteht darunter sowohl Prozesse der Individualisierung, als auch die Entstehung autopoietischer Systeme im Luhmann’schen Sinne.
14 In gewisser Weise können auch bei den eher unidirektionalen Massenmedien interaktive Elemente vorhanden sein. Beispielsweise können die Zuschauer bzw. Zuhörer Leserbriefe schreiben und auf diese Art auf das jeweilige Medium zurückwirken.
15 MUDs (Multi-User-Dungeons) sind virtuelle Welten im Internet, in denen sich eine große Anzahl der Internetnutzer treffen und miteinander kommunizieren können. Die Nutzer können dabei eigene „Räume“ schaffen, an Online-Spielen teilnehmen und Informationen austauschen.
16 Unter „Online-Gemeinschaften“ oder auch „virtuellen Gemeinschaften“ versteht man im herkömmlichen Sinne Gruppen von Personen, die sich in elektronisch erzeugten Räumen (z.B. Newsgroups, IRCs, MUDs, Mailinglisten,...) als Interaktionsgemeinschaft zusammenfinden. Dabei gilt bereits die passive Teilnahme als Mitgliedschaft dieser „Gemeinschaft“ (vergl. Gräf, L.; 1997; 117). Fraglich bleibt, ob bei dieser weitgefaßten Definition überhaupt von einer Gemeinschaft im soziologischen Sinn gesprochen werden kann.
17 Weber greift mit dieser Unterscheidung auf Ferdinand Tönnies zurück, der seinerseits zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft differenziert.
18 Diese Bezeichnung geht auf den russischen Ökonomen Nikolaj D. Kondratieff zurück.
19 Die Prozentangaben in Abbildung 6 gehen auf eine Untersuchung von Anderer aus dem Jahre 1995 zurück und geben die Einschätzung der Vor- und Nachteile von Telearbeit durch die Befragten wieder.
20 Die Übertragung wird dabei mit 140 Mbit/sec von einem Breitbandnetz der Telekom AG gewährleistet.
21 Auf den Begriff der Medienkompetenz wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kapitel 4.3. noch detailliert ein- gegangen.
22 Um Platz und Kosten zu Sparen, begnügte man sich bei der Entwicklung der ersten Generation von Informationssystemen und Software damit, das Datum zweistellig darzustellen. Viele Systementwickler ahnten nicht, daß die von ihnen entwickelten Programme noch im Jahr 2000 im Einsatz sein würden. Die zweistellige Repräsentation von Jahresangaben bringt jedoch mit der Annäherung an das Jahr 2000 erhebliche Probleme für die Funktionsfähigkeit vieler Informationssysteme mit sich. Alle zeitbezogenen Daten sind von dem Problem betroffen. Zur Zeit sind in vielen Organisationen eine große Anzahl von Programmierern damit beschäftigt, die Informationssysteme auf den Jahrtausendwechsel hin anzupassen.
23 Solche Prognosen sind mit Vorsicht zu genießen. Bei der unsicheren Lage der internationalen Wirtschaft und den sich schnell wandelnden Bedingungen ist es heute fast unmöglich, zuverlässige Vorhersagen zu machen. Uwe Jean Heuser bezeichnet solche Prognosen als „Leserei im Kaffeesatz“ (Heuser, 1996, S.78).
24 Der Begriff des Wissensarbeiters wurde vor allem in den 50er Jahren von dem Amerikaner Peter Drucker geprägt (vergl. Heuser, U. J.;1996; 20).
25 Diese Zahlen entstammen der Untersuchung GfK-Online-Monitor 1998. Die Erhebung wurde von November 1997 bis zum Januar 1998 durchgeführt und hatte eine repräsentative Stichprobe von 10 035 befragten Personen zwischen 14 und 59 Jahren als Grundlage (vergl. Enquete-Kommission; 1998; 89 f.).
26 Der Begriff „Vielsurfer“ ist hier mit Vorsicht zu genießen, da nicht zwangsläufig bei allen, die das Internet häufig nutzen, durch die vermehrte Nutzung die Wahrscheinlichkeit steigt, zufällig auf bestimmte Seiten zu stoßen. Es ist denkbar, daß diejenigen, die das Medium Internet sehr zielgerichtet nutzen, bei der vorliegenden Online-Erhebung unberücksichtigt bleiben. Man könnte z.B. vermuten, daß weibliche Internetnutzer zielgerich-
27 Als Beispiel für den Unterschied zwischen gesammelten Daten und Information führt Oliver Hauf die Entde- ckung des Ozonlochs an. Bereits im Jahr 1978 übermittelte der US-Wettersatellit „Nimbus 7“ Daten zur Erde, die auf eine Zerstörung der Ozonschicht über dem Südpol hinwiesen. Diese Daten wurden im Washington Nati- onal Record Center gespeichert. Sie wurden jedoch nicht wahrgenommen oder aber in einem falschen Kontext interpretiert. Erst später stießen Wissenschaftler durch die Auswertung anderer Raumsonden auf das Problem.
Häufig gestellte Fragen zu "INHALT"
Was sind die frühesten Hinweise auf den Begriff der Informationsgesellschaft?
Die frühesten Hinweise finden sich bei den informationsökonomischen Ansätzen, welche technische und ökonomische Aspekte in den Vordergrund stellen. Diese Theorien entstanden in den 60er und 70er Jahren in den USA und Japan.
Was beinhaltet die Drei-Sektoren-Hypothese und wie wird sie zur Veranschaulichung der Informationsgesellschaft genutzt?
Die Drei-Sektoren-Hypothese unterscheidet primären (Landwirtschaft), sekundären (Industrie) und tertiären (Dienstleistungen) Sektor. Sie wird genutzt, um die Verlagerung von Beschäftigten und wirtschaftlicher Bedeutung in den Dienstleistungssektor und später einen vierten, Informations- oder Wissenssektor, zu veranschaulichen.
Wer sind Fritz Machlup und Marc Porat und welchen Beitrag haben sie zur Quantifizierung der Informationsgesellschaft geleistet?
Fritz Machlup unternahm 1962 den Versuch, die Informationsgesellschaft quantifizierbar zu machen, indem er die „Informationsindustrie“ in fünf Hauptgruppen aufgliederte: Bildung, Kommunikationsmedien, Informationsgeräte, Informationsservice und andere Informationstätigkeiten. Marc Porat unterschied zwei Informationssektoren: primär (Industriezweige, die Informationen produzieren und verteilen) und sekundär (Tätigkeiten in anderen Industriezweigen, die ihren Schwerpunkt in der Gewinnung und Verbreitung von Information haben).
Wie definiert Karl W. Deutsch die Informationsgesellschaft quantitativ?
Karl W. Deutsch definiert die Informationsgesellschaft als eine nationale Ökonomie, in der mehr als 50% der Berufstätigen in überwiegend informationsorientierten Berufen tätig sind, und deren Beitrag zum Bruttosozialprodukt mehr als die Hälfte beträgt.
Was versteht Alvin Toffler unter der „Dritten Welle“ und wie beschreibt er die Informationsgesellschaft?
Alvin Toffler beschreibt die Informationsgesellschaft als die „Dritte Welle“ nach der Agrar- und Industriegesellschaft. Die zentrale Ressource der „Dritten Welle“ ist das „abrufbare Wissen“.
Welche fünf Komponenten sind für Daniel Bell ausschlaggebend, um die postindustrielle Gesellschaft festzumachen?
Daniel Bell nennt folgende Komponenten: Wirtschaftlicher Sektor, Berufsstruktur, Axiales Prinzip, Zukunftsorientierung und Entscheidungsbildung.
Was ist das „axiale Prinzip“ der nachindustriellen Gesellschaft nach Daniel Bell?
Theoretisches Wissen wird zum „axialen Prinzip“ der nachindustriellen Gesellschaft. Es wird zu einer Quelle von Innovationen und zum Ausgangspunkt gesellschaftlich-politischer Programmatik.
Wie unterscheidet sich Bells Auffassung der nachindustriellen Gesellschaft von informationsökonomischen Theorien?
Entgegen den informationsökonomischen Ansätzen geht Bells analytisches Model der „nachindustriellen Gesellschaft“ von einem multidimensionalen Wandlungsprozess aus. Die Informationsgesellschaft ist somit eine Informations- oder Wissensgesellschaft, in der Information zu einer wichtigen wirtschaftlichen Ressource wird.
Wie erklärt Gernot Wersig die Informationsgesellschaft als Ziel der Komplexitätsreduktion?
Gernot Wersig sieht die Informationsgesellschaft als eine Gesellschaft, in der die existierende Komplexität durch geeignete Hilfsmittel reduziert wird. Informationen dienen der Reduzierung von Ungewissheit angesichts gestiegener Komplexität.
Was sind die neuen Qualitäten der IuK-Technologien (Informations- und Kommunikationstechnologien)?
Die neuen Qualitäten der IuK-Technologien sind Interaktivität, Multimedialität und die Entwicklung globaler Netzwerke.
Wie verändern die IuK-Technologien die Arbeitswelt, insbesondere durch Telearbeit?
IuK-Technologien entkoppeln die Arbeit räumlich und schaffen Flexibilität. Telearbeit ermöglicht neue Formen der Integration von Familie und Beruf.
Welche Risiken birgt die Informationsgesellschaft laut dem Text?
Die Risiken sind wachsende Abhängigkeit von Technologien, Verletzlichkeit der Gesellschaft, Manipulation von Daten, Entstehung neuer gesellschaftlicher Klüfte (z.B. zwischen denen mit und ohne Arbeit, zwischen "Superreichen" und anderen, zwischen Computer-Alphabeten und Experten).
Welche Schwellen und Barrieren des Informationszugangs werden genannt?
Der Zugang zu einem Kommunikationsnetz, Zugang zu einem Internet Service Provider, Orientierungsinformationen, Erstellung und Veröffentlichung von Informationen und Angeboten, Bezahlbarkeit von Informationen, Medienkompetenz.
Was versteht man unter Medienkompetenz im Kontext der Informationsgesellschaft?
Medienkompetenz umfasst technisches Wissen, Kompetenz zum Wissensmanagement, soziale Kompetenz und Kompetenz zur persönlichen Entscheidungsfindung im Umgang mit Medien.
Was ist das "Jahr-2000-Problem"
Das "Jahr-2000-Problem" ist ein potenzielles Softwareproblem, bei dem Computer das Jahr 2000 falsch interpretieren, weil sie nur die letzten zwei Ziffern des Jahres verwenden. Dies könnte zu Fehlfunktionen in vielen Computersystemen führen.
- Quote paper
- Christoph Weiß (Author), 1999, User und Loser - Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96381