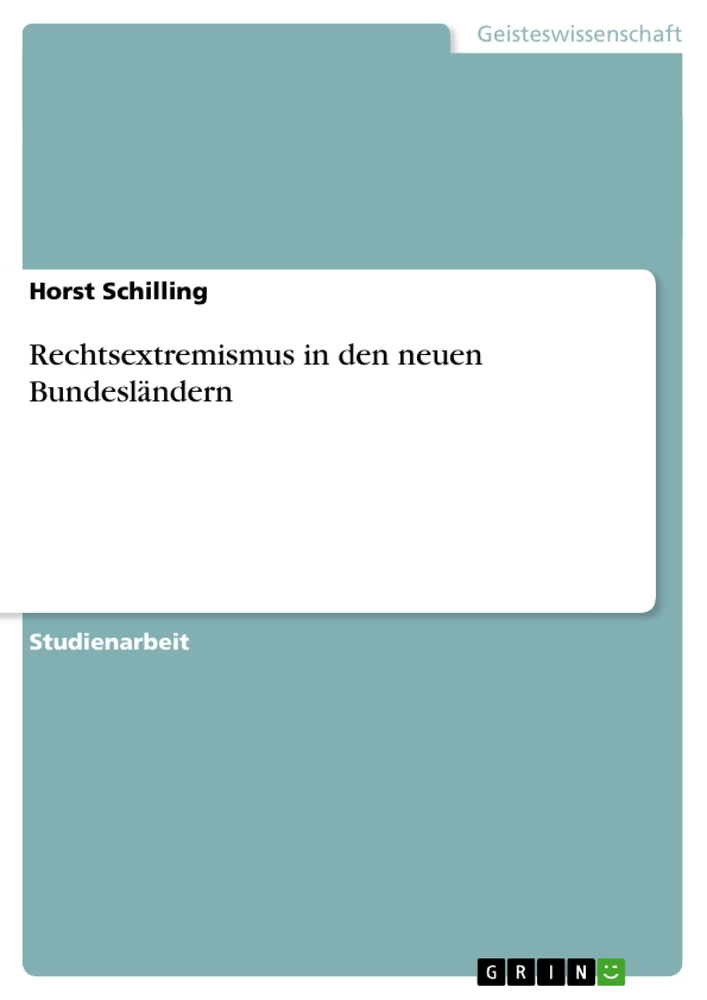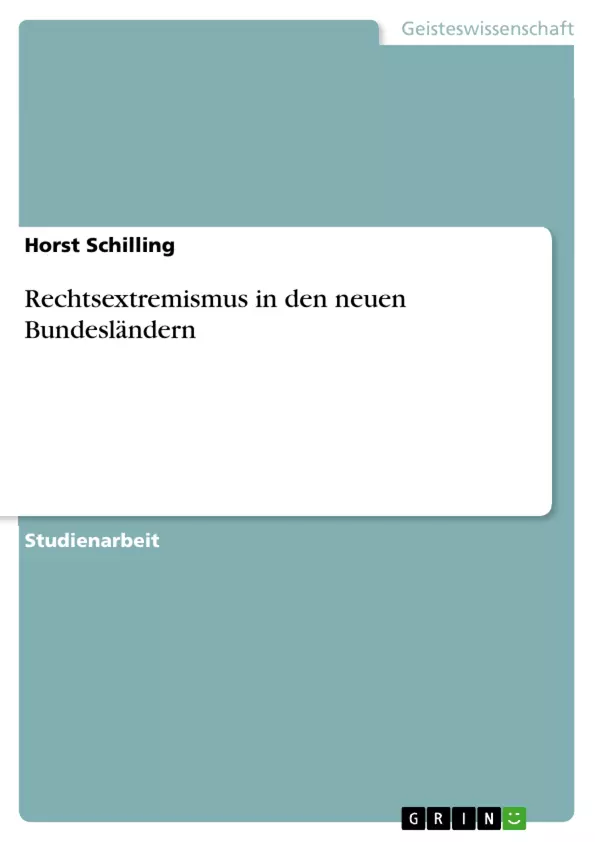Was treibt junge Menschen in Deutschland an, sich rechtsradikalen Ideologien zuzuwenden und Gewalt gegen Ausländer auszuüben? Diese intriguing Frage steht im Zentrum einer tiefgreifenden Analyse, die sich mit den komplexen Ursachen und Ausprägungen von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit unter Jugendlichen und Heranwachsenden, insbesondere in den neuen Bundesländern, auseinandersetzt. Die Untersuchung beleuchtet die Rolle der autoritären DDR-Gesellschaft, die Angst vor Arbeitsplatzverlust und den gesellschaftlichen Auflösungsprozess nach der Wiedervereinigung. Dabei werden Sündenbocktheorien, Wohnungssituationen und der Einfluss von Skinhead-Gruppen, Familienstrukturen, Medien und Jugendbanden auf die Eskalation von Gewaltbereitschaft und fremdenfeindlichen Übergriffen analysiert. Es wird der Frage nachgegangen, ob Repression und schärfere Strafen als geeignete Mittel zur Bekämpfung von sozial unerwünschten und strafbaren Handlungen dienen können, oder ob präventive Maßnahmen und Therapieansätze vielversprechendere Alternativen darstellen. Im Fokus stehen die Prävention durch Optimierung der Personalausstattung der Polizeibehörden und die Konfrontation der Täter mit den Folgen ihrer Taten, um eine langfristige Verhaltensänderung zu bewirken. Abschließend werden neue, nichtstrafrechtliche Formen der Konfliktlösung, wie erlebnispädagogische Angebote und politische Bildung in Schulen, als wichtige Bausteine einer umfassenden Strategie zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit unter Jugendlichen diskutiert, um eine inklusive und tolerante Gesellschaft zu fördern. Die Analyse dringt tief in die Lebenswelten junger Menschen ein, die von Benachteiligung, Nichtbeachtung und Ächtung betroffen sind, und sucht nach Wegen, ihnen eine Perspektive jenseits von Hass und Gewalt zu bieten, um so den Kreislauf von Vorurteilen und Diskriminierung zu durchbrechen und ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Hierbei wird auch die Rolle der Politik beleuchtet, welche gezielte Hilfe leisten muss, um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. Das Buch bietet somit einen essentiellen Beitrag zur Debatte über Rechtsextremismus, Jugendgewalt und Integration in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
B. Abkürzungsverzeichnis
C. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
II. Ursachen für die rechtsradikalen Einstellungen Jugendlicher und Heranwachsender, insbesondere in den neuen Bundesländern
- Autoritäre DDR-Gesellschaft
- Sündenbocktheorie
- Gesellschaftlicher Auflösungsprozeß
- Wohnungssituation
III. Ursachen für die hohe Gewaltbereitschaft und die offene Gewaltausübung Jugendlicher undHeranwachsender gegenüber Ausländern
- Skinhead-Gruppen
- Familie
- Medien
- Jugendbanden
- Benachteiligung, Nichtbeachtung, Ächtung
IV. Repression und schärfere Strafen als Mittel gegen sozial unerwünschte und strafbare Handlungen
- „Ab in den Knast?“
- „Vor dem Gesetz sind alle gleich“
V. Lösungsvorschlag
- Prävention
- Therapie statt Strafe?
D. Anlage: Versicherung
B. Abkürzungsverzeichnis
Soweit Abkürzungen nicht besonders erläutert sind, wird verwiesen auf: Kirchner, Hildebert Abkürzungen für Juristen, 2. neubearb. Aufl., Berlin 1993
C. Literaturverzeichnis
Aschwanden, Dirk - Jugendlicher Rechtsextremismus als gesamtdeutsches Problem, BadenBaden 1995
Albrecht, Peter-Alexis- Jugendstrafrecht: ein Studienbuch, 2. erw. und erg. Aufl., München 1993
Bartels, Karl - Dämme - Oder: Der projektiv verschobene Haß, Frankfurt am Main 1991
Berg, Carl-Friedrich - Wolfsgesellschaft: Die demokratische Gemeinschaft und ihre Feinde. Der kommende Kulturkampf, Tübingen 1995
Birsl, Ursula / Busche-Baumann, Maria / Bons, Joachim / Kurzer, Ulrich - Jugendlicher Rechtsextremismus und Gewerkschaften, Lebensverhältnisse und politische Orientierungen von Auszubildenden, Opladen 1995
Borchers, Andreas - Neue Nazis im Osten: Hintergründe und Fakten, Weinheim 1992
Breuer, Wilhelm - Ausländerfeindlichkeit in der ehemaligen DDR - Studie zu Ursachen, Umfang und Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit im Gebiet der ehemaligen DDR und zu den Möglichkeiten ihrer Überwachung, Köln 1990
Breyvogel, Wilfried (Hg.) - Lust auf Randale - Jugendliche Gewalt gegen Fremde, Bonn 1993
Eibicht, Rolf-Josef (Hg.) - Unterdrückung und Verfolgung Deutscher Patrioten - Gesinnungsdiktatur in Deutschland?, Viöl 1997
Fischer, Lorenz / Wiswede, Günter - Grundlagen der Sozialpsychologie, München 1997
Förster, Peter / Friedrich, Walter / Müller, Harry / Schubarth, Wilfried - Jugend Ost: Zwischen Hoffnung und Gewalt, Opladen 1993
Friedrichs, Jürgen - Methoden empirischer Sozialforschung 12. Aufl., Opladen 1984
Friedrichs, Jürgen / Lepsius, M. Rainer / Mayer, Karl Ulrich - Die Diagnosefähigkeit der Soziologie, Opladen 1998
Füchtner, Hans - Vaterlandssyndrom: zur Sozialpsychologie von Nationalismus, Rechtsradikalismus, und Fremdenhaß, Heidelberg 1996
Hafeneger, Benno - Rechte Jugendliche: Einstieg und Ausstieg; sechs biographische Studien, Bielefeld 1993
Hartmann, Ulrich - Rechtsextremismus bei Jugendlichen: Anregungen, der wachsenden Gefahr entgegenzuwirken, München 1985
Heiland, Hans-Günther / Lüdemann, Christian (Hrsg.) - Soziologische Dimensionen des Rechtsextremismus, Opladen 1996
Heitmeyer, Wilhelm / Müller, Joachim - Fremdenfeindliche Gewalt junger Menschen: biographische Hintergründe, soziale Situationskontexte und die Bedeutung strafrechtlicher Sanktionen, Bonn 1995
Hellmann, Kai-Uwe / Koopmans, Ruud (Hrsg.) - Paradigmen der Bewegungsforschung Entstehung und Entwicklung von Neuen sozialen Bewegungen und Rechtsextremismus, Opladen 1998
Hoffmann, Lutz / Even, Herbert - Soziologie der Ausländerfeindlichkeit: zwischen nationaler Identität und multikultureller Gesellschaft, Weinheim 1984
Holthusen, Bernd - Rechtsextremismus in Berlin: aktuelle Erscheinungsformen, Marburg 1994
Jahnke, Karl Heinz / Wendt, Manfred / Koch, Ingo - Rostock: August 1992 - Eskalation der Gewalt - Ursachen - Konsequenzen, Rostock 1993
Jaschke, Hans-Gerd - Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit - Begriffe, Positionen, Praxisfelder, Opladen 1994
Klawe, Willi / Matzen, Jörg (Hrsg.) - Lernen gegen Ausländerfeindlichkeit: pädagogische Ansätze zur Auseinandersetzung mit Orientierungsverlust, Vorurteilen und Rassismus, Weinheim 1993
Klönne, Arno - Kein Spuk von gestern - oder: Rechtsextremismus und „Konservative Revolution“, Münster 1996
Knortz, Heike - Fremdenfeindlichkeit in Deutschland: ein interdisziplinärer Diskussionsbeitrag, Frankfurt am Main 1994
Knütter, Hans-Helmuth - Die Faschismus-Keule: das letzte Aufgebot der deutschen Linken, Frankfurt/M. 1993
Kowalsky, Wolfgang / Schroeder, Wolfgang (Hrsg.) - Rechtsextremismus - Einführung und Forschungsbilanz, Opladen1994
Kromrey, Helmut - Empirische Sozialforschung: Modelle und Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung, 3. Aufl., Opladen 1986
Kühnl, Reinhard / Wiegel, Gerd / Klittich, Steffen / Renner, Jens - Die extreme Rechte in Europa - Zur neueren Entwicklung in Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien, Heilbronn 1998
Mayntz, Renate - Soziale Dynamik und politische Steuerung: theoretische und methodologische Überlegungen, Frankfurt/Main 1997
Mayntz, Renate / Holm, Kurt / Hübner, Peter - Einführung in die Methoden der empirischen Soziologie, 4. Aufl., Opladen 1974
Minkenberg, Michael - Die neue radikale Rechte im Vergleich USA, Frankreich, Deutschland, Opladen 1998
Möller, Kurt / Schiele, Siegfried (Hrsg.) - Gewalt und Rechtsextremismus: Ideen und Projekte für soziale Arbeit und politische Bildung, Schwalbach/Ts. 1996
Moreau, Patrick / Hans-Seidel-Stiftung (Hrsg.) - Die PDS: Profil einer antidemokratischen Partei, München 1998
Müller-Münch, Ingrid - Biedermänner und Brandstifter: Fremdenfeindlichkeit vor Gericht, Bonn 1998
Neubacher, Frank - Jugend und Rechtsextremismus in Ostdeutschland: vor und nach der Wende, Bonn 1994
Nolting, Hans-Peter / Paulus, Peter - Psychologie lernen - Eine Einführung und Anleitung, Weinheim 1985
Otto, Hans-Uwe / Merten, Roland (Hrsg.) - Rechtsradikale Gewalt im vereinigten Deutschland - Jugend im gesellschaftlichen Umbruch, Bonn 1993
Pfahl-Traughber, Armin - Rechtsextremismus: eine kritische Bestandsaufnahme nach der Wiedervereinigung, Bonn 1993
Plattner, Johann Hubert - Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland - InauguralDissertation, Ludwig-Maximilians-Universität, München 1998
Rabert, Bernhard - Links- und Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik Deutschland von 1970 bis heute, Bonn 1995
Rohrmoser, Günter - Der Ernstfall: die Krise unserer liberalen Republik, Berlin 1996
Schad, Ute - Verbale Gewalt bei Jugendlichen: ein Praxisforschungsprojekt über ausgrenzendes und abwertendes Verhalten gegenüber Minderheiten, Weinheim 1996
Schumann, Siegfried / Winkler, Jürgen R. (Hrsg.) - Jugend, Politik und Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz: Ergebnisse eines empirischen Modellprojekts, Frankfurt am Main 1997
Symanek, Werner - VAWS-Pressebüro West - Unter falscher Flagge, 3. Aufl., Bingen am Rhein 1995
Waibel, Harry - Rechtsextremismus in der DDR bis 1989, Köln 1996
Wiesenhütter, Jürgen - Fremdenfeindlichkeit: Hintergründe und Gegenmaßnahmen: eine Spezialbibliographie deutschsprachiger psychologischer Literatur, Trier 1995
Willems, Helmut - Jugendunruhen und Protestbewegungen: Eine Studie zur Dynamik innergesellschaftlicher Konflikte in vier europäischen Ländern, Opladen 1997
Wottawa, Heinrich - Psychologische Methodenlehre - Eine orientierende Einführung, völlige Neubearbeitung, Weinheim 1988
I. Einleitung
Nach dem Terror der linksextremistischen RAF1 wird in der Bundesrepublik Deutschland seit Anfang der 90er Jahre von einem Ansteigen der politisch motivierten Straftaten mit rechtsextremen Hintergrund berichtet.2 Kommt nun nach der Wiedervereinigung der politische Terror zurück, diesmal von rechts?3 Insbesondere in den neuen Bundesländern gilt der Rechtsextremismus in Form ausländerfeindlicher Gewalt als weit verbreitet, hierzu berichtete aber die FAZ vom 28.9.90:4
„Am 3. Oktober fernsehgerechte Krawalle auf Bestellung? Bei den Feiern zur deutschen Einheit liegen den Sicherheitsbehörden Hinweise vor, daß Fernsehteams aus aller Welt gegen Bezahlung Tips aus der Chaotenszene erhielten, um extremistische Aktionen filmen zu können. Der ‚Preis‘ für einen ‚fernsehgerechten Auftritt‘ rechter Extremisten mit Singen des Horst-Wessel-Liedes und Hitler-Gruß beispielsweise betrage 2000 Mark“
Rechtsextreme Gewalttaten sind gerade bei der jüngeren Generation überproportional anzutreffen:5
„Rechtsextreme Orientierungen, v.a. nationalistische Anschauungen, Fremdenfeindlichkeit, Gewaltbereitschaft haben sich seit 1990 unter ostdeutschen Jugendlichen verstärkt. Diese Einstellungen / Verhaltensdispositionen sind heute nicht nur quantitativ häufiger verbreitet, sondern sie werden auch von den jungen Leuten im Alltag intensiver zum Ausdruck gebracht. (...) Eine Emotionalisierung und Radikalisierung des Denkens wie des Alltagshandelns ist unverkennbar (...).“6
In Deutschland sind markante Beispiele für fremdenfeindliche Gewalttaten auszumachen: Hoyerswerda (1991); Rostock7 (1992); Mölln (1992); Solingen8 (1993).
In Folge etablierten sich in der Bevölkerung die Begriffe „Ausländerfeindlichkeit“ und „Rassismus“. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat im Verfassungsschutzbericht 1993 dazu folgendes veröffentlicht:
„Fremdenfeindliche Straftaten werden als Delikte definiert, die in ihrer Zielrichtung gegen Personen begangen werden, denen Täter (aus intoleranter Haltung heraus) auf Grund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft oder aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes ein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht in seiner Wohnumgebung oder in der gesamten Bundesrepublik Deutschland bestreiten oder gegen sonstige Personen oder Institutionen/ Objekte/ Sachen begangen werden, bei denen Täter aus fremdenfeindlichen Motiven heraus handeln.“
Dem Rassismus sind Handlungen mit der Zielsetzung zuzuordnen, einzelne Prinzipien der freiheitlichen demokratischen Grundordnung außer Kraft zu setzen oder zumindest in Frage zu stellen.
Eine Äußerung kann dann als rassistisch gewertet werden, wenn sie inhaltlich „deutsche Belange“, mehr oder weniger begründet9, überhöht dargestellt, wie z.B. „Deutschland den Deutschen“.10
Der rechtsextreme Kern vertritt neben den NS-Mythen (Dolchstoßlegende) die im Dritten Reich vorherrschende „völkisch-kulturelle Überlegenheit“ (Herrenrasse, Volksgemeinschaft;
„Rassismus ist nicht einfach nur ein ideologisches Ablenkungsmanöver der Herrschenden, sondern er ist im Denken der Bevölkerung weit verbreitet ...“).11
II. Ursachen rechtsradikaler Einstellungen Jugendlicher und Heranwachsender in den neuen Bundesländern
1. Autoritäre DDR-Gesellschaft
In der Vorurteilsforschung12 hat sich gezeigt, daß ein Großteil von Vorurteilen gegenüber anderen Ethnien13 sehr stark abhängig ist von familialen Traditionen, die völlig unabhängig vom konkreten Umgang mit den angefeindeten Personen tradiert werden14 (autoritäre DDR- Gesellschaft = massenhaft autoritäre Charakterzüge bei der Bevölkerung = rechtsextreme Verhaltensweisen?15 ). Die 1990 in Leipzig durchgeführte Studie des Zentralinstituts für Jugendforschung16 ergab, das z.B. 16% der Jugendlichen der Aussage zustimmten, „daß wir wieder einen Führer haben (sollten), der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert“. 1992 waren es nach der Freudenberg-Studie immerhin noch 13%.17
2. Sündenbocktheorie
Als Faktor für Ausländerfeindlichkeit kommt nach einer Expertenbefragung aus 1990 vor allem die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust in Betracht“ („Sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg“18 ).19 Zur Situation der Jugendlichen in den neuen Ländern muß man sich vergegenwärtigen, daß viele Jugendeinrichtungen von den bisherigen Trägern nicht mehr finanziert werden. Kontaktarmut, Vereinsamung und ein Selbstbewußtseinsdefizit könnten hier den fruchtbaren Boden für Ausländerfeindlichkeit bereiten.
3. Gesellschaftlicher Auflösungsprozeß, Arbeitslosigkeit
Ein Auflösungsprozeß ist insbesondere bei Beziehungen zu anderen Personen oder Lebenszusammenhängen zu beobachten.20 Aktuelle Lebensumstände wie etwa zerrüttete Familienverhältnisse („broken home“) in Verbindung mit Liebes- und Zuwendungsentzug durch das Elternhaus und Arbeitslosigkeit kommen demnach für rechtsradikale Einstellungen hauptsächlich in Betracht.
Weiterhin könnten Hilflosigkeit, emotionale Kälte, Probleme in Schule und am Arbeitsplatz sowie eine kulturelle Entfremdung21 als Ursache gesehen werden.22 Übermäßiger Alkoholkonsum23, Verweigerung von Mitbestimmung, das immer größer werdende Mißtrauen gegenüber den traditionellen Parteien (die Identifikation mit politischen Richtungen und den Parteien hat [...] bei den ostdeutschen Jugendlichen stark nachgelassen24 ), die Erfahrung von Ohnmacht, sowie Umweltzerstörung kommen ebenfalls ursächlich in Betracht.25
4. Wohnungssituation
Wer die ostdeutschen Plattenbauten einmal gesehen hat, ahnt vielleicht, daß die mangelnden Freizeitmöglichkeiten für die jetzige Situation mit verantwortlich gemacht werden müßten. Hieraus begründet sich möglicherweise ein Teil der jugendlichen Desorientierung:
„Nach heutigen Maßstäben weisen die Siedlungen gravierende Mängel in den Bereichen der städtischen Infrastruktur auf. Eine Kleingewerbestruktur von Läden und Dienstleister ist so gut wie nicht vorhanden, und es fehlen kulturelle Einrichtungen sowie Betreuungseinrichtungen für Jugendliche und ältere Menschen. Nur Kindergärten sind ausreichend angelegt.“26
III. Ursachen für die hohe Gewaltbereitschaft und die offene Gewaltausübung Jugendlicher und Heranwachsender gegenüber Ausländern
1. Skinhead-Gruppen
Im Gegensatz zum Westen ist in den neuen Bundesländern der Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung sehr viel niedriger.27 Zur hohen Gewaltbereitschaft (18% IPOS 1993, 199528 ) und offenen Gewaltausübung Jugendlicher und Heranwachsender gegenüber Ausländer kann ausgeführt werden, daß die DDR-Skinhead-Gruppen sich stärker an nationalsozialistische Gruppen orientierten (Kühnen-Flügel), in Folge traten die Skinheads offener und brutaler auf. Insbesondere wuchs die Gewaltbereitschaft auch deshalb an, weil Gewalt erfolgreich schien.29
2. Familie
In der Literatur werden einige Problemkreise genannt, wie z.B. die Gewalt in der Familie, insbesondere gegen Frauen und Kinder.30 Wenn im Elternhaus physische und/oder psychische Gewalt (Drohung, Beleidigung, Verachtung) praktiziert wird, kann davon ausgegangen werden, daß ein Teil der aus diesem „zerrütteten Elternhaus“ stammenden Jugendlichen eine erhöhte Aggressionsbereitschaft aufweist: „Jeder sechste Jugendliche meint, zur Gewalt greifen zu müssen, um seine Interessen durchzusetzen.“31
3. Medien
Ein Problem ist die Gewalt in den Medien32. Fraglich bleibt, ob Jugendliche und Heranwachsende unter dem Eindruck visueller Gewaltszenen emotionell abstumpfen bzw. dadurch „Spaß an Gewalt“ entwickeln.33
4. Jugendbanden
In den Jugendcliquen mit ausgeprägten rechten Orientierungsmustern ist eine hohe Gewaltbereitschaft zu beobachten.34 Gruppenintern wird oft für spätere ‚echte‘ Auseinandersetzungen mit Vertretern gegnerischer Gruppen/Cliquen „geübt“.35 Solche Gruppendynamik „scheint gerade im Hinblick auf ausgeübte Gewalt bei Jugendlichen von erheblicher Bedeutung“:36
5. Benachteiligung, Nichtbeachtung, Ächtung
Weitere Indizien mögen auch die (gefühlsmäßige) Benachteiligung37 mit dem daraus resultierenden Ringen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und die Nichtbeachtung sein: „Man muß leider zur Gewalt greifen, weil man nur so beachtet wird“.38 Zudem könnte die Erwartung, daß man als Rechtsextremer unumkehrbar aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist39, strafrechtliche Folgen egal werden lassen.
IV. Repression und schärfere Strafen als Mittel gegen sozial unerwünschte und strafbare Handlungen
Die unabhängige Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkommission) führte aus, daß der Staat auch „begrenzte (rechtsextremistische) Rechtsverletzungen“ nicht akzeptieren kann. Gegenüber fremdenfeindlich orientierten Personen soll also unnachsichtig geahndet werden.40
Aus verhaltenstheoretischer Perspektive kann zu diesen Bestrebungen insbesondere unter Berücksichtigung der Erkenntnisse über die wechselseitige Beziehung von Einstellungen und Verhalten wie folgt Stellung genommen werden:
Nur anhand einer fremdenfeindlichen Einstellung ist nicht unmittelbar erkennbar bzw. mit Sicherheit vorhersagbar, ob und ggf. in welcher Intensität sich der betreffende Jugendliche strafrechtlich relevant engagieren wird.41 Besorgnis muß aber hinsichtlich der Quantität solcher fremdenfeindlichen Einstellungen bestehen:
„Finden sich nun viele solche „Abweichler“, so entwickeln sich über Generalisierungsprozesse neue Wertestandards, die auf das gesamte soziale System wirken (sozialer Wandel).“42
Auf einen einfachen Nenner gebracht: Wird die fremdenfeindliche Gewalt nicht unnachsichtig bekämpft, könnte auf längere Sicht eine Republik von Ausländerhassern entstehen.
1. „Ab in den Knast?“
Einem Großteil der (ausländerfeindlichen) Jugendstraftaten geht keine längerfristige Planung voraus, sie geschehen meistens spontan aus einer Situation heraus.43 Dies kann zwar nicht entschuldigen, aber ausschließlich freiheitsentziehende Sanktionen vorzusehen, dürfte allein unzureichend sein:
„Eine ausschließlich auf generalpräventive Legitimation rekurrierende Begründung für repressiv-stationäre Maßnahmen würde sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen wie auch anerkannten Rechts- und Verfassungsprinzipien widersprechen. Deshalb erzwingen die jugendkriminologischen Erkenntnisse über kurz oder lang ein Umdenken im Hinblick auf die repessivste Form des Umgangs mit Jugendkriminalität: die Einsperrung.“44
2. „Vor dem Gesetz sind alle gleich“
Eine „Extrabehandlung“ fremdenfeindlicher Gewalttäter würde diesen herbrachten Grundsatz tangieren. Die Antwort muß hier die unabhängige Rechtsprechung im Rahmen der schuldangemessenen Bestrafung geben.
Das Jugendgerichtsgesetz bietet hier hinreichende Möglichkeiten, zumal es nicht die Strafe sondern den Erziehungsgedanken in den Vordergrund stellt (Rechtsfolgendifferenzierung45 ).
V. Lösungsvorschlag
Fremdenfeindliche Gewalttaten könnten möglicherweise schon im Vorfeld vermieden bzw. minimiert werden.
1. Prävention
Ein wirksames Präventionskonzept beinhaltet zunächst die Optimierung der polizeibehördlichen Personalausstattung.
Zwar wird man nicht alle Rechtsextremisten überwachen können, die Wahrscheinlichkeit einer schnellen strafrechtlichen Sanktion (Abschreckung) steigt damit aber. Zu unterscheiden wäre auch, aus welchem Umfeld die fremdenfeindliche Tat begangen wird. Bei bereits etablierten rechtsextremistischen Gewaltpotentialen würden, im Gegensatz zu nicht organisierten Einzeltätern, Präventionsmaßnahmen ins Leere laufen. Auch müßte die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung verbessert werden. Abzuwarten bleibt dann, ob sich der Rückgang fremdenfeindlicher Gewalttaten fortsetzt.46
2. Therapie statt Strafe?
Mit der Inhaftierung wird der Jugendliche für die Dauer der Freiheitsentziehung dem sozialgesellschaftlichen Gefüge entzogen.
Was nützt es aber diesem Jugendlichen, wenn ihm durch Freiheitsentzug möglicherweise der Rückweg in die soziale Gemeinschaft verwehrt wird? Zu erwarten wäre, daß ein Rückfall in rechtsorientierte Verhaltensweisen stattfindet.
Es müssen also neue, nichtstrafrechtliche Formen der Konfliktlösung herausgearbeitet werden:
- es sollte bei der Masse der rechten, gewaltbereiten Szene eine Konfrontation mit den Opferfolgen stattfinden,47
- es müssen in der aktiven Jugendarbeit - gemeinsam mit dem organisierten Rechtsextremismus - „Reibungsflächen“ geboten werden, so z.B. in der Erlebnispädagogik: „Dort, wo in der Jugendarbeit attraktive Elemente wie Abenteuer, Action, Körpererfahrung und Überlebenstraining angeboten werden, besteht die Chance, Vertrauen zu jenen Jugendlichen zu entwickeln und sie neue Lebenszüge erleben zu lassen“,48
- im Rahmen der politischen Bildung könnte ein Ansatz zunächst in den Schulen gemacht werden. Dort kommen die rechtsorientierten Jugendlichen am ehesten mit ausländischen Mitschülern in Kontakt.
Dabei muß darauf geachtet werden, daß die Mehrheits- bzw. Minderheitsverhältnisse zwischen Deutschen und Ausländern nicht „umkippen“.49
Mithin werden die politischen Eliten umdenken müssen. Denn eine präventive Politik gegen Gewalt und Rechtsextremismus wird sich zunächst immer auf die beteiligten Menschen - hier die Jugendlichen - ausrichten müssen, hier muß gezielte „Hilfe“ einsetzen.50
[...]
1 Rabert, S. 88 ff.; Jaschke, S. 77; Willems, Jugendunruhen, S. 324
2 Breyvogel, Randale, S. 14; Rabert, S. 322; Lynen von Berg, Heinz in: Kowalsky/Schroeder, S. 103, 113; Aschwanden, S. 28; Sippel, Heinrich, in: Knortz, S. 64; Knütter, S. 87 f.; Willems, Helmut, in: Otto/Merten, S. 94; Plattner, S. 178 f.
3 Rabert, S. 340: keine akute Gefahr; Knütter, S. 28 f.: „(...) Manipulation der SED-PDS (...)“
4 Heiland/Lüdemann, S. 12.; Winkler, Jürgen R., in: Schumann/Winkler, S. 21; PfahlTraughber, S. 236; Plattner, S. 210: „ (...) übersteigertes Medieninteresse (...)“
5 Aschwanden, S. 31 ff.; Breyvogel, Randale, S. 16
6 Förster/Friedrich/Müller/Schubarth, S. 12
7 Symanek, S. 38; bedenklich: Bohlinger, Roland, in: Eibicht, S. 76 f.: „(...) Auch der Bundeskanzler sprach in der Bonner Kabinettsrunde am 26. August davon, daß die Rostocker Krawalle ‚generalstabsmäßig vorbereitet‘ und von ‚ehemaligen Stasi-Leuten‘ angezettelt wurden“
8 Müller-Münch, S. 87 ff.; Symanek, S. 53 ff.: zur Problematik des V-Mann Bernd Schmitt
9 Breuer, S. 59 ff.
10 Förster/Friedrich/..., S. 105ff.; Füchtner, S. 124; Breyvogel, Randale, S. 39; kritisch: Lummer, Heinrich, in: Eibicht, S. 604: „Deutschland soll den Deutschen genommen werden. Ob man das Landnahme, Überfremdung oder Unterwanderung nennt, tut nichts zur Sache“
11 Aschwanden, S. 122 ff., Mythen; Kühnl/Wiegel, S. 187; Rabert, S. 263 ff. (267)
12 Schad, S. 62 ff.; Fischer/Wiswede, S. 261 ff.: Strukturen des Vorurteils
13 Birsl/Busche-Baumann/Bons/Kurzer, S. 52.: Zielgruppe durchaus austauschbar, z.B. in Obdachlose oder Behinderte (jedenfalls nach Studie Südniedersachsen)
14 Fischer/Wiswede, S. 224
15 Otto/Merten, S. 197; Klönne, Arno, in: Kowalsky/Schroeder, S. 132; Waibel, S. 158; Aschwanden, S. 79 ff.; kritisch: Knütter, S. 74 ff.; Fröchling, Helmut, in: Knortz, S. 86
16 Hafeneger, S. 7
17 Pfahl-Traughber, S. 184 f.; allgemein: Förster/Friedrich/Müller/Schubarth, S. 129
18 Pfahl-Traughber, S. 187; Merkel, Angela, in: Otto/Merten, S. 404: ... oder aus Gründen des Sozialneids daran glauben; Fischer/Wiswede, S. 264 f., zur Sündenbocktheorie
19 Demirovic, Alex, in: Klawe/Matzen, S. 147, vereinfacht das Problem in unzulässiger Weise
20 Nave-Herz, Rosemarie, in: Friedrichs/Lepsius/Mayer, S. 305, mit Hintergrund; Heitmeyer, Wilhelm, in: Otto/Merten, S. 114 ff.; Rohrmoser, S. 544 f.; Friedrich, Walter, in: Otto/Merten, S. 197; Heitmeyer, S. 125 ff.; Füchtner, S. 93; Hopf, Cgristel, in: Otto/Merten, S. 162 f., vgl. Borchers, S. 154; Förster, S. 169 ff.; Merten, Roland, in: Otto/Merten, S. 136; Matzen, Jörg, in: Klawe/Matzen, S. 118
21 Leggewie, Claus, in: Otto/Merten, S. 121
22 Leggewie, Claus, in: Hellmann/Koopmans, S. 145
23 Schad, S. 21
24 Förster, S. 12
25 Hartmann, S. 100
26 Hübl, Lothar, in: Zwischen Sanierung und Abriß - Plattenbauten in den neuen Bundesländern, Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank (Hrsg.), Leipzig 1996, S. 17
27 vgl. Berg, S. 72
28 Leggewie, Claus, in: Hellmann/Koopmans, S. 144; Nolting, in: Nolting/Paulus, S. 198 ff.: Gewalt als soziale Interaktion
29 Holthusen, S. 34 ff.; Pfahl-Traughber, S. 162 ff.; Willems, Gewalt, S. 245
30 Willems, Helmut, in: Otto/Merten, S. 89
31 Förster, S. 160
32 Fischer/Wiswede, S. 323 f.
33 Breyvogel, Randale, S. 30 f.
34 Fischer/Wiswede, S. 553 ff., Begriff und Formen der Gruppe; Heim, Gunda/Krafeld, Franz Josef/Lutzebäck, Elke/Schaar, Gisela/Storm, Carola/ Welp, Wolfgang, in: Klawe/Matzen, S. 31
35 vgl. Fischer/Wiswede, S. 617, Konflikte zwischen Gruppen, die Rolle von Emotionen
36 Heitmeyer, S. 15 f.
37 Fröchling, Helmut, in: Knortz, S. 87; Willems, Helmut, in: Otto/Merten, S. 100
38 Möller, Kurt, in: Möller/Schiele, S. 18
39 Stallberg, Friedrich W., in: Heiland/Lüdemann, S. 112
40 Schwind, Hans-Dieter/Baumann, Jürgen/Schneider, Ursula/Winter, Manfred, in: Otto/Merten, S. 419
41 Fischer/Wiswede, S. 206: „Aus Sicht des Sozialpsychologen ist also die Einstellung als eine ‚latente‘ Variable aufzufassen, die zwischen situativen (positiven oder negativen) Anreizbedingungen [] und unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten des Individuums ‚interveniert‘“, S. 207: ... im Anschluß an das Modell von Fishbein & Ajzen (1975) (...) verbesserte Erklärungsmöglichkeiten für Abweichungen von einem direkten Zusammenhang zwischen Einstellung und Verhalten“
42 Fischer/Wiswede; S. 222
43 Heitmeyer, S. 155
44 Albrecht, S. 47
45 Albrecht, S. 67 ff.
46 Plattner, S. 201 f., 209
47 Albrecht, S. 179 ff.; Geretshauer, Monika/Lenfert, Th./Weidner, Jens, in: Otto/Merten,S. 374 f.
48 Rabert, S. 328; vgl. Hafeneger, Benno, in: Klawe/Matzen, S. 135 ff.
49 Klönne, S. 79
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für rechtsradikale Einstellungen bei Jugendlichen und Heranwachsenden in den neuen Bundesländern?
Die Ursachen sind vielfältig und komplex. Genannt werden unter anderem die autoritäre DDR-Gesellschaft, die Sündenbocktheorie (Angst vor Arbeitsplatzverlust), gesellschaftliche Auflösungsprozesse (zerrüttete Familien, Arbeitslosigkeit), und die mangelhafte Wohnungssituation (unzureichende Freizeitmöglichkeiten in Plattenbauten).
Inwiefern spielt die autoritäre DDR-Gesellschaft eine Rolle bei rechtsradikalen Einstellungen?
In der Vorurteilsforschung zeigt sich, dass Vorurteile stark von familialen Traditionen abhängen. Die autoritäre DDR-Gesellschaft könnte massenhaft autoritäre Charakterzüge gefördert haben, was sich in rechtsextremen Verhaltensweisen äußert. Studien zeigten Zustimmung zu einer starken Führungspersönlichkeit.
Welche Rolle spielt die Sündenbocktheorie?
Die Angst vor Arbeitsplatzverlust durch Ausländer wird als Faktor für Ausländerfeindlichkeit genannt. Kontaktarmut, Vereinsamung und ein geringes Selbstbewusstsein können ebenfalls dazu beitragen.
Wie wirken sich gesellschaftliche Auflösungsprozesse und Arbeitslosigkeit aus?
<Ein Auflösungsprozess in Bezug auf soziale Beziehungen und Lebenszusammenhänge kann zu rechtsradikalen Einstellungen führen. Zerrüttete Familienverhältnisse, Liebesentzug, Zuwendungsentzug und Arbeitslosigkeit werden als Hauptfaktoren genannt.
Was sind die Ursachen für die hohe Gewaltbereitschaft gegenüber Ausländern?
Zu den Ursachen gehören Skinhead-Gruppen, die Familie (Gewalt in der Familie), die Medien (Gewalt in Medien), Jugendbanden, Benachteiligung, Nichtbeachtung, und Ächtung. Skinhead-Gruppen in der DDR orientierten sich stärker an nationalsozialistischen Gruppen, was zu offenerer und brutalerer Gewalt führte.
Welchen Einfluss haben Skinhead-Gruppen?
DDR-Skinhead-Gruppen orientierten sich stärker an nationalsozialistischen Gruppen und traten offener und brutaler auf. Die Gewaltbereitschaft stieg auch, weil Gewalt erfolgreich schien.
Wie beeinflusst die Familie Gewaltbereitschaft?
Gewalt in der Familie, insbesondere gegen Frauen und Kinder, kann zu erhöhter Aggressionsbereitschaft bei Jugendlichen führen.
Welchen Einfluss haben die Medien?
Es ist fraglich, ob Jugendliche unter dem Eindruck visueller Gewaltszenen emotional abstumpfen und dadurch „Spaß an Gewalt“ entwickeln.
Welche Rolle spielen Jugendbanden?
In Jugendcliquen mit rechten Orientierungsmustern ist eine hohe Gewaltbereitschaft zu beobachten. Gruppenintern wird für spätere Auseinandersetzungen mit gegnerischen Gruppen geübt.
Welche weiteren Faktoren tragen zur Gewaltbereitschaft bei?
Weitere Faktoren sind Benachteiligung, das Ringen nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, und die Erwartung, dass man als Rechtsextremer unumkehrbar aus der Gesellschaft ausgeschlossen ist.
Sind Repression und schärfere Strafen geeignete Mittel?
Ausschließlich freiheitsentziehende Sanktionen sind unzureichend, da viele Taten spontan geschehen. Jugendkriminologische Erkenntnisse fordern ein Umdenken im Hinblick auf die repressivste Form des Umgangs mit Jugendkriminalität: die Einsperrung.
Welchen Lösungsansatz wird vorgeschlagen?
Vorgeschlagen werden Prävention und gegebenenfalls Therapie statt Strafe. Ein wirksames Präventionskonzept beinhaltet die Optimierung der polizeibehördlichen Personalausstattung und die Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
Was beinhaltet Prävention?
Prävention beinhaltet die Optimierung der polizeibehördlichen Personalausstattung zur schnelleren strafrechtlichen Sanktion. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung soll verbessert werden.
Was beinhaltet Therapie statt Strafe?
Anstatt der Inhaftierung, die den Rückweg in die soziale Gemeinschaft erschwert, sollen neue, nichtstrafrechtliche Formen der Konfliktlösung herausgearbeitet werden. Dazu gehören die Konfrontation mit Opferfolgen, aktive Jugendarbeit mit "Reibungsflächen" (z.B. Erlebnispädagogik), und politische Bildung in Schulen.
- Quote paper
- Horst Schilling (Author), 1999, Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96401