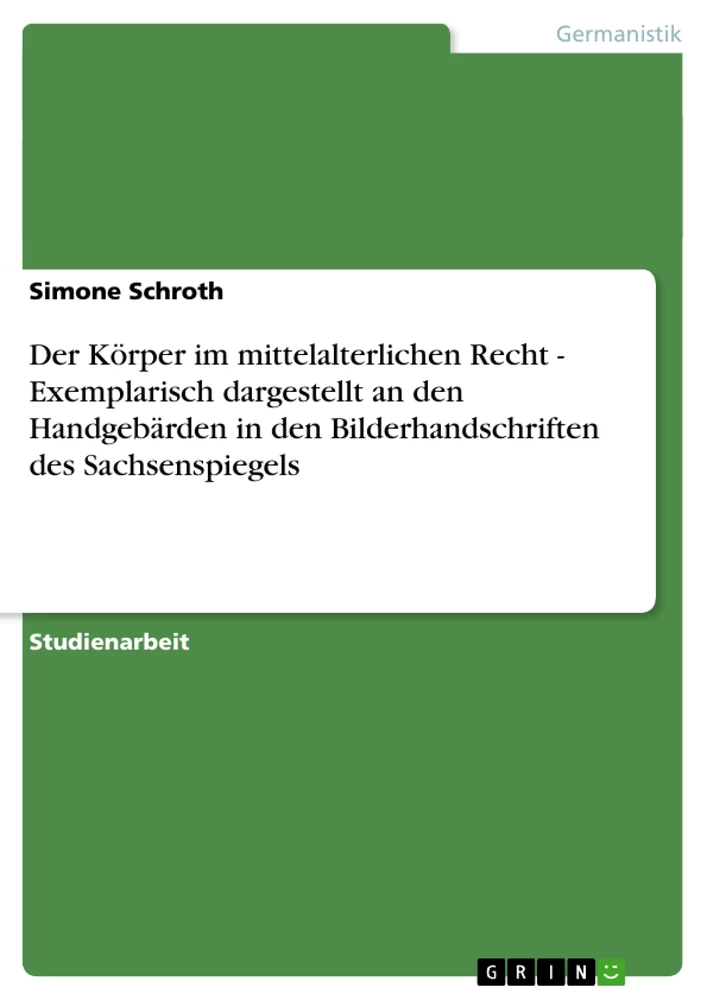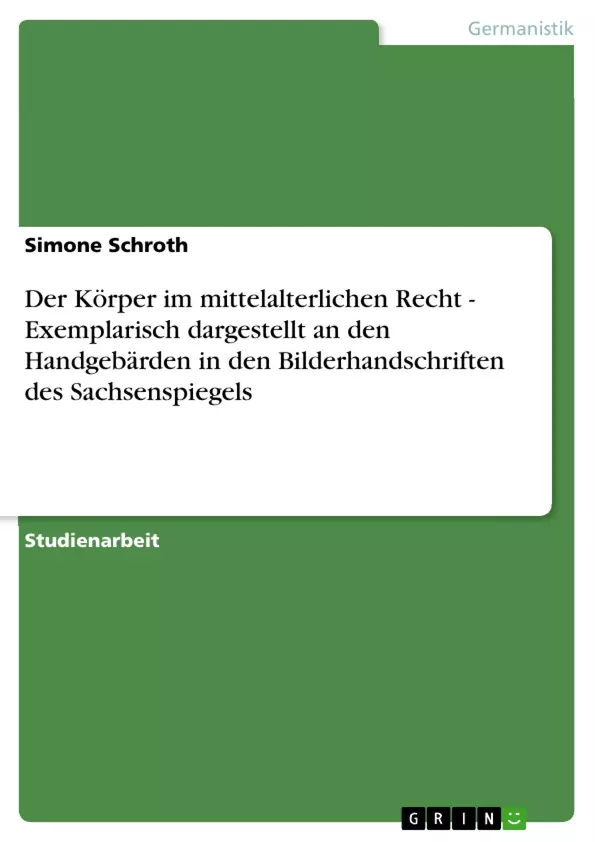Gebraucht man das Wort ,,Gebärde“ in heutiger Zeit, so meint man schlicht jene Bewegungen von Gesicht und Händen, durch die unbewußt oder bewußt Gefühle ausgedrückt werden. Anders war dies im Mittelalter. Damals umfaßte der Begriff viel mehr. Der althochdeutsche Begriff 'gibärida' ist eine Ableitung des germanischen 'gabärian', was soviel heißt wie ,sich traurig gebärden, rufen, klagen´. Der Begriff beschreibt damit das Benehmen, Aussehen und Wesen des Menschen; allgemein also seine Haltung, die stets Ausdruck des Innern ist.
Neben den Gebärden des Körpers, also z.B. der Hände, Finger oder Beine, gibt es die sogenannten Lautgebärden, die auch im Mittelalter schon klar von der geformten Sprache unterschieden worden sind. In einer Rechtsquelle von 1290 wird diese Unterscheidung ganz explizit angesprochen: Dort ist von "(...) gemachten worten und geberden" (Basel, 1290) die Rede. Mit dieser Aussage wird bereits die große Bedeutung der Gebärden für das mittelalterliche Recht angedeutet. Sie traten neben die gesprochenen Wörter und sollten den rechtlichen Vorgang bekräftigen, der erst durch sie auch gesehen werden konnte. Sie brachten eine bestimmte Haltung der Parteien zum Ausdruck, die deren Sitte und Herkommen entsprach.
Das Recht wird im Mittelalter häufig als Rechtshandlung betrieben. Im Sachsenspiegel des Eike von Repgow etwa wird der Begriff ,,recht“ fast immer im Zusammenhang mit Handlungen innerhalb des Gerichtsverfahrens, also mit Prozeßhandlungen benutzt, selten im Zusammenhang mit materiellem Recht. Derartige Rechtshandlungen kommen z.B. durch die Handgebärden im Lehensrecht zum Ausdruck. Durch das gegenseitige Reichen der Hände soll die Verbindung offensichtlich gemacht werden. Dabei sind meist Zeugen anwesend, die die Rechtsakte beobachten und damit eine lebende Erinnerung (living memory) aufrechterhalten.
Alles in allem läßt sich festhalten, daß die Gebärden im mittelalterlichen Recht auch deshalb eine so große Rolle spielten, da dieses viel stärker auf die beteiligten Personen, weniger auf die Rechtssache bezogen war. Die Person wurde grundsätzlich als genossenschaftliches Wesen angesehen, als Teil der Sippe; deshalb auch die Anwesenheit von Zeugen im Lehnverfahren, die die Gemeinschaft abbilden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung: Die Bedeutung der Körpergebärden im mittelalterlichen Recht
- II) Hauptteil: Die Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels
- II.1) Zur Einführung: Kurze Geschichte des Sachsenspiegels
- II.2) Übersicht über die Handgebärden in den Bilderhandschriften
- II.2.1) Die Redegebärden
- II.2.2) Hinweisende Gebärden
- II.2.3) Darstellende Gebärden
- III) Schlußbetrachtung: Gebärden heute - Rückzug oder Revival?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rolle von Körpergebärden im mittelalterlichen Recht, dargestellt anhand der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Das Ziel ist es, die Bedeutung von Handgesten im Kontext des Rechtsverständnisses des 13. Jahrhunderts aufzuzeigen und ihre Funktion innerhalb des Rechtsprozesses zu analysieren.
- Die Bedeutung von Körpergebärden im mittelalterlichen Recht
- Die Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels
- Die Verwendung von Gebärden im Zusammenhang mit Rechtshandlungen
- Der Sachsenspiegel als Quelle für die Rekonstruktion von Rechtspraktiken
- Der Vergleich von Gebärden im Mittelalter und heute
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Bedeutung von Körpergebärden im Mittelalter und deren umfassenden Bedeutungsgehalt dar. Sie erläutert die Unterscheidung von "Gebärden" und "geformter Sprache" im Kontext der damaligen Rechtsquellen und betont die Rolle von Gebärden als visuelle Ergänzung zu gesprochenen Worten, um rechtliche Handlungen zu bekräftigen und die Haltung der Beteiligten auszudrücken.
Der Hauptteil widmet sich den Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Hier wird zunächst eine kurze Geschichte des Sachsenspiegels erläutert, wobei auf seine Entstehung, seinen Inhalt und seine Bedeutung für das deutsche Recht eingegangen wird. Im Anschluss daran werden die Handgebärden in den Bildern des Sachsenspiegels systematisch vorgestellt und in verschiedene Kategorien eingeteilt.
Schlüsselwörter
Körpergebärden, mittelalterliches Recht, Sachsenspiegel, Bilderhandschriften, Rechtsgeschichte, Rechtshandlungen, Gebärdensprache, Rechtssprache, visuelle Kommunikation, Handgesten, living memory, Beweismittel, Rechtssystem, Strafrecht, Lehnrecht, Gerichtsverfahren
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatten Körpergebärden im mittelalterlichen Recht?
Gebärden waren essenziell, um rechtliche Vorgänge sichtbar und rechtskräftig zu machen. Sie ergänzten das gesprochene Wort und drückten die innere Haltung der Parteien aus.
Was ist der "Sachsenspiegel"?
Der Sachsenspiegel ist das bedeutendste Rechtsbuch des deutschen Mittelalters, verfasst von Eike von Repgow, das in seinen Bilderhandschriften Rechtsakte visuell darstellt.
Welche Arten von Handgebärden werden im Sachsenspiegel unterschieden?
Es wird zwischen Redegebärden (Sprechen), hinweisenden Gebärden (Zeigen) und darstellenden Gebärden (Rechtshandlungen wie das Handreichen beim Lehen) unterschieden.
Warum waren Zeugen im mittelalterlichen Recht so wichtig?
Da Recht oft als Handlung ("living memory") vollzogen wurde, dienten Zeugen als lebende Erinnerung an den sichtbaren Rechtsakt, da schriftliche Verträge weniger verbreitet waren.
Wie unterscheidet sich der mittelalterliche Begriff "Gebärde" von heute?
Heute meinen wir unbewusste Körpersprache. Im Mittelalter war die Gebärde (althochdeutsch 'gibärida') eine bewusste, formale Handlung, die Wesen und Status einer Person rechtlich definierte.
- Quote paper
- Simone Schroth (Author), 1999, Der Körper im mittelalterlichen Recht - Exemplarisch dargestellt an den Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9647