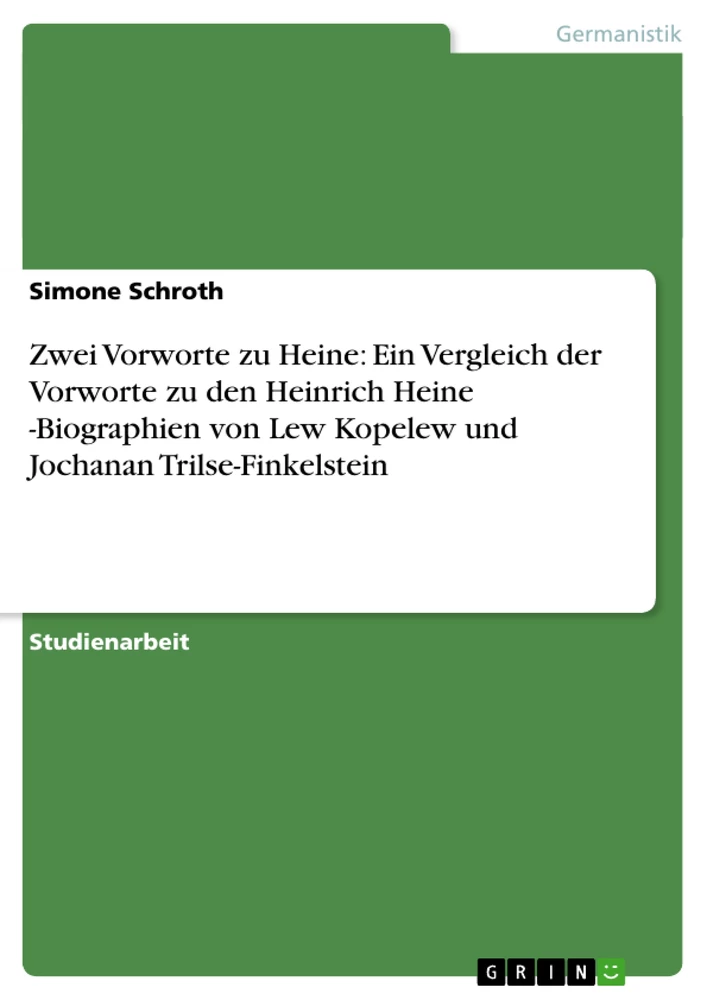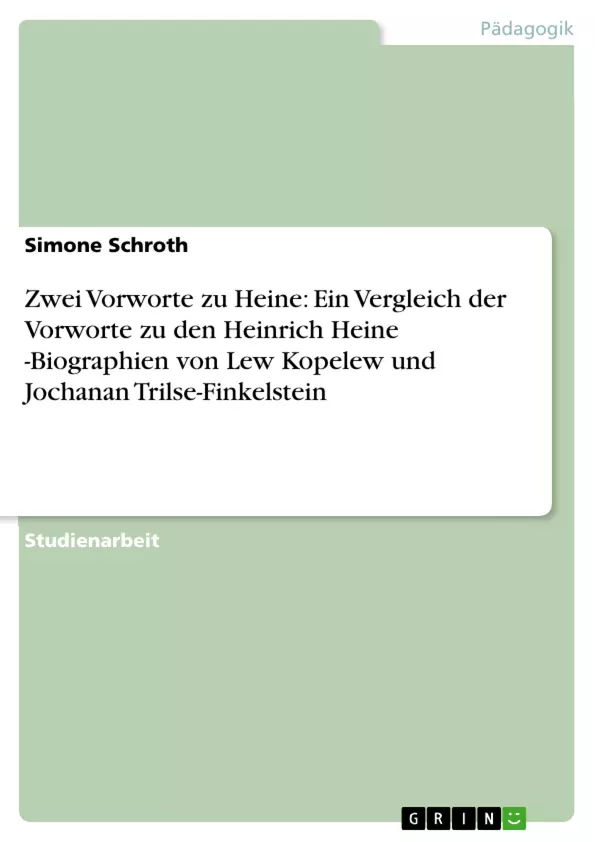Beschäftigt man sich im Rahmen der Germanistik mit Vorworten als Textsorte, stellt man schnell fest, daß es praktisch keine wissenschaftliche Sekundärliteratur zu diesem Thema gibt. Dabei können Vorworte bereits derart viel über das nachfolgende Werk, die Biographie des Autors und seine Intentionen aussagen, daß schon Ludwig Börne bezüglich der Vorworte seines ,,feindlichen Bruders“ Heinrich Heine, wenn auch spöttisch, anmerkte, daß dessen Vorworte oft besser seien, als die nachfolgenden Werke. Diese Worte Börnes entstanden, als Vorworte als Textsorte geradezu ihre ,,Hoch-Zeit“ erlebten, im 19. Jahrhundert. Heute dagegen sind sie als literarische Textsorte aus der Mode gekommen, besonders im Zusammenhang mit fiktionalen Texten. Dort existieren mittlerweile Vorworte und Einleitungen, Pro- und Epiloge, Waschzettel und Klappentexte nebeneinander. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine klare Abgrenzung zwischen diesen Textsorten zu treffen.
Das Vorwort ist eine eröffnende Vorrede zu einem Buch, welche über Entstehung, Sinn und Zweck des Werkes berichtet. Es ist meistens vom Autor selbst verfaßt worden und spricht den Leser direkt an. Oft, gerade auch bei Heine und Börne, enthält das Vorwort auch eine Rechtfertigung des Verfassers und Erwiderungen auf frühere Kritiken z.B. von Kollegen.
Ein Klappentext dagegen ist der auf die Klappen des Schutzumschlages gedruckte Einführungstext über das Buch, der vom Verlag verfaßt wird und neben der Information vor allem Werbezwecken dient. Auch der Waschzettel wird vom Verlag verfaßt. Es ist der den Besprechungsexemplaren beigelegte Zettel mit Inhaltsangabe, Charakteristik des Buches und sonstigem wissenswerten Material für den Rezensenten.
Pro- und Epilog dagegen sind ein typisches Dramenphänomen. Der Prolog ist dabei eine kurze Einleitung in das Dramengeschehen, durch welche die Personen und Handlungen vorgestellt werden. Der Epilog dagegen bildet die Schlußrede eines Theaterstückes, die sich, oft belehrend, an die Zuschauer richtet und im modernen Drama eine satirisch-parodistische Funktion hat.
Inhaltsverzeichnis
- I) Einleitung
- I.1) Vorworte im Blickfeld der Germanistik – eine Abgrenzung
- I.2) Vorworte im didaktischen Zusammenhang – eine kurze Einführung
- II) Hauptteil
- II.1) Über die Autoren
- II.1.1) Über Lew Kopelew
- II.1.2) Über Jochanan Trilse-Finkelstein
- II.2) Inhaltliche Zusammenfassung der Vorworte
- II.2.1) Das Vorwort Kopelews
- II.2.2) Die Vorrede Trilse-Finkelsteins
- II.3) Ein Thema - zwei Werke: Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Vorworte
- II.1) Über die Autoren
- III) Schlußteil: Wie gelingt die didaktische Vermittlung - ein Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vorworte zu den Heinrich Heine-Biographien von Lew Kopelew und Jochanan Trilse-Finkelstein. Ziel ist es, die Inhalte und Hintergründe der beiden Vorworte sowie die Schreibintentionen der Autoren zu ermitteln. Darüber hinaus soll untersucht werden, wie die Vorworte im didaktischen Zusammenhang eingesetzt werden können.
- Die Abgrenzung der Vorwort-Textsorte zu anderen Textsorten
- Die Funktion von Vorworten im didaktischen Kontext
- Die Biographien der Autoren Lew Kopelew und Jochanan Trilse-Finkelstein
- Die Analyse der Inhalte und Schreibintentionen in den beiden Vorworten
- Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Vorworte im Vergleich
Zusammenfassung der Kapitel
I) Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit der Abgrenzung der Textsorte „Vorwort“ von anderen einleitenden Textsorten. Dabei werden die Bedeutung und die Funktion von Vorworten in der Literatur und im didaktischen Kontext beleuchtet. Es wird argumentiert, dass Vorworte wichtige Einblicke in die Entstehung und Intention eines Werkes bieten können und daher im didaktischen Bereich besondere Bedeutung haben.
II) Hauptteil
Der Hauptteil der Arbeit widmet sich zunächst den Biographien der Autoren Lew Kopelew und Jochanan Trilse-Finkelstein. Im Anschluss daran werden die beiden Vorworte in Bezug auf ihren Inhalt und ihre Schreibintention analysiert. Der Schwerpunkt liegt auf dem Vergleich der beiden Vorworte, wobei die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Texte sowie ihre didaktische Funktion im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Vorwort, Heinrich Heine, Lew Kopelew, Jochanan Trilse-Finkelstein, Germanistik, Literaturdidaktik, Textsorte, Schreibintention, didaktische Funktion, Vergleich, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Funktion eines Vorworts in der Literatur?
Ein Vorwort ist eine eröffnende Vorrede, die über die Entstehung, den Sinn und den Zweck eines Werkes berichtet. Es spricht den Leser oft direkt an und enthält Rechtfertigungen oder Erläuterungen des Autors.
Wie unterscheidet sich ein Vorwort von einem Klappentext?
Ein Vorwort wird meist vom Autor selbst verfasst, während der Klappentext vom Verlag erstellt wird und primär werblichen Zwecken dient.
Welche Heine-Biographien werden in diesem Dokument verglichen?
Es werden die Vorworte der Biographien von Lew Kopelew und Jochanan Trilse-Finkelstein untersucht und hinsichtlich ihrer Schreibintentionen gegenübergestellt.
Warum sind Vorworte für die Literaturdidaktik wichtig?
Sie bieten Schülern und Studenten wichtige Einblicke in die Intention des Autors und den historischen Kontext eines Werkes, was die Analyse und Interpretation erleichtert.
Was bedeutet der Begriff „Waschzettel“ im Buchwesen?
Ein Waschzettel ist ein vom Verlag verfasster Begleitzettel für Rezensenten, der eine Inhaltsangabe und Charakteristik des Buches enthält.
- Quote paper
- Simone Schroth (Author), 1999, Zwei Vorworte zu Heine: Ein Vergleich der Vorworte zu den Heinrich Heine -Biographien von Lew Kopelew und Jochanan Trilse-Finkelstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9648