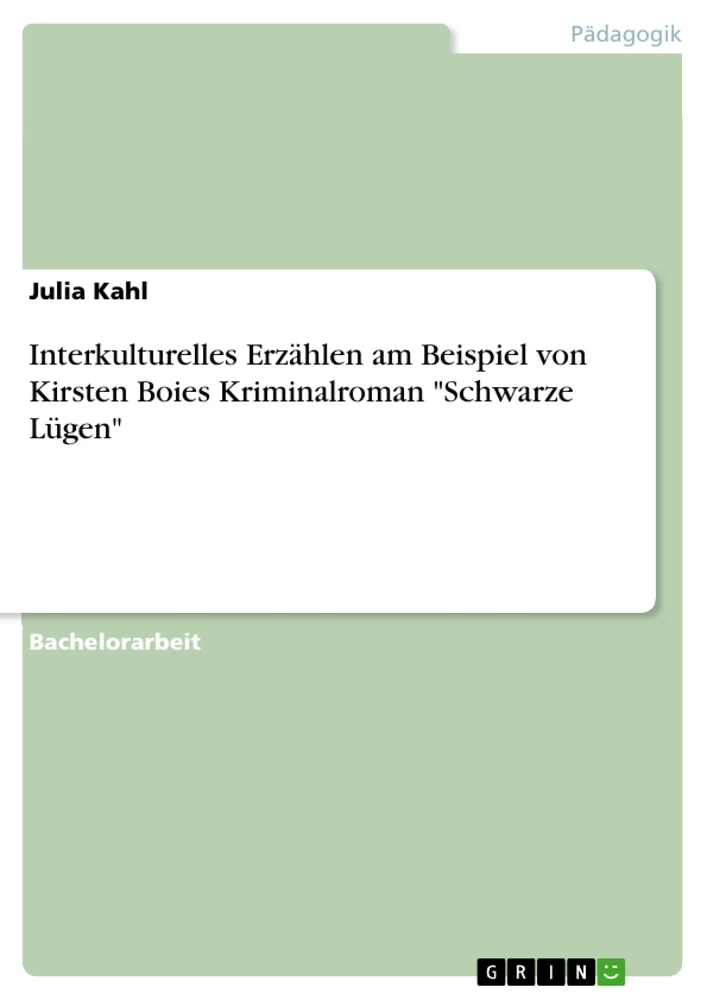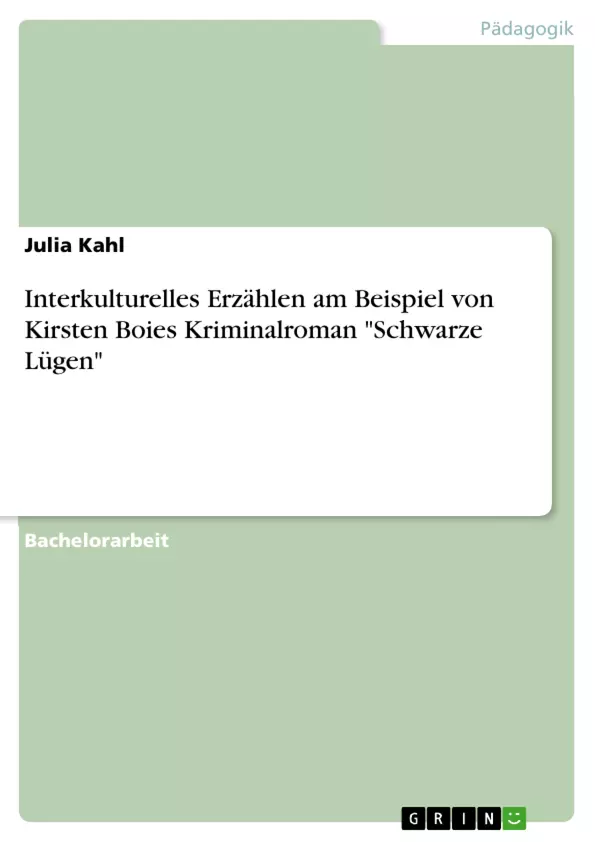In der Ausarbeitung soll es um interkulturelles Erzählen gehen, welches anhand von Kirsten Boies Roman „Schwarze Lügen“ erläutert wird. Kirsten Boie ist nicht nur eine bei Kindern beliebte Autorin, sondern auch in der Forschung für ihre Fähigkeit bekannt, gesellschaftliche und politische Strukturen in den Fokus zu nehmen und auf Veränderungen aufmerksam zu machen. Hierbei soll jedoch aufgrund von Umfangsmangel nur auf die für diese Thesis relevanten Forschungsergebnisse eingegangen werden. Das heißt, die im Folgenden genannten Forschungsergebnisse umfassen nicht das gesamte bisherige erforschte Spektrum in der Literaturwissenschaft, sondern das Kapitel begrenzt sich knapp auf relevante Aspekte, die in der darauffolgenden Analyse wieder aufgefasst werden.
Anschließend erfolgt die Analyse des vorliegenden Romans „Schwarze Lügen“ von Kirsten Boie. Diese wird in Anlehnung an Martínez und Scheffel nach inhaltlichen und stilistischen Aspekten separiert untersucht, wobei eine klare Trennung dieser beiden Bereiche natürlich nicht vollständig möglich ist. Hierbei liegt das besondere Augenmerk auf der inhaltlichen Analyse mit der Erforschung der Figurenkonzeption, da dieser Aspekt eine große Relevanz für die Vermittlung von Interkulturalität hat. Dadurch soll ausführlich gezeigt werden, welche Spezifik den Roman selbst und ihn als Vermittler von Interkulturalität auszeichnet. Abschließend erfolgt ein zusammenfassender Rückblick, welcher die gesammelten Forschungs- und Analyseergebnisse noch einmal betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Forschungsergebnisse
- Kinder- und Jugendliteratur
- Interkulturalität in der Literatur
- Romananalyse
- Entstehungsrahmen
- Die Art der Darstellung
- Zeit
- Modus
- Distanz
- Fokalisierung
- Stimme
- Handlung und erzählte Welt
- Handlung
- Erzählte Welt
- Figur
- Melody
- Kenneth
- Lukas
- Der Polizist Anatolij
- Kai-Hinrich Sönnichsen
- Weitere Figuren
- Raum
- Rückblickende Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Interkulturalität im Jugendroman „Schwarze Lügen“ von Kirsten Boie. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale der interkulturellen Erzählweise des Romans zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese zum Verständnis und zur Förderung von Interkulturalität beitragen.
- Die Bedeutung von Interkulturalität in der Kinder- und Jugendliteratur
- Die Rolle von Figuren und Handlung in der Vermittlung interkultureller Themen
- Die Darstellung verschiedener Kulturen und Perspektiven im Roman
- Der Einfluss des Romans auf das Verständnis von Diversität und Toleranz bei jungen Leserinnen und Lesern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Zielsetzung der Arbeit und definiert den Begriff der Interkulturalität. Es wird außerdem auf die Bedeutung der Interkulturalität in der heutigen Gesellschaft eingegangen.
Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über relevante Forschungsergebnisse zu Kinder- und Jugendliteratur und Interkulturalität in der Literatur.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Romananalyse von „Schwarze Lügen“ von Kirsten Boie. Es werden die Entstehungsgeschichte des Romans, die narrative Gestaltung sowie die zentralen Figuren und Handlungselemente beleuchtet. Besonderes Augenmerk liegt auf der Analyse der Figurenkonzeption, da diese für die Vermittlung von Interkulturalität eine wichtige Rolle spielt.
Schlüsselwörter
Interkulturalität, Kinder- und Jugendliteratur, Romananalyse, Kirsten Boie, „Schwarze Lügen“, Figurenkonzeption, narrative Gestaltung, Diversität, Toleranz.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Kirsten Boies Roman „Schwarze Lügen“?
Der Kriminalroman thematisiert Interkulturalität und Vorurteile anhand einer spannenden Handlung, die gesellschaftliche Strukturen kritisch beleuchtet.
Was bedeutet „interkulturelles Erzählen“?
Es beschreibt eine Erzählweise, die verschiedene kulturelle Perspektiven integriert und den Austausch sowie das Verständnis zwischen Kulturen fördert.
Warum ist die Figurenkonzeption im Roman so wichtig?
Durch Figuren wie Melody oder Kenneth werden unterschiedliche kulturelle Hintergründe lebendig, was jungen Lesern hilft, Diversität und Toleranz zu verstehen.
Welche Rolle spielt Kirsten Boie in der Kinderliteratur?
Boie ist bekannt dafür, aktuelle politische und soziale Veränderungen kindgerecht und literarisch anspruchsvoll in ihren Werken zu verarbeiten.
Wie wird Interkulturalität im Roman vermittelt?
Die Vermittlung erfolgt sowohl über die inhaltliche Handlung als auch über stilistische Mittel wie die Fokalisierung und verschiedene Erzählerstimmen.
- Citation du texte
- Julia Kahl (Auteur), 2016, Interkulturelles Erzählen am Beispiel von Kirsten Boies Kriminalroman "Schwarze Lügen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/965212