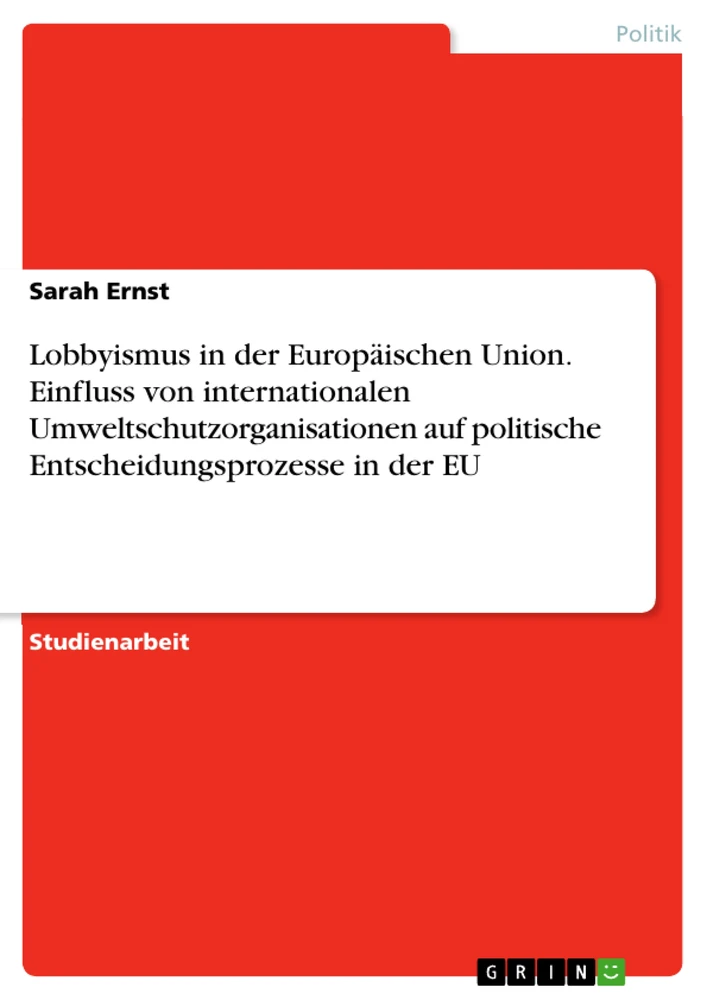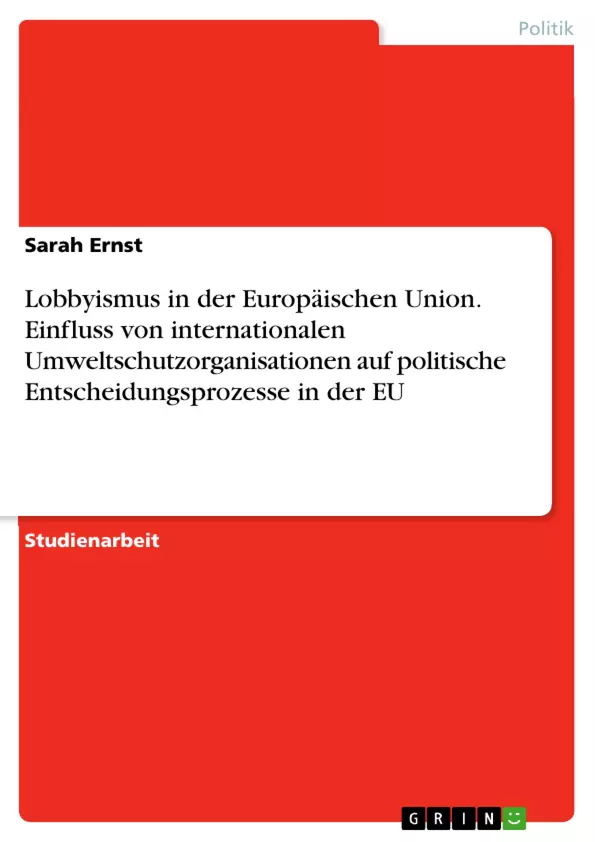In dieser Hausarbeit soll ein Verständnis für europäische Interessenvermittlung und ihre Rolle in der europäischen Politik anhand der Beispiele der europäischen Umweltpolitik und dem Einfluss internationaler Umweltschutzorganisationen wie der "Friends of the Earth Europe" aufgebaut werden. Einige EU-politische Institutionen werden exemplarisch für die Einbettung von Interessenvermittlungsaktivitäten dargestellt und in einen Bezug gesetzt. Schließlich wird der größere Kontext anhand der Fragestellung "Wie hat die Umweltschutzorganisation 'Friends of the Earth Europe' in 2019 Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union genommen?" und der Verbindung von Lobbyismus und der EU-Politik erschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Ziele, Methodik und Forschungsfragen
- Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Europäische Union und ihre Institutionen
- Friends of the Earth Europe
- Lobbying
- Zusammenhänge und Einflussnahme
- Europäische Umweltpolitik
- Lobbyismus in der EU am Beispiel der FoEE
- EU-Lobbying – Risiken und Möglichkeiten
- Schlussbetrachtung
- Zusammenfassung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Einfluss internationaler Umweltschutzorganisationen auf politische Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union. Sie analysiert die Rolle des Lobbyismus in der europäischen Politik am Beispiel der Friends of the Earth Europe (FoEE) und untersucht deren Einflussnahme auf die europäische Umweltpolitik.
- Die Bedeutung von Lobbyismus in der europäischen Politik
- Die Struktur und Funktionsweise der Europäischen Union und ihrer Institutionen
- Die Arbeitsweise und Einflussnahme der Friends of the Earth Europe auf EU-Entscheidungen
- Risiken und Chancen des Lobbyismus in der Europäischen Union
- Die Rolle internationaler Umweltschutzorganisationen in der europäischen Umweltpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel dieser Hausarbeit stellt die Problemstellung dar und erläutert die Ziele, die Methodik und die Forschungsfragen. Es wird die Relevanz des Lobbyismus in der europäischen Politik aufgezeigt und der Fokus auf die Rolle internationaler Umweltschutzorganisationen gelegt.
Kapitel Zwei befasst sich mit den theoretischen Grundlagen. Es werden die Europäische Union und ihre Institutionen vorgestellt, sowie die Funktionsweise des Lobbyismus erläutert. Außerdem wird die Friends of the Earth Europe als Beispiel für eine europaweite Umweltschutzorganisation näher beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert die Zusammenhänge zwischen europäischer Umweltpolitik und den Lobbyismus-Maßnahmen der Friends of the Earth Europe. Es wird untersucht, wie die Organisation Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse nimmt und welche Risiken und Möglichkeiten sich daraus ergeben.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Umweltpolitik, Lobbyismus, Interessenvermittlung, Friends of the Earth Europe, EU-Institutionen, politische Entscheidungsprozesse, internationale Umweltschutzorganisationen, Risiken und Möglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Lobbyismus in der EU?
Lobbyismus dient der Interessenvermittlung, um politische Entscheidungsprozesse in den EU-Institutionen im Sinne einer Organisation zu beeinflussen.
Welche Rolle spielt "Friends of the Earth Europe" (FoEE)?
Die FoEE ist eine internationale Umweltschutzorganisation, die aktiv versucht, die europäische Umweltpolitik durch Lobbyarbeit mitzugestalten.
Gibt es Risiken beim Lobbyismus in der EU?
Ja, die Arbeit diskutiert Risiken wie mangelnde Transparenz oder die ungleiche Machtverteilung zwischen finanzstarken Konzernen und zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Wie nehmen Umweltschutzorganisationen konkret Einfluss?
Dies geschieht durch die Einbettung in Interessenvermittlungsaktivitäten bei Institutionen wie der EU-Kommission oder dem Parlament, oft am Beispiel konkreter Gesetzesinitiativen.
Wie hängen Umweltpolitik und Lobbyismus zusammen?
Da viele Umweltstandards auf EU-Ebene festgelegt werden, ist die Einflussnahme vor Ort entscheidend für den Erfolg internationaler Umweltziele.
- Arbeit zitieren
- Sarah Ernst (Autor:in), 2020, Lobbyismus in der Europäischen Union. Einfluss von internationalen Umweltschutzorganisationen auf politische Entscheidungsprozesse in der EU, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/965433