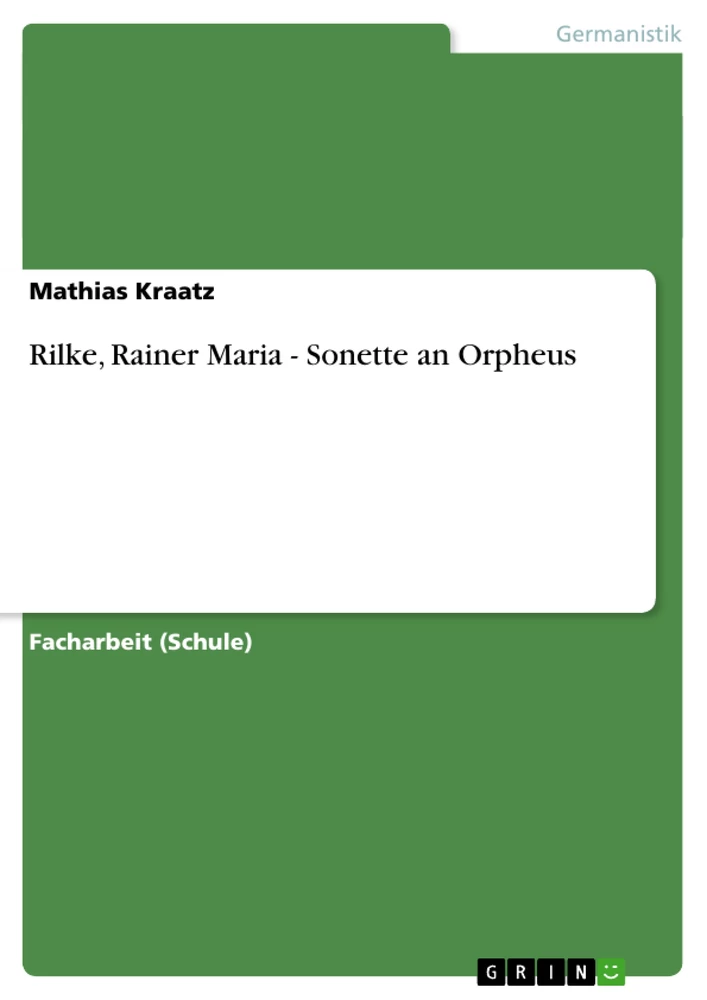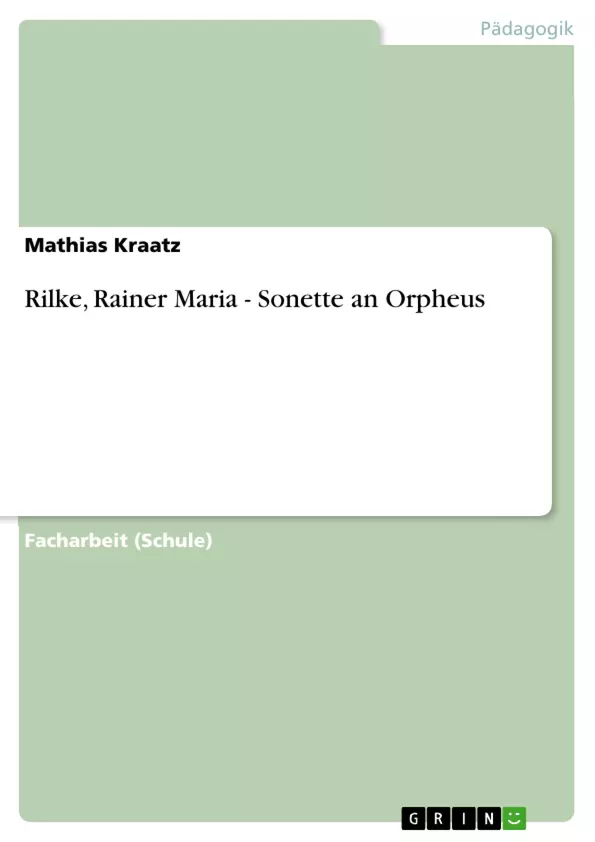Was bedeutet es, wenn ein Dichter sich selbst zum Mythos erhebt? Tauchen Sie ein in die tiefgründige Welt von Rainer Maria Rilkes "Sonette an Orpheus", einer Sammlung, die nicht nur Gedichte sind, sondern eine spirituelle Reise. Diese Arbeit analysiert die ersten drei Sonette des ersten Teils, um die zentralen Kontraste von Kunst und Wirklichkeit, Tod und Leben, Leben und Kunst zu ergründen. Rilke entwirft Orpheus als Figur, die Tod und Leben vereint und somit den Dichter selbst als Schöpfer einer neuen Mythologie positioniert. Der Band erörtert Rilkes Gottesbegriff im Kontext des Orpheus-Mythos, wobei der antike Sänger zum Sinnbild dichterischer Ekstase und religiöser Offenbarung wird. Die Analyse der Form, des Rhythmus und der Klanggestaltung der Sonette offenbart Rilkes innovative Sprachkunst, die Grenzen der Alltagserfahrung überschreitet und eine eigene Welt erschafft. Im Fokus steht auch die Widmung an die Tänzerin Wera Ouckama Knoop, deren Tod Rilke tief bewegte und die in den Sonetten eine mythologische Gestalt annimmt. Der Text beleuchtet, wie Rilke durch die Figur des Orpheus die Bedingungen künstlerischer Produktion als Askese darstellt und gleichzeitig eine Kritik am Christentum formuliert. Die Sonette werden als Ausdruck einer Kunstreligion interpretiert, die Exklusivität beansprucht und den Dichter als Schöpfer und Erneuerer der Welt sieht. Entdecken Sie die revolutionäre Kraft von Rilkes Lyrik, die den Leser einlädt, über die Grenzen des Sichtbaren hinauszublicken und die Einheit von Leben und Tod in der Kunst zu erkennen. Lassen Sie sich von der Poesie eines Weltinnenraums verzaubern, in dem die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares zur höchsten Aufgabe des Dichters wird. Schlüsselwörter: Rilke, Sonette an Orpheus, Orpheus, Mythos, Dichtung, Lyrik, Tod, Leben, Kunst, Religion, Gottesbegriff, Analyse, Interpretation, Weltinnenraum, Transformation, Ekstase, Askese, Sprachkunst, Metamorphose, Rainer Maria Rilke, Duineser Elegien, Moderne, Symbolismus, deutsche Literatur, Gedichtanalyse, Werkinterpretation, Literaturwissenschaft, Wera Ouckama Knoop, Elegie, Sonett, Gedichtband, Lyrikband, Rhythmusanalyse, Klanggestaltung, Sprachphilosophie, Kunstphilosophie, deutsche Lyrik, 20. Jahrhundert, Literaturrecherche, Germanistik, Literaturkanon, Weltliteratur, Dichterphilosophie, Leserfahrung, Gedichtinterpretation, Germanistikstudium, Literaturkreis, Poesie, Versepos, Verskunst.
INHALT:
Einleitung
Die Sonette an Orpheus. Anfangsgründe.
Die Gestalt der "Sonette an Orpheus"
Das zweite Sonett. Entfaltung des Orphismus.
Das dritte Sonett. Implikationen und Explikation.
Exkurs: Rilkes "Gott"
Einleitung
Orpheus nur als Chiffre eines dichterischen Wandelns in der Welt zu be- greifen, hieße, ihn sich als rilkeschen Gott des dichterischen Wandels von Wirklichkeit entgehen zu lassen. In excelsa gehoben, wird die Kunst zur religiösen Offenbarung, der Künstler zu ihrem Propheten und zum Propheten seiner eigenen Urheberschaft. Die Unangreifbarkeit dieser in Sensibilität und Verletzlichkeit gehüllten Anmaßung wird durch die Rezeptionsgeschichte weitgehend bestätigt.
Rilkes im Sonett II/27 bang erhobene Frage nach der Wirklichkeit der "zerstörenden Zeit" zu bejahen, hieße nicht nur, sie sich als "Form der Anschauung" im Sinne Kants zu bewahren, noch auch, Rilkes Gottesvor- stellung mit dem Hinweis auf die Historizität allen Nachdenkens über den judenchristlichen Gott der Geschichte zu relativieren. Die Geschichtlichkeit des Dichters Rilke selbst erlaubt, ihn wenigstens zu sich selbst ins Verhältnis zu setzen und damit - entgegen seinen eigenen und einigen im Seminar erhobenen Einwänden - die "Sonette" anhand früherer Dichtungen interpretatorisch zu begleiten.
Im Vordergrund stehen dabei, durch die Seminarplanung und den naturgemäß begrenzten Umfang einer Seminararbeit bedingt, die ersten drei Sonette des ersten Teils. Deren Kontrastpunkten Kunst und Wirklichkeit - Tod und Leben
- Leben und Kunst sucht sich vorliegende Arbeit zu nähern.
Die Sonette an Orpheus. Anfangsgründe.
In Muzot glaubte Rilke den Ort gefunden zu haben, an dem er seine Elegien zum Abschluß bringen könne. Baladine Klossowska alias Merline hatte ihm seit Juli 1921 beim Einrichten der Wohnung geholfen. Als sie am 8. November in Richtung Berlin abreist, hinterläßt sie die Reproduktion einer Federzeichnung, die Orpheus zeigt, wie er sitzend an einem Baum lehnt und singend eine Fiedel bedient. Um ihn herum vereinen sich andächtig lauschend ein Vogel, zwei Hasen und ein Reh. Dieses Ambiente schafft die Kulisse des ersten Sonettes. Allerdings sprengt das Gedicht auch das Bild und es übersteigt den klassischen Mythos, wonach Orpheus' Gesang Tiere und Pflanzen bewegt hatte.1 Zwei zentrale Gedanken, die sich im gesamten Zyklus manifestieren werden, sind hier schon angedeutet. Der Baum verwandelt sich durch Orpheus' Gesang zu Gehörtem, er kommt "ins Ohr". Die Tiere empfangen den Gesang nicht in der "hüttenhaften" Niedrigkeit des Verlangens, sondern in einer "tempelhaften" Stille des Hörens.
Der erste Teil der "Sonette an Orpheus" wurde im wesentlichen zwi schen dem 2. und 5. Februar 1922 vollendet. "Frühling ist wiedergekommen" (I,21) und "O erst dann, wenn der Flug" (I,23) wurden erst einige Tage später von Rilke eingesetzt, wie auch eine zweite Fassung von "Rühmen, das ist's" (I,7).2 Ein gewissermaßen poetologischer Boden der Sonette ist der Gedanke eines Weltinnenraumes. Binnen einer Woche wird Rilke ihn in der 7.Elegie erneut niederschreiben:
"Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen. Unser Leben geht hin mit Verwandlung, Und immer geringer schwindet das Außen." Anders jedoch als in der Elegie, wo dem Engel gegenüber bekannt wird: "Mein Atem reicht für die Rühmung nicht aus", jauchzt das 7.Sonett: "Rühmen, das ist's!" Im rühmenden Gesang wird die sichtbare Welt vergegenwärtigt, in eine Wirklichkeit verwandelt, die mehr sein will als das Sichtbare.
Die Tote des antiken Orpheus'ist Eurydike. Die in den Sonetten verwirklichte Tote ist die in der Widmung genannte Tänzerin Wera Ouckama Knoop. Rilke hatte sie schon als 16-Jährige in der Münchener Boheme während der letzten Kriegsjahre kennengelernt, und verkehrte als ihr "väterlicher Freund"3 auch mit der Familie Knoop. Sie starb 19-jährig an Leukämie. Die Tatsache und der Verlauf ihres Sterbens haben Rilke offensichtlich tief beeindruckt. Noch 1923 schreibt er in einem Brief:
"Dieses schöne Kind, das erst zu tanzen anfing und, bei allen, die sie damals sahen, Aufsehen erregte ,durch die ihrem Körper und Gemüt eingegebene Kunst der Bewegung und Wandlung,- erklärte ihrer Mutter unvermutet, daß sie nicht länger tanzen könne oder wolle In der Zeit, die ihr noch blieb, trieb Wera Musik, schließlich zeichnete sie nur noch-; als ob sich der versagte Tanz immer leiser, immer diskreter noch aus ihr ausgäbe."4
Die an Leib und Seele wahrgenommene Kunst der Wandlung ist natürlich vordergründig Ausdrucksmittel der Tänzerin, die in ihren Figuren lebendige Wirklichkeit nicht schlechthin abbildet, sondern gestaltet. Ihre Körpersprache ist das Äquivalent zur Wirklichkeit schöpfenden Sprache des Dichters. Diese Wirklichkeit ist die des Mythos, die Sonette "stellen den objektiven Mythos dessen dar, was den jungen Rilke als subjektives Gefühl erfüllt".5 Hintergründig jedoch ist Wera selbst "mythologische Figur. Als Tanzende ist sie orphisch bewegt."6 Als junges Mädchen auf dem Höhepunkt des Fühlens und Lebens, gehört sie auch der "uns abgekehrten, von uns unbeschienenen Seite des Lebens"7 an, denn sie ist - tot. Orpheus ist der rühmende, Tod und Leben mischende Sänger und als solcher auch ein Entwurf des sich selbst zum Mythos erhebenden Dichters.
Es liegt nahe, diesen Entwurf aus einer aufgeklärten Perspektive heraus zu kritisieren, entspricht doch das Verhältnis des Menschen Rilke zum "Dichter als solchem" in etwa dem der Dichtung zum Leben. Wenn Rilke über die "Elegien" schreibt: "... ach auch hier -, steht Leben und Kunst irgendwie im Widerspruch "8, so resultiert dieser Widerspruch nicht zuletzt aus der fruchtbaren sprachlichen Distanz der "Sonette" und "Elegien" zur Alltagssprache. Paradoxerweise ermöglicht erst diese Distanz die Aufhebung der Grenzen zwischen Vergangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigen, zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Der Dichter ist eine "Biene des Unsichtbaren"9, er trägt "leidenschaftlich den Honig des Sichtbaren" ein, um ihn im "Bienenstock des Unsichtbaren" anzuhäufen. Allein im Engel der Elegien erscheint "die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, die wir leisten, schon vollzogen".10
Es frappiert, daß gerade diese zu leistende Grenzüberschreitung in einer neuerlichen Diskussion über die Bedingungen von Aufklärung und De- mokratie aktuell geworden ist.11 Wolfgang Ullmann, Kirchenhistoriker und Abgeordneter des Europäischen Parlaments, beschreibt die gesellschaftlichen Konsequenzen einer positivistischen, anschauungsverhafteten Wirklichkeitswahrnehmung. Der durch sie motivierte Versuch, das komplexe System einer Gesellschaft durch das Steuerungsmonopol eines einzigen Subjektes zu dirigieren, ist bekanntlich in der DDR gescheitert. Doch auch die heute die Regel bildende technokratische Instrumentalisierung und Ausbeutung birgt die Gefahr einer chaotischen Entwicklung, die in irreversibel gewordener Umweltzerstörung ihren deutlichen Ausdruck gewonnen hat. Gegen eine positivistische Weltsicht sei daher eine "Raumwahrnehmung jenseits der Anschauung" zu etablieren, auf der die Freiheit als Freiheit der Erkenntnis beruhe. Ein neues Verständnis des "Ganzen der Gesellschaft" gewinne daraus die Einsicht von "Zukunft als Selbstorganisation". Letztlich müßte ein auf das Sichtbare fixierter Mathematiker an der Differentialrechnung ebenso scheitern wi e ein Kind bei dem Versuch, die räumliche Ordnung eines 3D - Bildes durch Betrachtung seiner chaotischen Oberfläche wahrzunehmen.
Die Gestalt der "Sonette an Orpheus"
Die "Sonette an Orpheus" bestehen aus zwei Teilen von je sechsundzwanzig bzw. neunundzwanzig Sonetten.12 Die Einheit der fünfundfünfzig Sonette ist nicht formal (wie etwa bei Sonettenkränzen durch wiederholte Zeilen und Reime), sondern inhaltlich bestimmt. Alle ihre Themen und Motive, die sich aufeinander beziehen oder voneinander abgrenzen, stehen unter dem Hauptthema, der Einheit des Lebens und des Todes, die in Orpheus verwirklicht wird. Verwirklichung "in Orpheus" meint, daß "die dichterische Existenz in eine Art göttliche Ekstasis erhöht [wird], die, indem sie das Sein um das Bewußtsein ergänzt und das Bewußtsein um das Sein, sich widerstandslos hineinhält in das widersprüchliche Dasein".13
Rhythmische und inhaltliche Verbindungen bestehen zwischen benachbarten Sonetten, werden aber auch über größere Distanzen zueinander realisiert. So thematisieren I/1,2,3 (in jambischem Maß) den orphischen Gesang, I/5,6,7 die Gestalt des Orpheus, I/13,14,15 die Früchte und ihre Wandlung im Erfahren, II/5,6,7 die Blumen, II,12,13 das Wandeln selbst. Das Verhältnis von Orpheus zum tanzenden Mädchen bildet durch I/1,2 und I/25,26 den thematischen Rahmen des ersten Zyklus. Der zweite Zyklus beginnt mit der Anrufung des Atmens und endet mit der Aufforderung "fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt...".
Anders als etwa in den "Neuen Gedichten", bei denen Rilke "sich bemühte, den Arbeitscharakter des Gedichts wieder zum Verschwinden zu bringen, indem er das Sonettschema durch besonders viele Enjambements vergessen ließ"14, sind die Strophen in den "Sonetten an Orpheus" in höherem Maße eigenständig und geschlossen. Der Einschnitt zwischen den Quartetten und den Terzetten entspricht vielfach dem Umschlagmoment, das aber häufig auch erst im zweiten Terzett auftritt. Oft wird der Umschlag mit "aber", "doch", "dann", "da" oder "sondern" eingeleitet, kann aber auch, wie etwa in I/19 mit einer pointierten Schlußwendung realisiert werden: "Einzig das Lied überm Land/heiligt und feiert." Dem Lied gelingt die Synthese einer Einheit von Leben und Tod, Vollendetem und sich Wandelndem, die dem Menschen, der "nicht...erkannt, nicht...gelernt" hat, unerreichbar ist. Das Sonett II/14 realisiert den Umschlag zwischen Quartetten und Terzetten durch den Wechsel vom Indikativ zum Konjunktiv. Der Indikativ beschreibt den Gegensatz zwischen den Dingen, die "schweben" wollen, exemplarisch den Blumen, die diesseitsbezogen, "dem Irdischen" treu sind und dem Menschen, der sie mit einem Schicksal gleichermaßen beschwert. Der konditional gebrauchte Konjunktiv setzt die Dinge und den Menschen in ein mögliches Verhältnis, dessen Verwirklichung jedoch aussteht.
Trotz insgesamt sehr variantenreicher Reimschemata zeigen die Oktaven überwiegend den alternierend-vierreimigen Bau abab/cdcd. Lediglich die Sonette I/2,3,14,16 sind vierreimig umschlingend. Je acht Sonette des ersten und des zweiten Teils kombinieren ein umschlingendes mit einem al- ternierenden Quartett. I/4 und I/17 alternieren zweireimig, II/17 exponiert sich mit einem paarend reimenden Quartett. Die Mehrzahl der Terzettreime folgt dem dreireimigen Schema efg/efg, eef/ggf oder efe/gfg. Lediglich II/26 folgt dem zweireimigen Schema eff/efe.
Dem überwiegend alternierenden Reimschema entspricht die Alternanz der Reimendungen. Nur das Sonett I/24 ist durchgängig weiblich, nur die Sonette I/20 und II/4,5 sind durchgängig männlich.
Viele Reimwörter stehen zueinander in einem positiven oder negativen inhaltlichen Bezug. So evoziert etwa der Gleichklang einen Gleichsinn: "hob""Lob"(I/9), "Erstarrte"-"Harte"(II/12), "Pelz"-"Gelds"(II/19). Der Gleichklang verbindet Gegensätze wi e "Erz"-"Herz"(I/25), "Steins"-"Weins"(II/22), "zerstört"-"erhört"(II/24).
Die rhythmische Gestalt der Sonette entzieht sich am ehesten der klassischen Sonettform. Dieser Umstand läßt Holthusen im Rhythmus den "entscheidenden sonettwidrigen Faktor"15 sehen. Tatsächlich sind nur acht Sonette fünfhebig jambisch (I/1,2,3,5,14,II/4,15,28), acht Sonette fünfhebig trochäisch (I/8,11,12,13,II/5,16,23,29) Die übrigen neununddreißig Sonette sind daktylisch rhythmisiert. Die beiden Teile der "Sonette an Orpheus" unterscheiden sich rhythmisch auffällig voneinander. Im ersten Teil überwiegen zwei- bis vierfüßige Verse, der zweite Teil wird durch vier- bis sechshebige Verse dominiert. Doch nicht nur die Zeilenlänge, auch die Zeilenvarianz innerhalb eines Sonettes ist im zweiten Teil stärker ausgeprägt. Unübertroffen in seiner rhythmischen Freiheit ist das Sonett II/1: der einhebige Daktylus "Raumgewinn" hat in ihm ebenso Platz wie der sich dem Daktylus widersetzende Siebenheber: "Erkennst du mich, Luft, du, voll noch einst meiniger Orte?"
Die erhöhte Frequenz fünf- und sechshebiger Daktylen im zweiten Teil legt die Vermutung nahe, daß die zeitgleich entstehenden "Duineser Elegien" rhythmisch in die "Sonette" hinüberwirken. Deren metrische Form sind im Distichon sich vereinigende Pentameter und Hexameter. Der elegischer werdende Ton geht einher mit einer Veränderung der Aussage. Während den jambischen und trochäischen Sonetten des ersten Teils ein "ruhigerer, erklärenderer, Spannungen kontemplativer behandelnder Ton eigen" ist, zeigen die daktylischen Gedichte eine "ungeheure rhythmische und inhaltliche Spannweite".16 Sie realisieren Erregung und Bedrohung: "Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte./Wehe-:abwesender Hammer holt aus!"(II/12), Trauer: "Alles ist weit-, und nirgends schließt sich der Kreis."(II/20), aber auch hymnische Feierlichkeit und Freude: "Singe die Gärten, mein Herz...///singe sie selig, preise sie keinem vergleichbar."(II,21), ...singender steige,/preisender steige zurück in den reinen Bezug"(II,13).
Mit besonderer Deutlichkeit zeigt das Sonett I/4, wie Rilke auch die Lautgebung nutzt, um die Wirkung der Aussage zu unterstützen. Alle acht Zeilen der Quartette werden vom diphtongischen Reimvokal "ei" dominiert. Die Eigenart dieses Zwielautes, im Munde des Sprechenden aus zwei Vokalen zu einer Einheit zu werden, widerspiegelt das Bild des Atems, der sich an den "Wangen der Zärtlichen" teilt -denn er "meint" sie nicht- um sich "hinter" ihnen -zitternd bewegt- wieder mit sich selbst zu vereinen. Die Harmonie der Gegensätze, die sich im Gleichklang des "ei" hörbar macht, erlaubt es den "Seligen" und "Heilen", sich Anfang und Ende gleichermaßen zugehörig zu wissen, zugleich "Bogen" und Ziele von Pfeilen" zu sein. Wo für die Seligen lediglich die Kausalität suspendiert wird, vermag Orpheus die Grenze zwischen chthonisch-Göttlichem und hiesig-Menschlichem zu überwinden. Das erste Quartett von I/6 bevorzugt für die Vertonung dieses Vorganges die Laute "ei" und "u". Das "ei" vermittelt zwischen dem mit zwei "i"-Lauten hoch- tönenden "Hiesigen" und dem dunklen, unteren "Reich", in dem und für das die "Wurzeln" stehen. Die "Zweige der Weiden" sind im Hiesigen sichtbar, verweisen aber auf einen Bereich, der menschlicher Erfahrung schlechthin vorenthalten ist. Allein Orpheus, der in der Unterwelt Kundige, vermag die Spannweite der sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit zu durchmessen.
Es bedarf keines Beweises, daß der Dichter, der Orpheus besingt, an der orphischen Bewegtheit Anteil zu haben beansprucht. Ihm obliegt es, durch Dichtung die Erfahrung zu intensivieren. Durch Neologismen wie etwa "mädchenhändig" (I/8), "sternisch" (I/11), "torig" (II/9) "säglich" (II/19) oder ungewöhnliche Wortzusammensetzungen wie "Herzwege" (I/3), "Blumenmuskel", "Wiesenmorgen", "Ruhewink" (II,5) werden die Grenzen der in der Alltagssprache gegebenen Erfahrung kunstvoll überschritten. In der Form des Sonettes begründet ist die Nötigung zur sprachlichen und gedanklichen Verdichtung. Die "Sonette an Orpheus" realisieren ihre Form im Gebrauch der Nomina. Besonders Adjektiven und Verben wird durch Substantivierung ein höheres Abstraktionsniveau verliehen. Zu nennen wären Bildungen mit -ung (Verschweigung, Übersteigung, Rühmung), substantivierte Infinitive (das Staunen, Gehorchen, Bleiben; der Wager, Vermöger, Verkündiger), substantivierte Partizipien der Gegenwart und Vergangenheit (der Beschwörende, das Zerstörende, das Verweilende; das Geschaute, die Gewagten, die Entwandte), substantivierte Adjektive, die auf Verben zurückgehen (das Vergängliche, Zerbrechliche, der Vergängliche), substantivierte Adjektive auf -keit (Kleinigkeit, Schnelligkeit, Helligkeit) und substantivierte Adjektive auf -e, die allgemeine Zustände oder Charaktere wiedergeben (die Heilen, die Seligen; die Schwere, die Süße). Durch die Substantivierung wird die Bewegung der Verben überführt in einen Zustand der Dauer. Sie werden ihrer Zeitlichkeit enthoben. Auch die als Tätigkeitswort gebrauchten Verben sind oft von ihrem Zeitbezug abgelöst. Vorherrschendes Te mpus ist das Präsens; die häufigen Präsenspartizipien transformieren einen Vorgang in eine andauernde Gegenwart: "ertrinkend in sich" (I/15), "Warmes von euch gebend" (II/7). Das für die Beschreibung eines Zustandes geeignete Wort heißt "sein" - in der Form eines selbständigen Verbs ("Denn Orpheus ist´s" I/5, "Rühmen, das ist´s" I/7, "Sei" II/13) oder als Hilfsverb in Verbindung mit einem Perfektpartizip ("ist uns eingeprägt" I/11, "ist ausgeruht" I/22, "ist aufgerissen" II/16).
Das zweite Sonett. Entfaltung des Orphismus.
Im zweiten Sonett, das wie das erste im Vergangenheitstempus gehalten ist, wird Wera in Beziehung gesetzt zu Orpheus und nimmt quasi Eurydikes Platz ein. Jedoch wird sie nicht leibhaftig aus dem Totenreich herausgeführt. Rilke -oder das lyrische Ich oder der Leser tastet sich förmlich wie durch verschleiernden Nebel an eine Person heran, die es eigentlich - oder vielmehr als greifbar Leibwerdende nicht - mehr - gibt. "Fast ein Mädchen" wäre somit aus der Außenperspektive zu übersetzen in "eine Frau, die eben noch ein Mädchen war". Aus orphischer Sicht dagegen müßte es heißen: "Eine Tote, die gleich ein Mädchen sein wird". Das Vergangenheitstempus, das ab dem dritten Sonett gewissermaßen durch reine Gegenwart ersetzt wird, verweist auf das Durchgangsstadium, als Orpheus noch nicht sang oder vielmehr fast noch schwieg, aber schon auf der Reproduktion einer Federzeichnung so anwesend war wie Wera in der Erinnerung.
Der Übergang vom Noch-nicht-Ersungenen zu dem, was durch Orpheus' Gesang vergegenwärtigt wird, vollzieht sich nicht an einem Wendepunkt, geschieht nicht durch einen qualitativen Umschlag. Allein die Klage darf im 8.Sonett "plötzlich" ein Sternbild in den Himmel halten. Sie tut es "schräg und ungeübt", weil sie fremd ist im "Raum der Rühmung". Das "Fast-Mädchen" des zweiten Sonettes befindet sich in einem Zwischenbereich, in einem Bereich zwischen Leben und Tod, Vergessen und Bewußtheit, in dem es vom lyrischen Ich verinnerlicht wird: "Es schlief in mir". Jedoch ist das schlafende Mädchen nicht nur Objekt der Erfahrung, ihr Schlafen selbst ist eine, wenn nicht die einzige Möglichkeit der Welterfahrung: "Sie schlief die Welt. Singender Gott, wie hast/ du die vollendet, daß sie nicht begehrte,/erst wach zu sein.
Das erste Terzett schließt mit einem Tempuswechsel. Die Vergegenwärtigung des schlafenden Mädchens begann in der Vergangenheit. Die Gegenwart konzentriert sich im Rückblick: "Sieh, sie erstand und schlief". Der zeitlich vor dem "schlafenden Erstehen" liegende Tod ist aber mitnichten Vorvergangenheit, er ist erfragte Gegenwart und ersehntes Motiv eines künftigen orphischen Gesanges: "Wo ist ihr Tod? Oh, wirst du dies Motiv/ erfinden noch, eh sich dein Lied verzehrte?" Tod, Schlaf und Leben, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind keine isolierten Größen. Innerhalb eines Raumes, der zuerst dichterischer sein will, sind sie miteinander verbunden, stehen zueinander in Bezug. Was für das Christentum der Tod ist, ist für Rilke die Zeit. Paulus fragt rhetorisch: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle wo ist dein Sieg? (1.Kor 15,55) Rilkes mit nein zu beantwortende Frage lautet: "Gibt es wirklich die Zeit, die zerstörende?"(II,27) Durch die Hineinnahme des Todes in das "einige Glück aus Sang und Leier"(I,2) wird das "Gespenst des Vergänglichen" (II,27) unwirklich. Unabdingbar für eine solche Verwebung des Todes in Wirklichkeit und für die Aufhebung der Zeit ist die Anwesenheit des orphischen Geistes. Und also begrüßt ihn das 12.Sonett: "Heil dem Geist, der uns verbinden mag;/denn wir leben wahrhaft in Figuren./ und mit kleinen Schritten gehn die Uhren/neben unserm eigentlichen Tag.// Ohne unsern wahren Platz zu kennen,/ handeln wir aus wirklichem Bezug."
Auch Orpheus lebt "in Figuren". Zwar rät das 5.Sonett, sich nicht "um andere Namen" zu mühn, Die Einheit der Sonette jedoch beschwört Orpheus explizit und implizit in vielerlei Gestalt herauf: Orpheus ist Gott, Apoll und "mein Herr" (I,16). Er ersetzt Christus, indem sein Opfertod die Bedingung "unseres" Hörens und Sprechens ist.(I,26) Im 3. Sonett ist Orpheus zunächst Gott:
"Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll/ ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
Das dritte Sonett. Implikationen und Explikation.
"Gott" und "Mann" sind in einem Gegensatz, der durch das Verb "vermögen" realisiert wird. Göttliches Vermögen wird behauptet, die Möglichkeit und der Modus "männlicher" Nachfolge stehen in Frage. Damit knüpft Rilke an allgemeine religiöse Vorstellungen an, für die Gott ewig, allgegenwärtig und eben auch allmächtig, der Mensch jedoch endlich und begrenzt ist. Die Pointe der rhetorischen Frage liegt aber nicht in einer unbestimmten göttlichen Allmacht, sondern in der Fähigkeit, "durch die schmale Leier" voranzugehen. Damit steht außer Frage, daß der aus der griechischen Sage bekannte Halbgott mit der Leier, Orpheus, angesprochen ist. In dem 1904 entstandenen Gedicht "Orpheus. Eurydike. Hermes"17 war Orpheus´ Göttlichkeit noch nicht thematisch; er stieg als "Mann im blauen Mantel" aus der Unterwelt. Bevor erhellt werden kann, welchen Stellenwert Orpheus als Gott gewinnt, ist nach Rilkes Gottesverständnis zu fragen.
Exkurs: Rilkes "Gott"
Zunächst fällt auf, daß "Gott" in Rilkes Spätwerk eher zurücktritt. In den "Elegien" begegnet er lediglich als Zeus, der sich in der Gestalt eines Schwanes seiner Geliebten Leda nähert (sechste Elegie), und als Ziel des freien, da unbewußten, Tieres (achte Elegie). Es ist sicherlich kein Zufall, daß die zweite Elegie, die den Engel als "R epräsentanten der künstlerischen Substanz" in seiner "Mittelstellung ohne Mittlerrolle"18 beschwört, das Göttliche entschärft, indem sie es vervielfältigt: "Stärker/ stemmen die Götter uns an. Doch dies ist Sache der Götter." Die "Sonette" beziehen den Gottesbegriff weitgehend auf Orpheus: "singender Gott"(I/2), "Gott" an der "Leier"(I/3), "Gott", der im "Gesang" "Dasein" vollzieht(I/3), "Gott mit der Leier"(I/19), der durch die Mänaden zerrissene und also "verlorene Gott"(I/26), "singender Gott"(II/26). Allerdings zeigt sich im Bild des zerrissenen, verteilten Gottes der Nukleus der Rilkeschen Gottesbewältigung, wie er auch schon im Frühwerk aufzufinden ist. Das Verteiltsein wird zur Nahtstelle zwischen griechischem Mythos und rilkeschem Kunst-Gott: "Nur weil dich reißend zuletzt die Feindschaft verteilte,/sind wir die Hörenden jetzt und ein Mund der Natur."(I/26) Nicht zuletzt erinnert diese Verknüpfung von Verteilung und Opfertod an die Einsetzungsworte Jesu zum Abendmahl (Matth. 26,26-28). Paradoxerweise scheint das von Rilke an der Person Christi abgelehnte Mittlertum , das seiner Gottunmittelbarkeit im Wege stehe, durch die Verteilung seines Gottes in die "Dinge" erst etabliert zu wer- den. So beschreibt das "Stundenbuch" den Gestus eines Mönches: "Ich bringe alles was ich finde: als Becher brauchte dich der Blinde, sehr tief verbarg dich das Gesinde, der Bettler aber hielt dich hin; und manchmal war bei einem Kinde ein großes Stück von deinem Sinn."19 Der gottsuchende Mönch schließt im voraus die Möglichkeit von Transzendenzerfahrungen aus. Sein Pantheismus kehrt das Gefälle zwischen Gott und Mensch um. Der Mönch wird nicht ergriffen, er selbst ergreift die von ihm vergöttlichte Immanenz. Deutlicher wird das "Stundenbuch" einige Zeilen weiter: "Einer der träumt, dich zu vollenden und: daß er sich vollenden wird" sind die Worte eines Suchenden, der weiß, daß der "Vollendete" nirgendwo anders als in der eigenen Potentialität zu finden ist. Unverblümter trägt Nietzsches Zarathustra einen ähnlichen Gedanken vor: "Es gibt auch in der Frömmigkeit guten Geschmack:...Lieber keinen Gott, lieber auf eigne Faust Schicksal machen, lieber Narr sein, lieber selber Gott sein."20 Anders als Nietzsche, der "mit dem Hammer" philosophiert, trägt Rilke die Masken des Mönches und Pilgers. Er weicht den Bereich des Göttlichen von innen her auf und ergreift gleichermaßen von ihm Besitz. Er gibt sich den Anschein totaler Hingabe; diesem folgt "die plötzliche, entschiedene Bemächtigung und die unerbittliche Gestaltung, die nun den früheren Gegenstand der Hingabe ohne Zögern unterwirft".21 Die Vertraulichkeit, mit der sich Rilkes Mönch etwa dem "Nachbar Gott" nähert: "Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da, um deinem Tasten einen Trank zu reichen"22, läßt diesen als einen alten Mann erscheinen, der auf menschliche Hilfsbereitschaft angewiesen ist. "Gottes" Abhängigkeit vom Menschen erstreckt sich schließlich bis in den Bereich der Existenz. Er ist der "Dom", an dem "wir...mit zitternden Händen" bauen und dessen "Vollendung" nur deswegen nicht an der menschlichen Unzulänglichkeit scheitert, weil "meine Sinne...die letzten Zierrate" zu "bilden und baun" - träumen. Der Zusammenhang zwischen Gottverwirklichung und künstlerischer Selbstverwirklichung läßt jedoch eine Kluft zwischen "Gott" und Selbst bestehen; beide fallen nicht ineinander. Der Künstler realisiert, in Analogie zum geometrischen Ort der Ellipse, "Gott" als den zweiten Brennpunkt seines Inneren. Nötig geworden ist diese Manipulation, die jede Gottesleugnung an Wirkung übertrifft, weil eine anthropologische Konstante schlechthin nicht geleugnet werden kann: die Sehnsucht. Rilke setzte sich schon früh mit dieser Realität auseinander: "Die, welche die meiste Sehnsucht haben, wissen nicht zu sagen, wonach. Dann kommt der Versucher und sagt: 'Gott ist es und seine Güte, wonach euch verlangt, verleugnet euch, und ihr werdet ihn finden.'Da gehn sie hin und verleugnen sich. Und da haben sie keine Sehnsucht mehr."23 Der Künstler würde seinem Anspruch nicht gerecht, wollte er seine Aktivität von "Gott" begrenzen lassen. Seine Sehnsucht zielt nicht auf "Gott", sie durchdringt ihn, macht ihn zum "Ding der Dinge"24, zum Gegenstand, der durch den Dichter erst zur Vollkommenheit geführt wird.
Orpheus, dem "durch die Leier" zu folgen sei, ist ein Gott. Schon die Verwendung des unbestimmten Artikels signalisiert, daß der Gott der Juden und Christen höchstens darin von Belang ist, daß dessen Geltung durch die Verletzung des ersten Gebotes außer Kraft gesetzt wurde.
Der Modus der Nachfolge ist in ein Bild gekleidet, dessen Sinn sich nicht vorderhand erschließt. Nachzuvollziehen wäre, dem göttlichen Vorbild ,"an der schmalen Leier" sitzend und mit ihr spielend, zu folgen. Das ist aber offensichtlich, jedenfalls vordergründig, nicht gemeint.
Die antike Leier, die Lyra, besteht aus einem Schildkrötenpanzer, der mit einer Kuhhaut überspannt ist. Zwei am Panzer befestigte Jocharme, meistens gebogene Hörner, sind durch ein Joch miteinander verbunden, von dem wiederum sieben Saiten zurücklaufen zum Schallkörper. "Durch die Leier" nicht folgen zu können, hieße, wörtlich genommen, ein entmaterialisierter Geist würde mühelos durch die Leier hindurchschlüpfen können, während der Mann alleine schon vor der Materialität ihrer Saiten haltmachen müßte. Ein solcher Geist wäre aber nicht der Verbindung und Bezug schaffende des 12. Sonettes, er wäre ein Gespenst. Orpheus` Göttlichkeit soll sich aber nicht in der Überwindung der Dinge zeigen, sondern in der Verwirklichung ihrer Bezüge. Er tut das, indem er sich im Raum des dichtenden Gesanges, im Weltinnenraum des Dichters bewegt. Lyrik ist ursprünglich der von der Lyra begleitete Gesang. Wie aber, fragt man sich, bewegen sich Götter im Raum der Dichtung?
Das 24. Sonett gibt Auskunft darüber, wie sich Menschen bewegen, die die "Götter" aus ihrer Wirklichkeit verstoßen haben: "Einsamer nun auf einander ganz angewiesen, ohne einander zu kennen, führen wir nicht mehr die Pfade als schöne Mäander, sondern als Grade."
Göttliche Wege sind "schöne Mäander"; die Dinge in Bezug zu setzen heißt, sie quasi hermeneutisch zu umkreisen.Die geraden Wege des technischen Fortschritts drücken den Willen aus, "die Erde zu beherrschen".25 Die umkreisende, mäandrierende Bewegung entspricht der lautlichen Gestaltung in den ersten, durch Enjambement verbundenen Versen des 3.Sonettes. Der regelmäßige Wechsel zwischen den hellen, hohen Vokalen "e" und "i" einerseits und den tiefen, dunklen Vokalen "a", "o", "u" andererseits umschreibt die mäandrierende Bewegung des Gottes, der durch die Leier geht, nicht flächig durch die Jocharme, sondern raumgreifend jede Saite umkreisend.
eieieeieiieieeie
oaaaoaoua
Allein diese quasi oszillierende Bewegung zwischen dies- und jenseits der Leier, zwischen Leben und Tod, zwischen den Dingen und der Sprache vermag den Bezug herzustellen, den Rilke als "Auftrag der Erde" beschreibt. Diesem Auftrag wird ein Mann nicht gerecht, wenn er, wie es in den "Gegenstrophen" heißt, "gebrochen vom Berg, oft schon als Knabe scharf an den Rändern" ist und damit die Frauen, "Euridikes Schwestern, immer voll heiliger Umkehr"26, verfehlt - oder vielmehr sich von ihnen verfehlen läßt:
"Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier Herzwege steht kein Tempel f ü r Apoll."
Der "Zwiespalt" des Mannes im 3. Sonett ist in Rilkes lyrischem Werk ein Hapaxlegomenon. Das von Rilke gern benutzte Grimmsche Wörterbuch vermerkt dazu in etwa: Zwiespalt ist eine psychische Disposition, die eine Entscheidung für oder gegen etwas unmöglich macht. Der Mann ist in der aus orphischer Sicht fürchterlichen Situation, nicht entscheiden zu können, worauf, oder vielmehr, ober er seine Begierde auf etwas richten soll. Er ist selbst den Liebenden der 1. Elegie gegenüber im Nachteil, denen die Nacht schwer wird, weil sie sich "miteinander ihr Los [verdecken]. Wo zwei Begierden sich überschneiden,ist nicht nur kein Raum für die mythische Verwandlung der Dinge in Gesang. Auch das den Tieren mögliche Hören, der ihnen von Orpheus geschenkte "Tempel im Ohr" ist dem Zwiespältigen unerreichbar. Der Mythos vom Sängergott Apoll, der den Menschen die Leier brachte, ist ihm bestenfalls ein Lügenmärchen. Aber auch die Liebenden, die sich an den Geliebten hingeben, ihn zu "erreichen" suchen, um ein Nicht- Eigenes werben, verfehlen die Möglichkeit orphischen Singens. Die Gaspara Stampa der ersten Elegie ist im Vergleich zu ihnen weiter, obwohl auch sie keine "Aufsingende" ist. Die Liebe der Verlassenen ist reiner, weil sie gewis- sermaßen vom beanspruchenden Objekt befreit ist. Ihr Los ist unverdeckt. Sie ist sie selbst, da nur sie selbst bei sich ist. Um "mehr zu sein als er selbst", muß der Liebende, der "Pfeil auf der Sehne," sein Dasein in Rühmen verwandeln. Damit ist das Kernstück der rilkeschen Liebeskonzeption angesprochen. Nicht umsonst changierte das Fast-Mädchen des zweiten Sonettes euridikenähnlich zwischen Schlaf und Tod. Ihr "Insichruhen" ist vor allem Wunschlosigkeit - gerade auch im geschlechtlichen Sinne. Salopp formuliert, wird der Dichter von dieser Frau zu produktiver Arbeit stimuliert, ohne sogleich wieder davon abgehalten zu werden. Rilkes beständiges Ansinnen, lieben zu dürfen, ohne durch die Gegenliebe sich überfordern lassen zu müssen, erfährt durch Orpheus eine mythologische Legitimation. Euridike ist tatsächlich entrückt, so daß der aus Liebe inspirierte Sänger sich seiner Kunst hingeben kann, ohne sich in Schuld zu verstricken. Er ist von dem Zwiespalt zwischen Liebe und Kunst nicht betroffen. Das dritte Sonett ist somit auch eine "chiffrierte Beweisführung für die Unvereinbarkeit und Unvergleichbarkeit von gelebtem Fühlen und künstlerischem Schaffen"27. Der religiös überhöhte Orpheus wird zu einer höchsten Instanz, vor der sich die künstlerischen Produktionsbedingungen als Askese geben dürfen:
"Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr, nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;"
Die Kehrseite dieser Askese wird in der Stellung deutlich, die Orpheus gegen das Christentum, ja gegen Christus selbst einnimmt. Im zeitgleich mit den "Sonetten" entstandenen "Brief des jungen Arbeiters" findet Rilke dafür deutliche Worte: "Sie lassen sich nicht vor Eifer, das Hiesige, zu dem wir doch Lust und Vertrauen haben sollten, schlecht und wertlos zu machen"28, lautet der allgemeine Vorwurf an Christen, die ihre Erlösungshoffnung auf ein Jenseits richten. In den Worten Marthes, der Freundin des jungen Arbeiters, spricht sich Rilkes Gottesbild aus, "daß Gott einen in den Kirchen in Ruhe läßt, daß er nichts verlangt; man könnte meinen, er wäre überhaupt nicht da"29. Der Haupteinwand gegen die christliche Ethik wird am Ende des Briefes vorgetragen: Die schlimmste Herabsetzung, die das Christentum dem Irdischen bereitet, ist die Verachtung der "sinnlichen Liebe", we il es "uns dort ins Unrecht setzt, wo die ganze Kreatur ihr seligstes Recht genießt"30. Die Frage, "warum gehören wir nicht zu Gott von dieser Stelle aus"31, beantwortet Rilke in einem Brief aus Muzot aus dem Jahre 1922. "Liebes-Absage oder Liebes-Erfüllung, beide sind nur dort wunderbar und ohne Gleichen, wo das ganze Liebeserlebnis...eine zentrale Lage einnehmen darf: dort wird ja dann auch...Absage und Ausfüllung identisch. Wo das Unendliche g a n z eintritt (sei es als Minus oder Plus), fällt das Vorzeichen weg,...und was bleibt, ist das Angekommensein, das S e i n !... Wenn Sie so von der Mitte und vom Streben um das 'Sein' (das heißt um die Erfahrung der möglichst vollzähligen inneren Intensität) ausgehen, so wird auch Ihre Einstellung zu etwa aufspringendem dichterischem Antrieb sich klären."32 Die Worte des dritten Sonetts:
"Gesang ist Dasein. F ü r den Gott ein Leichtes. Wann aber sind wir? Und wann wendet er an unser Sein die Erde und die Sterne?
werden durch den Brief in ihrer ganzen Ambivalenz erhellt. Die Intensität des Liebesaktes wird als transzendentales Erlebnis im Göttlichen bestätigt und damit gleichermaßen in die Lebensmitte gerückt. Dieses "Kunststück" ist im Menschlichen nur schwer zu leisten, weil es in der Spannung von "Absage und Ausfüllung" "zwiegespalten" ist. Die dialektische Auflösung dieses Widerspruches, die "Dasein" erst ermöglicht, ist Orpheus, dem Kunstgott, vorbehalten. Das den Gesang vorbereitende Liebes- und Lebenserlebnis geht in diesem auf und ist hernach obsolet. Nur so wendet Orpheus "Erde und Sterne" an das "Sein" des Dichters. Leben und Welt gehen restlos im transformierenden "Gesang" auf. "Wir" sind, wenn wir den "Bildern im Innern geeint" sind. (II,21) Es ist "der ganze, der rühmliche Teppich gemeint". Wahres Sein ist wahres Singen, und das entbehrt nicht der Vollständigkeit aller Dinge im Innern.
Wie alle Religionen, beansprucht Rilkes Kunstreligion Exklusivität. Wer ihr anhängt, indem er sie auslebt (von "Glauben" an ein "extra nos", wie es beispielsweise Luthers Anthropologie vorstellt, kann in diesem Zu- sammenhang schwerlich die Rede sein), muß alle anderen Lebensentwürfe entweder integrieren oder ablehnen. Ausgrenzen muß er aber auch die (noch) Unberufenen, die sein "Haus" überfüllen könnten. In diesem Sinne versteht sich die Ermahnung:
"Dies ists nicht, J ü ngling, da ß du liebst, wenn auch die Stimme dann den Mund dir aufst öß t, -lerne vergessen, da ß du aufsangst. Das verrinnt."
So dezent das Bild vom durch die Stimme aufgestoßenen Mund ist, so vernichtend ist die Evokation der Stimme eines aufstoßenden Mundes. Die Aufforderung, nicht nur das Gesungene, das vielleicht unfertige Kunstprodukt, sondern das Singen selbst zu "vergessen" ist nicht eindeutig. "Daß du aufsangst" läßt dem angesprochenen "Jüngling" die Freiheit der Interpretation und - anscheinend - die Möglichkeit eines Neuanfanges. Es mag als Selbstreflexion verstanden sein, wenn Rilke 1913 "Über den jungen Dichter" schreibt: "Der unverhältnismäßige Geist, der im Bewußtsein des Jünglings nicht Platz hat, schwebt da über einer entwic??kelten Unterwelt voller Freuden und Furchtbarkeiten. Aus ihr allein...vermöchte er seine gewaltigen Absichten zu bestreiten. Aber da lockt es ihn auch schon, durch die rein leitenden Sinne des Ergriffenen mit der vorhandenen Welt zu verhandeln. Und wie er innen an das verborgen Mächtigste seinen Anschluß hat, so wird er im Sichtbaren schnell und genau von kleinen winkenden Anlässen bedient: widerspräche es doch der verschwiegenen Natur, in dem Verständigten das Bedeutende anders als unscheinbar aufzuregen."33 Die in Muzot erhobene Forderung ist hier noch nicht radikal, wenn auch schon in Umrissen erkennbar. Das "verborgen Mächtigste", Freude - Furchtbarkeiten - Liebeserleben, ist elementar, aber noch nicht Kunst. Es drückt sich im Aufschrei aus, nicht im Gesang. Vor allem aber fehlt ihm die Selbstreflexion, die notwendig ist, um die "Lust aller Kunst an sich selbst, die zu ihrem Wesen gehörige Eitelkeit"34 zu verlernen. Die Wahrnehmung des Unscheinbaren im "Sichtbaren" ist hierzu Korrektiv, ja sie ist selbst Ausdrucksform für die rühmend-rühmlichen Wandlungen. Um Metamorphosen in Orpheus zu leisten, ist das Unscheinbare schon zu viel:
"In Wahrheit singen, ist ein andrer Hauch. Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind."
Der Anfang des Singens kann für den Jüngling nurmehr ein Hauchen sein. Das Singen bedingt und dem Singen voraus geht: Atmen. Für das erste Sonett des zweiten Teils ist Atmen ein "immerfort um das eigene/ Sein rein ausgetauschter Weltraum". Die verinnerlichte Welt wird "geäußert", zur Sprache gebracht. Zu hauchen entspricht den Möglichkeiten des eben noch aus Liebe singenden Jünglings.
Doch der "Hauch um nichts" weist auch zurück auf das Stunden-Buch: "Gott,...dir war das Nichts wie eine Wunde,da kühltest du sie mit der Welt."35
Doch nun beansprucht der "in Wahrheit Singende" Gottes Platz: die vom Nichts in die Wirklichkeit geschlagene Wunde zu heilen durch rühmendes Aufsingen. Sein Ort schon im Stunden-Buch36 war "wo die Engel sind, hoch, wo das Licht in Nichts zerrinnt". Gott aber (hier noch ohne Artikel)"dunkelt tief", er ist die Wurzel eines Baumes, in dessen Wipfel die Engel "das letzte Wehn" sind. Gott hat sich verborgen, seit er, ermüdet, "die Zeit...verworfen hat". Dem betenden "ich" und den Engeln benachbart ist der "helle Gott der Zeit", der "Fürst im Land des Lichts", der sich auf den "großen Glanz des Nichts" reimt: "Lucifer".
[...]
1 Vgl. Schwab, S.428-432
2 Kellenter, S.77f.
3 Leppmann S.373
4 an die Gräfin Sizzo-Noris-Crouy, zit. Holthusen, S. 23
5 Holthusen, S.11
6 Holthusen, S.23f.
7 An Witold Hulewicz, vom 13.November 1925. Briefe, Bd.2, S.374
8 An Morgot Sizzo, vom 17. März 1922. Briefe, Bd.2, S.233.
9 An Witold Hulewicz, vom 13.November 1925. Briefe, Bd.2, S.376 f.
10 ebd.
11 Ullmann, S.236 ff.
12 Vgl. zum folgenden Kellenter, S.80ff.
13 Pongs, S. 398
14 Mettler (Knörrich), S.376
15 Holthusen, S.53
16 Kellenter, S.91
17 SW I, S.542ff.
18 Höhler, S.98
19 SW I, S.291
20 F. Nietzsche: Also sprach Zarathustra. Vierter Teil: "Außer Dienst". In: Werke, Bd. 2, S.500
21 Höhler, S.124
22 SW I, S.255
23 Rilke, Tagebücher aus der Frühzeit, S.42
24 SW I, S.265
25 Mörchen, S.189
26 Rilke, Werke, S.335
27 Höhler,S. 206
28 Rilke, Von Kunst-Dingen, S.214
29 Ebda, S.218
30 Ebda., S.220
31 Ebda., S.221
32 An Rudolf Bodländer. Vom 23.März 1922. In: Briefe in zwei Bänden. Bd.2, S.244
33 Über den jungen Dichter. In: Rilke. Von Kunst-Dingen, S.162f.
34 Mörchen, S.72
35 SW, S.279
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptthemen der "Sonette an Orpheus"?
Die Hauptthemen umfassen die Einheit von Leben und Tod, Kunst und Wirklichkeit, die Rolle von Orpheus als Dichter und Gott, und die Beziehung zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren.
Wer ist Wera Ouckama Knoop, und welche Bedeutung hat sie für die "Sonette an Orpheus"?
Wera Ouckama Knoop war eine junge Tänzerin, die Rilke kannte und die im Widmungsgedicht erwähnt wird. Sie steht für das tanzende Mädchen und verkörpert sowohl Leben als auch Tod und die Kunst der Wandlung. Sie kann als Eurydike-Figur interpretiert werden.
Was ist der Weltinnenraum und wie hängt er mit Rilkes Dichtung zusammen?
Der Weltinnenraum ist ein zentraler Begriff in Rilkes Werk, der die Idee beinhaltet, dass die wahre Welt im Inneren existiert. Die Aufgabe des Dichters ist es, die äußere Welt in die innere zu verwandeln und dort zu vergegenwärtigen.
Wie ist die Form der "Sonette an Orpheus" gestaltet?
Die "Sonette an Orpheus" bestehen aus zwei Teilen mit je 26 bzw. 29 Sonetten. Sie sind inhaltlich durch die Einheit von Leben und Tod verbunden. Rhythmische und inhaltliche Verbindungen bestehen zwischen den einzelnen Sonetten, aber die formale Struktur weicht von klassischen Sonettformen ab.
Was ist das Besondere an Rilkes Gottesvorstellung in den "Sonetten an Orpheus"?
Rilkes Gottesvorstellung ist stark mit Orpheus verbunden, der als singender Gott und Vermittler zwischen Leben und Tod dargestellt wird. Rilke distanziert sich von der traditionellen christlichen Gottesvorstellung und betont die Bedeutung der Immanenz und der künstlerischen Selbstverwirklichung.
Welche Rolle spielt der Gesang in den "Sonetten an Orpheus"?
Der Gesang ist zentral für Rilkes Verständnis von Kunst und Dasein. Er ist nicht nur Begehren oder Werbung, sondern Dasein selbst. Durch den Gesang transformiert der Dichter die Welt und schafft eine neue Wirklichkeit.
Inwiefern kritisiert Rilke das Christentum in seinen Werken?
Rilke kritisiert das Christentum für seine Geringschätzung des Irdischen und der sinnlichen Liebe. Er betont die Bedeutung des Diesseits und die Notwendigkeit, das Göttliche im eigenen Inneren zu finden und zu verwirklichen.
Was bedeutet "Zwiespalt" im Kontext des dritten Sonetts?
"Zwiespalt" bezeichnet eine psychische Disposition, die eine Entscheidung unmöglich macht. Im dritten Sonett steht der Zwiespalt für die Unfähigkeit des Mannes, sich auf eine Richtung oder ein Ziel festzulegen, was ihm den Zugang zu orphischem Gesang und göttlicher Erfahrung verwehrt.
Wie verwendet Rilke Sprache und Stilmittel in den "Sonetten an Orpheus"?
Rilke verwendet Neologismen, ungewöhnliche Wortzusammensetzungen und Substantivierungen, um die Grenzen der Alltagssprache zu überschreiten und neue Bedeutungsebenen zu erschließen. Er verwendet Präsens und Partizipien, um eine andauernde Gegenwart zu schaffen.
Welche Bedeutung hat das Atmen in den "Sonetten an Orpheus"?
Das Atmen ist ein zentrales Motiv, das mit dem Singen und dem Schaffen verbunden ist. Es steht für den Austausch zwischen der inneren und äußeren Welt und die Verinnerlichung der Welt durch den Dichter.
- Quote paper
- Mathias Kraatz (Author), 1998, Rilke, Rainer Maria - Sonette an Orpheus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96544