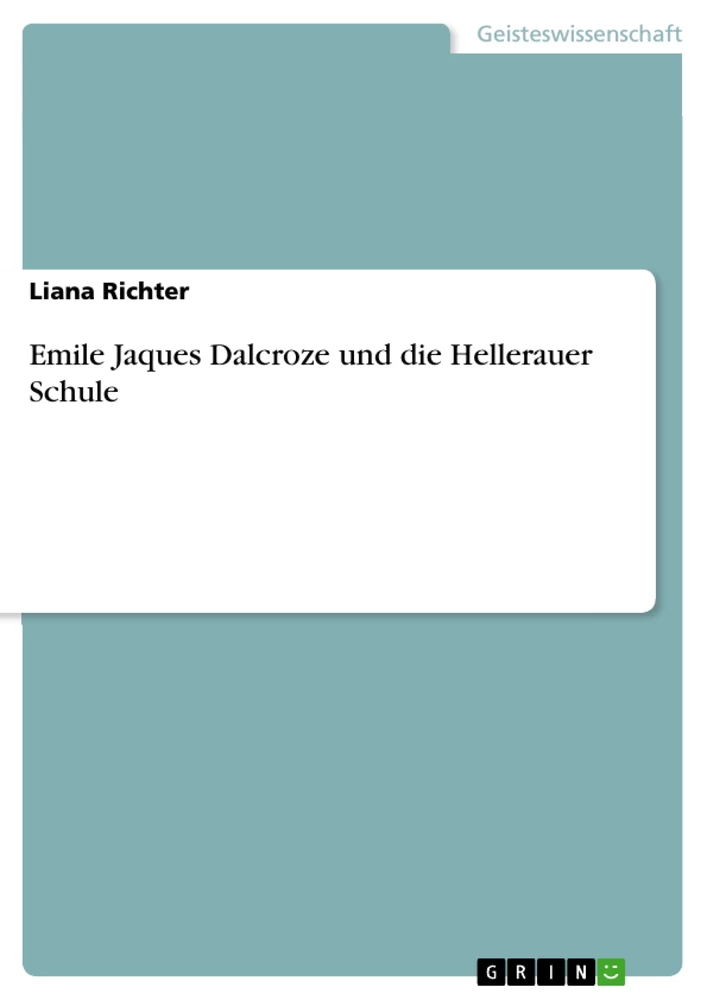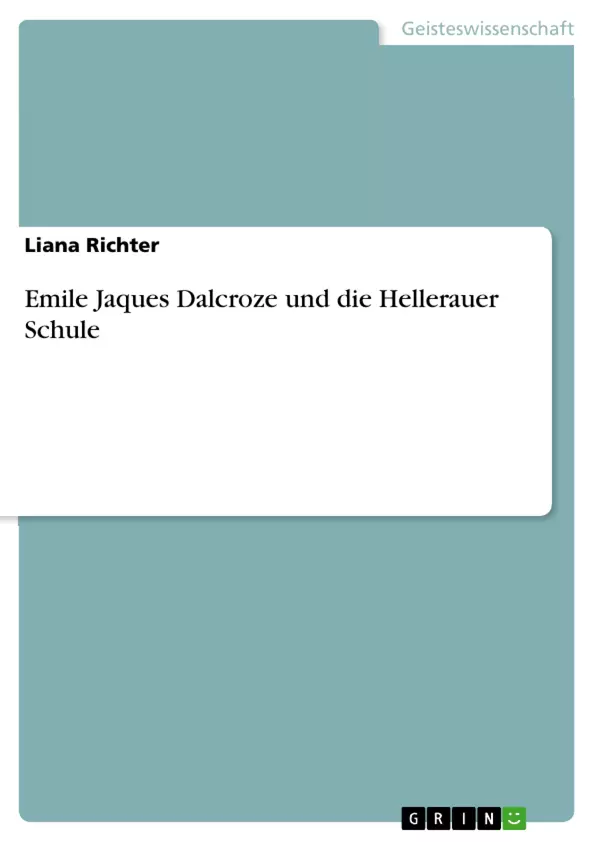Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Musik nicht nur gehört, sondern mit jeder Faser des Körpers erlebt wird. Dieses Buch entführt Sie in die revolutionäre Welt von Émile Jaques-Dalcroze, dem Begründer der rhythmischen Gymnastik, dessen innovative Methoden die Bühnenkunst und die Musikerziehung des frühen 20. Jahrhunderts nachhaltig prägten. Erleben Sie, wie Dalcroze in seiner Bildungsanstalt in Hellerau, in enger Zusammenarbeit mit visionären Köpfen wie Adolphe Appia, die starren Konventionen des Theaters aufbrach und eine neue Ästhetik des Zusammenspiels von Musik, Bewegung und Licht schuf. Tauchen Sie ein in Dalcrozes' tiefgründige Gedankenwelt, in der Rhythmus als das pulsierende Herz des Lebens und der Kunst verstanden wird, und erfahren Sie, wie er durch die Schulung von Körper und Geist die kreative Entfaltung des Einzelnen freisetzen wollte. Entdecken Sie die zentralen Elemente seiner Lehre, von der Bedeutung des Takts als Grundlage jeder Bewegung bis hin zur Notwendigkeit, die Musik nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich zu erfassen. Lassen Sie sich inspirieren von Dalcrozes' Vision einer Kunst, die nicht nur Ausdruck, sondern das Leben selbst ist, und die den Künstler dazu aufruft, zu den Urgefühlen zurückzukehren und seine Darstellung auf das Wesentliche zu reduzieren. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise in eine Zeit des künstlerischen Aufbruchs, eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Wesen von Rhythmus und Bewegung und eine Hommage an einen Pionier, der die Welt der Musik und des Tanzes für immer veränderte. Es ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Theatergeschichte, Musikpädagogik und die Verbindung von Körper und Geist interessieren. Begeben Sie sich auf die Spuren der Lebensreformbewegung, die um 1900 die Welt erfasste, und erleben Sie, wie Dalcroze's Ideen bis heute nachwirken und die zeitgenössische Kunst beeinflussen.
Inhaltsverzeichnis
1. Eckpunkte des Zeitgeschehen um 1900
2. Emile Jaques-Dalcroze
3. Emile Jaques-Dalcroze und Hellerau
4. Die Grundgedanken in Dalcrozes' Schriften
4.1. Rhythmus und Bewegung
4.2. Dalcrozes' Kunst und Ästhetikbegriff
4.3. Musik, Bewegung und Tanz
4.4. Anmerkungen zur Beleuchtungs- und Bühnentechnik
4.5. Zur Wahrnehmung und dem Empfinden von Kunst
5. Quellenverzeichnis
1. Eckpunkte des Zeitgeschehens um 1900
Um die Jahrhundertwende fand eine entscheidende Trendwende statt, die bedeutende Entwicklungen und Theaterreformen nach sich zog. Man begann, die naturalistische Dopplung des alltäglichen Lebens auf der Bühne zu kritisieren und orientierte sich statt dessen zunehmend an der neuen Ästhetikkonzeption, die Nietzsches, mit seinem Werk “Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik” geliefert hatte. Die Musik avancierte zum neuen ästhetischen Modell.
Man setzte es sich zum Ziel, die mythischen Dimensionen des Theaters als “Fest des Lebens” zu erneuern. Diesem Gedanken wurde durch die Veranstaltung zahlreicher Festspiele, die für die Teilnahme und Mitwirkung von Menschenmassen konzipiert worden waren, Rechnung getragen. Eben diese Massenfestspiele entsprachen in ihrem Charakter dem angestrebten Programm der “Ästhetisierung des Lebens”. Derartige Ideen entwickelten sich parallel zu einer Lebensreformbewegung, die an konservativen Wertvorstellungen festhielt und ein einfaches, naturgemäßes Leben idealisierte. In der Schauspielkunst wurde Methoden wie der Stilisierung und der Hervorhebung der Kunsthaftigkeit des Theaterspiels, die man besonders am Beispiel des japanischen Theaters beobachtete, mehr und mehr Bedeutung beigemessen. Auch der Bühnen- und Zuschauerraum wurde diesen neuen Ideen angeglichen, indem Abstand vom Prinzip der sogenannten Guckkastenbühnen nahm und dafür Theaterräume, die für ein Theater des Gemeinschaftserlebnis von Zuschauern und Schauspielern auch architektonisch ermöglichten sollten, schuf.
Dieser fundamentalen Reformbewegung des Theaters gehörten unter anderem namhafte Persönlichkeiten, wie Edward Gordon Craig, W.E. Meyerhold, Georg Fuchs, Adolphe Appia und Emile Jaques-Dalcroze an.
2.Emile Jaques-Dalcroze
Der schweizerische Musikpädagoge und Komponist Emile Jaques-Dalcroze wurde 1865 in Wien geboren und erlangte Bekanntheit als der Begründer der rhythmischen Gymnastik. Er war Schüler des berühmten österreichischen Komponisten Anton Bruckner und arbeitete nach seiner Ausbildung vorerst als Dozent an einem Genfer Konservatorium. Dort entwickelte er, während er seiner regulären Lehrtätigkeit nachging, eine neue Form von Tanzgymnastik. Im Jahre 1911 zog Dalcroze in die Gartenstadt Hellerau bei Dresden, wo er sein eigenes Arbeitszentrum errichtete, in dem er seine neuartigen Methoden zur Anwendung brachte.
3. Die Hellerauer Schule
Die Stadt Hellerau war 1908/9 nach den Plänen des Architekten Riemerschmid, auf der Basis der Ideen der Lebensreformbewegung als vorbildliche Werksiedlung für die Arbeiter der "Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst" angelegt worden. Im Zuge der Gartenstadtbewegung, die ihren Ausgangspunkt im England des ausgehenden 19. Jahrhundert genommen hatte, wurde Hellerau noch im selben Jahre auf Initiative von Wolf Dohrn zur Gartenstadt ausgebaut. Es war auch Dohrn, der Dalcroze dazu bewegte, nach Hellerau zu kommen, wo dieser in enge Zusammenarbeit mit schweizerischen Bühnenbildner und Theatertheoretiker Adolphe Appia trat. In den Jahren 1910-12 wurde das Hellerauer Festspielhaus, das von Tessenow entworfen worden war, erbaut, welches zum Mittelpunkt der "Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze" wurde. In der Architektur des Festspielhauses wurden die neuen Ideen der Theaterreform umgesetzt. So bildeten Bühne und Zuschauerraum des mobilen Amphitheaters eine Raumeinheit und trugen damit dem Gedanken der kollektiven Feier und dem des Gemeinschaftserlebnisses Rechnung. Die einzigartig Beleuchtungstechnik von tausenden in Reihe geschalteten Glühbirnen ermöglichte außergewöhnliche lichtdramaturgische Effekte und eröffnete die Möglichkeit, die Lichtgestaltung der Musik anzugleichen, das Licht seiner musikalischen Qualität nach (Appia) einzusetzen. Bis 1914 fanden in Hellerau Schulfeste statt, auf denen die Arbeitsergebnisse öffentlich vorgeführt wurden. Die Anstalt wurde zu Beginn des Kriegsausbruchs geschlossen. Dalcroze Ideen verbreiteten sich jedoch in der Zeit von 1911-1913 über ganz Europa und zahlreiche Schulen fingen an, nach seinen Methoden zu unterrichten.
4. Die Grundgedanken in Dalcrozes' Schriften
In den folgenden Abschnitten nehme ich Bezug auf die Veröffentlichungen von Dalcroze bis 1919, die er in der Absicht, die körperliche und geistige Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu reformieren geschrieben hat, und welche 1921 gesammelt von Dr. Julius Schwabe herausgegeben wurden.
4.1. Rhythmus und Bewegung
Dalcroze sieht im Rhythmus das lebendige Wesen des Gefühls und die Basis jeglichen körperlichen und musikalischen Ausdrucks und Verständnisses. Rhythmus verlangt Ordnung, Maß und Harmonie. Er ist Bewegung, welche wiederum körperlich ist und in Abhängigkeit von den Determinanten Raum, Zeit und Dynamik steht. Eine Bewegung an sich hat noch keinen Ausdruckswert, sondern gewinnt diesen erst durch die Dynamik.
Die Grundlage des Rhythmus bildet der Takt, der sich in zahlreichen natürlichen Bewegungen des menschlichen Körpers findet, zum Beispiel im Puls oder im Gang. Die rhythmischen Elemente der Musik sind ursprünglich dem Rhythmus des Leibes entlehnt.
Die Fähigkeit, Rhythmus, also Bewegung, zu empfinden und auszuführen, ist angeboren und beim einzelnen Menschen mehr oder weniger gut ausgeprägt, kann und soll jedoch durch Erfahrung, mit anderen Worten ein entsprechendes Training der Muskeln und des Gehörs, geschult und verbessert werden.
Die Arhythmie bezeichnet Dalcroze als eine weit verbreitete Krankheit, nämlich als das Unvermögen eines Menschen, sich selbst zu kontrollieren oder das Überwiegen intellektueller Eigenschaften über nervöse Funktionen.
Mittels der Automatisierung körperlicher Vorgänge und dem Erwerb neuer motorischer Gewohnheiten und Reflexe wird letztendlich Körperbeherrschung erlangt, und somit geistige Freiheit ermöglicht, weil der Bewegungsablauf keine Konzentration mehr auf den Körper erfordert. Erst damit ist die Voraussetzung für einen ungehemmten Ablauf der natürlichen Rhythmen geschaffen.
4. 2. Dalcrozes' Kunst- und Ästhetikbegriff
Kunst ist nicht etwa ein besonderes Mittel, das Leben auszudrücken und zuübersetzen, "sie ist das Leben selbst und die Art, es innerlich zu erfühlen"
Die Bewegung liegt allen Künsten zu Grunde, und Tanz ist die Kunst, Gefühle mit Hilfe rhythmischer Körperbewegungen auszudrücken.
Künstlerisches Genie besitzt jemand, der Einbildungskraft und Ordnung besitzt und die Bewegungen aller Einzelseelen seiner Gesellschaft zu einer Gesamtheit zu vereinigen und auszudrücken vermag- aus seinem Werk spricht die Seele seines Volkes selbst. Dabei sind für Dalcroze Form, Regeln, Perfektion und Verstand von sekundärem Gewicht , da sie ohne das Gefühl und die Kreativität des Künstlers keinen Wert haben. Beim Musiker und darstellenden Künstler ist Technik zwar von großer Bedeutung, Musik und Schauspiel können aber unmöglich nur auf ihr beruhen, weil sonst der Künstler durch die Maschine ersetzbar wäre. Er beschreibt das Verhältnis von Gefühl und Verstand so, daß der Geist Ausdruckselemente idealisierend ordnet, gruppiert, verbindet und gestaltet, und ihnen von seelischem Leben und Fühlen durchdrungene Formen gibt. Der Künstler soll das Wesentliche und Wichtigste aus seinen Empfindungen herausfiltern, zu den Urgefühlen und der Einfachheit des Ausdrucks zurückkehren und seine Darstellung also auf eine Stilisierung reduzieren.
4.3. Musik, Bewegung und Tanz
Über die Musik und ihre Beziehung zu Bewegung und Tanz schreibt Dalcroze, daß sie eine zwiefache, jedoch einheitliche Sprache sind, um die grundlegenden Empfindungen, die Leidenschaften und das Unterbewußte auszudrücken. Musik und Darstellung sollen einander durchdringen. Der Tänzer muß in der Lage sein, die durch die Musik hervor gerufene ästhetische Erregung spontan in Handlungen und Gebärden zu übersetzten. Der Tänzer soll bei seiner Darbietung nahezu nackt auftreten, einerseits aus ästhetischen Gründen, andererseits, damit der Zuschauer die Bewegungen klar und unverschleiert in ihrem natürlichen Ablauf betrachten kann.
Musik besteht aus Klang und Bewegung, soll deshalb auch nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Körper erfaßt werden. Dabei sollte sich der Tänzer vom Gefühlsgehalt der Musik mehr inspirieren lassen, als von ihren äußeren Formen der Rhythmik, alle unnötigen, unnatürlichen Bewegungen und somit Übertreibungen unterlassen. Verstandesanalyse und das Trachten nach malerischen Reizen führt unweigerlich zur Abschwächung der Wirkung.
Ziel des Zusammenwirkens von Musik und Tanz ist ihre Verschmelzung, nicht nur dieäußere Anlehnung, Neuschöpfung oder bloße Nachahmung, rhythmische Ü bereinstimmung oder gewöhnliche Gleichzeitigkeit, spontane Empfänglichkeit oder berechnete Anpassung sein Die Musik der Töne regelt, ordnet, und stilisiert die Plastik, die ohne sie der zügellosen Willkür der Bewegungen preisgegeben wäre. Auf der anderen Seite macht die Plastik die Töne sichtbar und vermenschlicht sie sozusagen.
Im Reichtum der Ausdrucks steht die plastische Sprache der musikalischen in Nichts nach. Allerdings kann nur Musik die eigens für den Tänzer komponiert wurde in Einklang mit dem musikalischen Gehalt umgesetzt werden. Von daher empfiehlt Dalcroze, daß sich Musiker und Tänzer gleichermaßen einer körperlichen und musikalischen .Ausbildung unterziehen sollten, um besser aufeinander eingehen zu können..
4.4.Anmerkungen zur Licht- und Bühnengestaltung
Zum Bühnenbild bemerkt Dalcroze, daß gemalte Kulissen der Dreidimensionalität der menschlichen Bewegung und des Raumes widersprechen und sich somit ungeeignet erweisen. Er empfiehlt, Treppen und von der Ebene abweichende Untergründe zu verwenden, um neue den Bewegungen neue Wirkungsmöglichkeiten zu verschaffen. Außerdem sollen in der theatralen Handlung vorkommende Gegenstände durch Bewegungen illusorisch dargestellt werden. Entschieden spricht er sich für die Abschaffung des Raumes zwischen Bühne und Orchester, des Proszeniums, aus.
Was die Bühnenbeleuchtung angeht, meint Dalcroze, daß sie, weil sie einander verschwistert sind, Musik und Licht innerhalb einer Aufführung aufeinander abgestimmt werden können und sollten..
4.5. Zur Wahrnehmung und dem Empfinden von Kunst
Beim Anhören des Tonwerkes mußder Hörer sich sagen: "Diese Musik, das bist du!"
Gleichsam fühlt der ausgebildete Rhythmiker die Bewegung, die ein anderer vor seinen Augen vollzieht, denn er ist fähig, räumlich- zeitliche Einstellung und den Aufwand an Muskelkraft nachfühlend zu ermessen. Außerdem meint Dalcroze, man kann ein Werk weder beurteilen noch wirklich kennen , wenn es einem nicht in Fleisch und Blut und- in die Seeleübergegangen ist.
5.Quellenverzeichnis
Brauneck, Manfred: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reformodelle. Reinbek 1986.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptpunkte des Zeitgeschehens um 1900, die in diesem Dokument diskutiert werden?
Um 1900 gab es eine Trendwende, die zu Theaterreformen führte. Man kritisierte die naturalistische Dopplung des Alltagslebens auf der Bühne und orientierte sich an Nietzsches Ästhetikkonzeption. Musik wurde zum neuen ästhetischen Modell, und man versuchte, die mythischen Dimensionen des Theaters als "Fest des Lebens" zu erneuern. Dies geschah durch Massenfestspiele und eine Lebensreformbewegung, die konservative Werte und ein naturgemäßes Leben idealisierte. In der Schauspielkunst wurden Stilisierung und Kunsthaftigkeit wichtiger, und Bühnen- und Zuschauerraum wurden an diese neuen Ideen angepasst, indem man von Guckkastenbühnen abwich und Räume für ein Gemeinschaftserlebnis schuf.
Wer war Emile Jaques-Dalcroze?
Emile Jaques-Dalcroze war ein Schweizer Musikpädagoge und Komponist, geboren 1865 in Wien. Er ist bekannt als der Begründer der rhythmischen Gymnastik. Er war Schüler von Anton Bruckner und lehrte an einem Genfer Konservatorium, wo er eine neue Form von Tanzgymnastik entwickelte. 1911 zog er nach Hellerau bei Dresden, um dort sein Arbeitszentrum zu errichten.
Was war die Hellerauer Schule und welche Bedeutung hatte sie für Dalcroze?
Die Hellerauer Schule befand sich in der Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Dalcroze kam auf Initiative von Wolf Dohrn nach Hellerau und arbeitete eng mit Adolphe Appia zusammen. Das Hellerauer Festspielhaus, entworfen von Tessenow, wurde zum Mittelpunkt der "Bildungsanstalt Jaques-Dalcroze". Die Architektur des Festspielhauses setzte die neuen Ideen der Theaterreform um. Bis 1914 fanden in Hellerau Schulfeste statt, auf denen die Arbeitsergebnisse vorgeführt wurden. Die Anstalt wurde zu Beginn des Kriegsausbruchs geschlossen, aber Dalcrozes Ideen verbreiteten sich in ganz Europa.
Was sind die Grundgedanken in Dalcrozes' Schriften bezüglich Rhythmus und Bewegung?
Dalcroze sah im Rhythmus das lebendige Wesen des Gefühls und die Basis jeglichen körperlichen und musikalischen Ausdrucks. Rhythmus erfordert Ordnung, Maß und Harmonie und ist Bewegung, die von Raum, Zeit und Dynamik abhängt. Die rhythmischen Elemente der Musik sind dem Rhythmus des Körpers entlehnt. Die Fähigkeit, Rhythmus zu empfinden und auszuführen, ist angeboren und kann durch Training geschult werden. Arhythmie bezeichnet Dalcroze als das Unvermögen, sich selbst zu kontrollieren. Durch Automatisierung körperlicher Vorgänge wird Körperbeherrschung und somit geistige Freiheit ermöglicht.
Wie definierte Dalcroze Kunst und Ästhetik?
Für Dalcroze ist Kunst nicht nur ein Mittel, das Leben auszudrücken, sondern das Leben selbst und die Art, es innerlich zu erfühlen. Bewegung liegt allen Künsten zugrunde, und Tanz ist die Kunst, Gefühle mit Hilfe rhythmischer Körperbewegungen auszudrücken. Künstlerisches Genie besitzt jemand, der Einbildungskraft und Ordnung besitzt und die Bewegungen aller Einzelseelen seiner Gesellschaft zu einer Gesamtheit zu vereinigen und auszudrücken vermag. Form, Regeln, Perfektion und Verstand sind sekundär, und der Künstler soll das Wesentliche aus seinen Empfindungen herausfiltern und zu den Urgefühlen und der Einfachheit des Ausdrucks zurückkehren.
Wie sah Dalcroze das Verhältnis von Musik, Bewegung und Tanz?
Musik und Tanz sind für Dalcroze eine zwiefache, jedoch einheitliche Sprache, um grundlegende Empfindungen auszudrücken. Sie sollen einander durchdringen. Der Tänzer muss in der Lage sein, die durch die Musik hervorgerufene ästhetische Erregung spontan in Handlungen und Gebärden zu übersetzen. Der Tänzer soll nahezu nackt auftreten, um die Bewegungen klar und unverschleiert betrachten zu können. Musik besteht aus Klang und Bewegung und soll nicht nur vom Verstand, sondern auch vom Körper erfasst werden. Ziel des Zusammenwirkens von Musik und Tanz ist ihre Verschmelzung.
Welche Anmerkungen machte Dalcroze zur Licht- und Bühnengestaltung?
Dalcroze kritisierte gemalte Kulissen, da sie der Dreidimensionalität der Bewegung widersprechen. Er empfahl, Treppen und abweichende Untergründe zu verwenden, um neue Wirkungsmöglichkeiten zu schaffen. Vorkommende Gegenstände sollen durch Bewegungen illusorisch dargestellt werden, und der Raum zwischen Bühne und Orchester soll abgeschafft werden. Licht und Musik sollten innerhalb einer Aufführung aufeinander abgestimmt werden.
Wie beschrieb Dalcroze die Wahrnehmung und das Empfinden von Kunst?
Der Hörer muss sich beim Anhören eines Tonwerkes sagen: "Diese Musik, das bist du!". Der ausgebildete Rhythmiker fühlt die Bewegung, die ein anderer vollzieht, und kann räumlich-zeitliche Einstellung und den Aufwand an Muskelkraft nachfühlend ermessen. Man kann ein Werk weder beurteilen noch wirklich kennen, wenn es einem nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist.
- Quote paper
- Liana Richter (Author), 2000, Emile Jaques Dalcroze und die Hellerauer Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96553