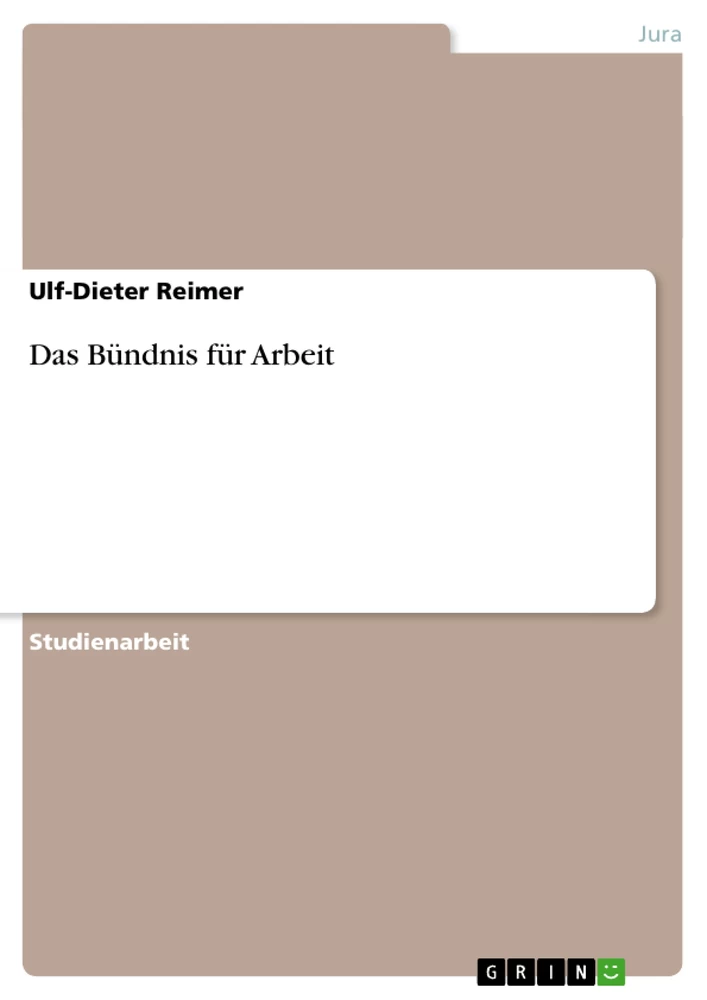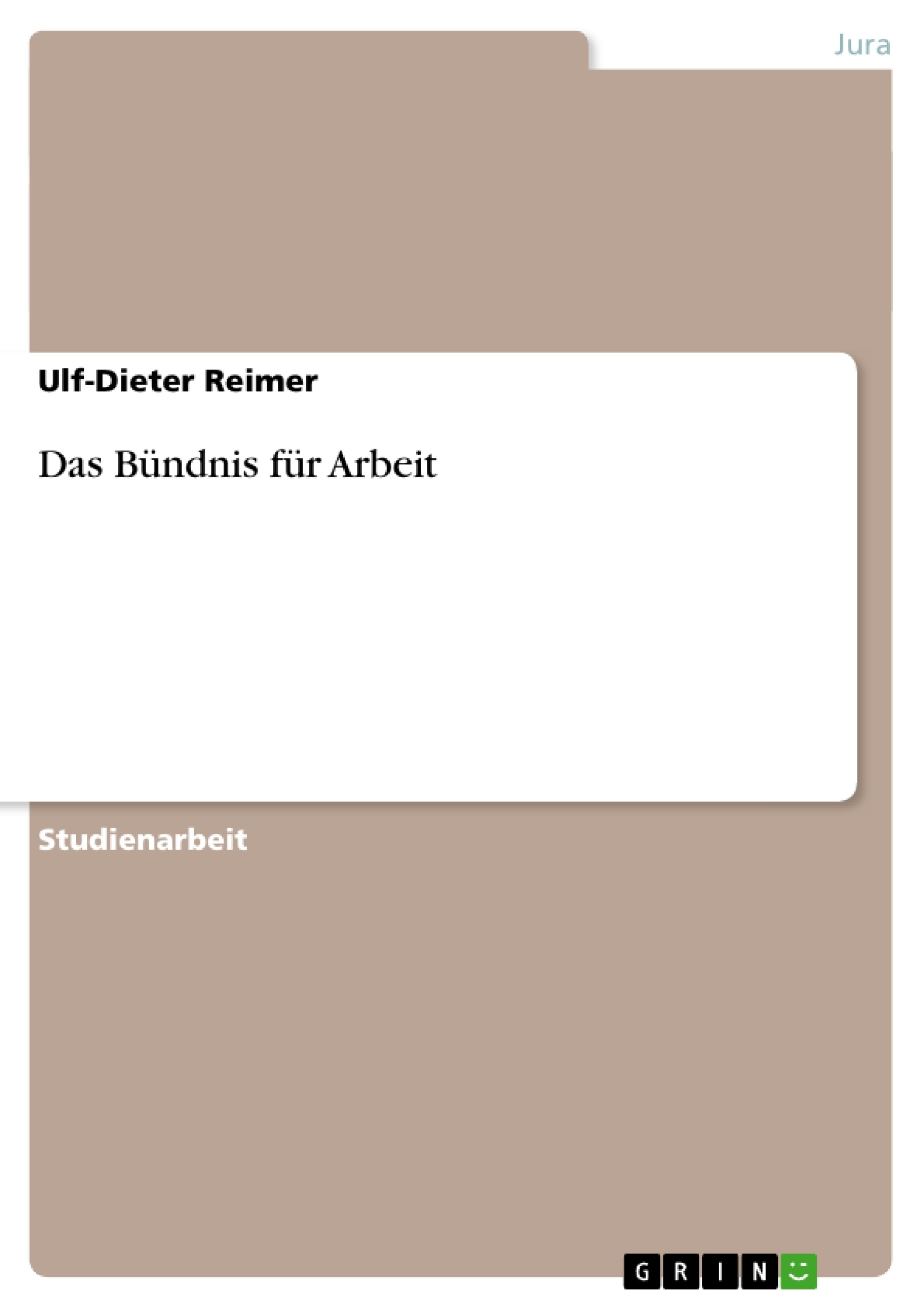Inhaltsübersicht
I. Einleitung
II. Die Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“
III. Die Sicht der Wirtschaftsverbände
IV. Die Sicht der Gewerkschaften
V. Das Regierungsprogramm für das „Bündnis für Arbeit“
VI. Ergebnisse der Spitzengespräche
VII. Internationale Beispiele für ein „Bündnis für Arbeit“
VIII. Alternative Konzepte einer Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
IX. Schlußbemerkung
Anlagen:
I. Grafik zum Verlauf der Arbeitslosigkeit in Deutschland
II. Tabelle zur Struktur und zum Aufbau des „Bündnisses für Arbeit“
III. Gemeinsame Erklärung der „Bündnisses für Arbeit“
IV. Gemeinsames Positionspapier von DGB und BDA
Einleitung
Quellenverzeichnis
I. Einleitung
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich im letzten Jahrzehnt in der Bundesrepublik drastisch erhöht. Mitunter lag sie schon bei der 5 Mio. Grenze. Vor allem das Problem der Dauerarbeitslosigkeit scheint kaum in den Griff zu bekommen.
Hierbei ist nicht nur der Prozeß der Globalisierung, nach dem Unternehmen einzelne Betriebszweige ins Ausland verlegen oder auch billigere Produkte aus anderen Ländern nach Deutschland gelangen, als Grund zu nennen, sondern vor allem auch die massiven Rationalisierungsmaßnahmen als Folge technischen Fortschritts oder der Zusammenlegung von Betriebsbereichen nach Fusionen und Unternehmenskonzentrationen.
Ein weiterer wichtiger Grund für die steigende Arbeitslosigkeit, der die deutsche Arbeitsmarktpolitik im besonderen herausfordert, sind die Folgen der Wiedervereinigung. Der Zusammenbruch der Zentralverwaltungswirtschaft der ehemaligen DDR und der Versuch eines Übergangs in die offenen Gesellschaft stellen die Regierungsverantwortlichen vor große Probleme. Die immer noch fehlende Infrastruktur in vielen Gebieten der ehemaligen DDR, die Verwaltungsdefizite, die einem wirtschaftlichem Umbau im Wege stehen, die hohe Nachfrage der Ostbevölkerung nach Gütern aus Westdeutschland und -europa und nicht zuletzt die fehlende Vorbereitung der ehemaligen DDR-Bürger auf die Funktionsweise der Sozialen Marktwirtschaft sind - in Verbindung mit den o.g. Gründen - nur einige Ursachen für die besonders hohe Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern.1
Langfristig lösbar scheint dieses Problem nur mit einer vernünftigen und ordentlichen Lohnpolitik, sowie Beschäftigungspolitik.
Wenngleich nun das Grundgesetz in Art. 9 Abs.3 die Festlegung der Löhne und der Arbeits- zeiten den Tarifpartnern zuweist, so haben Bundesregierung und Gesetzgebung doch einen erheblichen Einfluß auf die entstehenden Kosten des Faktors Arbeit, weil sie nicht nur die Lohnnebenkosten bestimmen, sondern auch Arbeitslosen- und Sozialhilfe festlegen, die in ihrer Höhe oft nur gering unter den Niedriglöhnen liegen. Des weiteren tritt der Staat auch selbst als Arbeitgeber gegenüber den Beamten auf. Die Lösung des Beschäftigungsprob- lems kann daher nur in einem Miteinander der genannten Interessengruppen gefunden wer- den.
Deshalb hat der Vorsitzende der IG Metall, Klaus Zwickel, im Herbst 1995 die Forderung nach einem „Bündnis für Arbeit“ gestellt. Dabei sollen die Gewerkschaften Zugeständnisse bei Tarifverhandlungen in Aussicht stellen und die Arbeitgeber als Gegenleistung Zusicherungen hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherung machen. Würde also die Gewerkschaftsseite zunächst von Lohnerhöhungen absehen, könnten Produktionsgewinne beim Arbeitgeber verbleiben, der sich wiederum verpflichtet, diesen Gewinn in die Schaffung neuer Arbeits- plätze zu investieren. Der Bundesregierung fällt hiernach die Aufgabe zu, ihre Sparpolitik nicht in den sozialen Bereich hineinzuziehen, um Arbeitslosenunterstützung, Arbeitsbeschaf- fung und Sozialhilfe auf konstantem Niveau zu halten, damit die Nachfrage gesichert bleibt.
Mit der Regierungsübernahme im September 1998 durch die Sozialdemokraten und das Bündnis 90/Die Grünen hat die Zwickel-Idee vom „Bündnis für Arbeit“ an Gewicht gewonnen. Als ein arbeitsmarktpolitisches Alternativkonzept soll dieses Bündnis hier zunächst gewürdigt werden.
Die vorliegende Arbeit geht auf die historische Vergangenheit des „Korporatismus“ ein und soll anhand der heutigen Sichtweise der beteiligten Interessengruppen diese Problematik der deutschen Arbeitsmarktpolitik verdeutlichen.und an ihrem Ende weitere Lösungsmöglichen veranschaulichen.
Ulf Reimer / Nina Buchholz
Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 5
II. Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“
1. Der Neokorporatismus
Als Neokorporatismus bezeichnet man die Beteiligung von Interessengruppen an der Politik, und zwar durch wechselseitige Organisationsbeziehungen zwischen Bundesregierung und politischer Verwaltung auf der einen Seite und starken zentralisierten Verbänden auf der an- deren Seite.2
Beim Neokorporatismus handelt es sich also um eine Art Steuerungspartnerschaft von den entsprechenden Regierungsakteuren und den gesellschaftlichen Interessenvertretern unter- einander.
Solche Einflüsse der Interessenvertreter auf die Politik sind längst Bestandteil jeder liberaldemokratischer Regierungssysteme.3
Schon in der Nachkriegszeit wurden positive Aspekte pluralistischer Verbändekonkurrenz erkannt und nicht mehr mit illegitimer Interessensdurchsetzung gleichgesetzt.4 Eine Einflußnahme dieser Art ist aber nicht unbedingt mit dem „Lobbyismus“ gleichzusetzen, bei dem Entscheidungsprozesse des Parlaments und der Bundesregierung in eine bestimm- te Richtung zu lenken versucht werden, sondern im Korporatismus werden die Verbände verbindlich und regelmäßig an politischen Entscheidungen beteiligt, also „inkorporiert“. Als Musterbeispiel einer solchen Korporation galt die seit 1977 bestehende Interessenver- mittlung im Gesundheitswesen. Hierbei arbeiten Vertreter der Ärzteschaft, der Versicherun- gen und der Krankenhausträger gemeinsam an einer Kostendämpfung zur Erhaltung des sozialen Sicherungssystems, um so dem Konsumentenbedürfnis gerecht werden zu kön- nen.5
So könnte der Neokorporatismus auch eine Lösungsmöglichkeit für den Bereich der Arbeits- politik bieten, denn aus der gegenseitigen Abhängigkeit der drei Interessengruppen, wird eine Dreieckskooperation, in der wirtschaftspolitisch sinnvolle Leistungen und Regelungen abgestimmt, ausgetauscht und gemeinsam verabschiedet werden. Es gilt also, Kompromis- se zu finden, bei der die beteiligten Akteure zu gleichen Teilen so belastet werden, daß ihre Bereitschaft zur Kooperation gegeben bleibt und daß damit der Gesamtwirtschaft geholfen werden kann.
Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 6
2. Die Jahre 1966 bis 1998
Es gab in der bundesdeutschen Geschichte bereits einmal den Versuch, mittels einem offiziell institutionalisierten dreiseitigem Arrangement zwischen Regierung, Gewerkschaf- ten und Arbeitgeberverbänden Inflationstendenzen und vor allem die anschwellende Ar- beitslosigkeit zu bekämpfen.6 Damals wurde der Begriff der Konzertierten Aktion etabliert und umfaßte die Periode von 1967-1977. Die Bundesrepublik befand sich damals in ihrer ersten wirtschaftlichen Rezessionsphase, die dazu führte, daß der Glaube an die immer- währende Prosperität des deutschen sozialen Kapitalismus ins Wanken geriet. Der wirt- schaftlichen Krise folgte eine politische, die im Rücktritt der Regierung Ludwig Erhard im Jahre 1966 ihren Ausdruck fand.7
Die Etablierung der Idee der „Konzertierten Aktion“ erfolgte ohne größere Probleme, denn einerseits existiert in Deutschland die Tradition einer stark verbändezentrierten Aushandlungspolitik8 und andererseits schien dies eine situationsadäquate Antwort auf die damalige politische Umbruchsstimmung und die aufsteigenden wirtschaftlichen Krisenindikatoren wie Haushaltsdefizit, Reduktion des Wirtschaftswachstums, steigende Inflations- und Arbeitslosenzahlen zu sein.
Man war sich einig, daß die Krise mit einem neuen Politikmodell überwunden werden konnte. Somit wurde das im liberalen System der Marktwirtschaft angelegte System der weitestgehenden Selbststeuerung der Wirtschaft, das die bürgerliche Koalition unter Kanzler Erhard vertreten hatte, abgelöst durch die vor allem von dem damaligen Wirt- schaftsminister Karl Schiller (SPD) vertretende Politik der Globalsteuerung seitens des Staates. In dieser Phase folgte eine Hinwendung zu den Theorien des britischen Ökono- men John Maynard Keynes, wonach der Staat mit seinen wirtschaftspolitischen Instru- menten die Konjunktur lenken und in Rezessionen entgegensteuern kann.9
Seine regierungsamtliche Entsprechung fand dieser Gedanke in dem am 10. Mai 1967 verabschiedeten „Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft“. Durch dieses Gesetz sind Bund und Länder verpflichtet, im Rahmen der vorgegebenen marktwirtschaftlichen Ordnung eine Reihe von Zielen gleichzeitig anzustreben und nach Möglichkeit zu erreichen:
- Einen hohen Beschäftigungstand · stabile Preise
- außenwirtschaftliches Gleichgewicht · und stetiges Wirtschaftswachstum.10
Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 7
Im Falle einer Gefährdung eines dieser Ziele, stellt die Bundesregierung im Rahmen i- ner Konzertierten Aktion Orientierungsdaten auf, um auf diese Weise auf die Tarifpartner in seinem Sinne einzuwirken11.
Das erste Spitzengespräch der Konzertierten Aktion fand am 17. Februar 1967 statt und an ihm nahmen 34 Personen aus 9 Organisationen teil. Die Unternehmer versprachen sich von ihrer Beteiligung an den Gesprächen eine Versachlichung der Tarifpolitik, d.h. eine Reduzierung von Kosten (durch moderate Tarifabschlüsse) und Konflikten (Streiks), sowie verbesserte Rahmenbedingungen für erneutes wirtschaftliches Wachstum. Eingriffe in die Dispositionsfreiheit waren für sie Tabu.12
Für die SPD bildete die Bündniskonstellation die Basis für die Etablierung einer neuen politischen Mehrheit in Deutschland. Da die Themen Abbau der Arbeitslosigkeit und nfla- tionsbekämpfung im Zentrum der Diskussion standen, lag es auf der Hand, daß die Ge- werkschaften durch ihre Teilnahme auf eine Politik der Lohnzurückhaltung festgelegt werden sollten. Weshalb ließen Sie sich trotzdem auf eine Beteiligung ein ? Zum einen wollten sie sicherlich den sozialdemokratischen Regierungswechsel mit herbeiführen, mit dem sie die Hoffnung auf einen staatliche Beitrag zu mehr Verteilungsgerechtigkeit und somit Verwirklichung des Prinzips der sozialen Symmetrie verbanden. Auch wollten sie als gleichberechtigter gesellschafts- und wirtschaftspolitischer Akteur ernst genommen werden. Wie zerstritten sie allerdings innerorganisatorisch in diesem Punkt war - Kritiker befürchteten nachteilige Auswirkungen für die weitere Tarifpolitik - zeigt das Ergebnis der Kampfabstimmung über den Verbleib in der Konzertierten Aktion auf dem IG-Metall Ge- werkschaftstag 1968 in München. Dort votierten 200 Delegierte dafür und 163 gegen den Verbleib bei den Gesprächen.13 Tatsächlich blieben die Tarifabschlüsse 1967-1969 im Rahmen der vorgegebenen Daten. Allerdings verbesserte sich die ökonomische Lage zunehmend, so daß die länger wirkenden Tarifabschlüsse unterhalb der Produktivität lagen. 1969 kam es zu spontanen Streiks, die die Lohnentwicklung zu gunsten der Ar- beitnehmer wieder korrigierten und eine offensivere Gangart in der Tarifpolitik einleiteten, so daß die Tarifabschlüsse 1970 -1973 oberhalb der Rahmendaten lagen.
1977 scheiterte die „Konzertierte Aktion“, unter anderem auch daran, daß der Teilnehmerkreis sich inflationär ausgeweitet hatte (von anfangs 34 Personen auf 90) und faktisch keine Entscheidungsfähigkeit mehr gegeben war.14
In den Folgejahren war nun die Idee kooperativer Krisenbewältigung nicht mehr auf der zentralen, bundesstaatlichen Ebene angesiedelt, sondern auf der regionalen, sektoralen und betrieblichen Ebene. Mit dem Regierungswechsel von 1982 ging auch ein politischer Paradigmenwechsel einher. Während die Gewerkschaften mit Ihrer aktiv vertretenen Lohnpolitik aus keynesianischer Sichtweise eine positive Rolle bei der Herstellung ökonomischer Stabilität spielten, wurden den sie in der aufsteigenden neo-liberalen Orientie- rung der CDU/FDP-Regierung unter Kanzler Kohl skeptischer betrachtet15. Die von ihnen verfochtenen arbeitsrechtlichen Regulierungen stellen nach Meinung der Neo- Liberalisten eher ein Wachstumshemmnis für das ökonomische Wachstum dar. Die ar- beitsmarktpolitischen Aktivitäten der Regierung Kohl setzen also auf Deregulierung und bedeuteten somit eine gewisse Abkehr vom Sozialkonsens und Inkorporation der Sozial- partner. Wichtige Konfliktthemen aus dieser Zeit waren das Beschäftigungsförderungs- gesetz (1985), die Änderung des §116 Arbeitsförderungsgesetz (jetzt §146 SGB III), die Verschlechterung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (1996) und des Kündigungs- schutzes (1996).16
Der Vorschlag zur Schaffung eines „Bündnisses für Arbeit“ wurde erstmalig am 30. Okto- ber 1995 von dem IG Metall - Vorsitzenden Klaus Zwickel gemacht, der damit eine ko- operative Alternative zur Politik der Marktliberalisierung aufzeigen wollte. Er bot an, daß sich die gewerkschaftliche Tarifpolitik nur an der Preissteigerung orientiere und Produktivitätsfortschritt und Umverteilungskomponente unberücksichtigt blieben, wenn Arbeitgeber und Regierung im Gegenzug über drei Jahre jährlich 100.000 neue Arbeitsplätze schüfen, 100.000 Langzeitarbeitslose einstellten und auf die geplanten so- zialen Kürzungen verzichten würden.17
Doch nach einigen Spitzengesprächen scheiterte dieses Bündnis im Frühjahr 1996 an den zu konträren Grundhaltungen.
Im Bundeswahlkampf 1998 warb die SPD damit, das „Bündnis für Arbeit“ zu einem Kernprojekt ihrer Regierungsarbeit zu machen und ihr Hauptziel die Reduzierung der Arbeitslosenzahlen sei.
Durch den Sieg der Koalition von SPD - Bündnis 90/Die Grünen begann eine neue Phase einer Bündnis-Politik in der Bundesrepublik Deutschland, deren Diskussion Ziel der folgenden Abschnitte sein wird.
3. „ Konzertierte Aktion “ und „ Bündnis für Arbeit “ 1998 im Vergleich
Strukturell knüpft das „Bündnis für Arbeit“ in manchen Momenten an die „Konzertierte Aktion“ an, in anderen unterscheidet es sich deutlich.18
Gleich ist die formale Aufteilung in Spitzengespräch, Steuerungsgruppe und Arbeitsgrup- pen, die alle paritätisch besetzt sind.19 Ein entscheidender Unterschied liegt allerdings in der Teilnehmerzahl dieser Gremien, sie ist überschaubar und hat einer Ausweitung bis-
Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 9 her widerstanden, wodurch sich ein Spannungsverhältnis zwischen kleiner (handlungsfähiger) Eliterunde und umfassendem Integrationsgebot ergibt.20
Einen Überblick der weiteren Unterschiede und verschiedenen Ausgangslagen gibt die nachfolgende Tabelle:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schroeder, Wolfgang/Esser, Josef, „ Modell Deutschland: Von der Konzertierten Aktion zum „ Bündnis für Arbeit ““ in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3/99, 1999, S.9.
Deutlich erkennbar ist, daß sich das „Bündnis für Arbeit“ viel größeren Problemen und schwierigeren Ausgangslagen gegenüber sieht als die konzertierte Situation. Diesen Sachverhalt beschreiben Wolfgang Schroeder und Josef Esser sehr treffend, wenn sie schreiben, daß angesichts der heutigen Komplexität der Probleme die „Konzertierte Akti- on“ als eine „Schönwetterveranstaltung“21 erscheint und sich der Erwartungsdruck an die Akteure um ein Vielfaches gesteigert hat, „so daß man versucht ist, zu sagen - vom Spie- lerischen zum Existentiellen“.22
4. Struktur und Aufbau des „ Bündnisses für Arbeit “
Politischer Organisator des Bündnisses ist das Kanzleramt.23
Es übernimmt eine wichtige Koordinierungsfunktion zwischen politischem und verbandli- chem System, sowie zwischen den beteiligten Ministerien und Politikfeldern. Das wichtigste „Legitimationszentrum“24 und auch gleichzeitig die in der Öffentlichkeit präsenteste Seite des Bündnisses , sind die Spitzengespräche, an denen sechs Minister, die vier Präsidenten der Spitzengespräche der deutschen Wirtschaft und fünf Gewerk- Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 10 schaftsvorsitzende beteiligt sind. Diese Treffen finden etwa viermal jährlich statt, bisher am 7. Dezember 1998, 26. Februar 1999 und 06. Juli 1999. Geplant ist ein weiteres im Dezember.25
Unterhalb dieses Gremiums befinden sich neun Arbeitsgruppen, die BenchmarkingGruppe und die Steuerungsgruppe.26
Der Steuerungsgruppe obliegt die Vorbereitung der Spitzengespräche. Sie tagt etwa alle drei Wochen unter der Führung des Kanzleramtes und ist zusammengesetzt aus Staatssekretären, Hauptgeschäftsführern der Unternehmerverbände und leitenden Funktionären der Gewerkschaften.
Als Dienstleistungszentrum des Bündnisses könnte man die aus Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlern zusammengesetzte Benchmarking-Gruppe bezeichnen.27 Ihre rechtliche Grundlage findet diese Gruppe von Wissenschaftlern in der GGO II der BMin. § 24 f.. Danach können wissenschaftliche Fachkreise und Vertreter der Spitzenverbände für die Vorbereitung der Gesetze herangezogen werden.
„Benchmarking“ heißt in der Wirtschaft die Methode, sich weltweit mit den besten zu messen und deren Erfolgsrezepte zu übernehmen.28 Die dort entwickelten Referenzmodelle und vergleichenden Daten helfen dabei, die deutschen Strukturprobleme einordnen zu können und zeigen mögliche Lösungswege auf. Interessanterweise wird die Benchmarking-Gruppe auch von gesellschaftlichen Kräften, wie beispielsweise der Bertelsmanngruppe, finanziell unterstützt.
In den o.g. Arbeitsgruppen29, quasi dem Unterbau des Bündnisses, werden in den jeweiligen definierten Politikfeldern Lösungsstrategien entwickelt, die dann in den Spitzengesprächen diskutiert und dort akzeptiert oder verworfen werden.
Flankiert wird das regierungsamtliche Bündnis durch vergleichbare Konstruktionen auf Länderebene sowie durch die Verständigung auf die Strategie einer gemeinsamen Be- schäftigungspolitik auf europäischer Ebene, die in der Formulierung des gemeinsamen Ziels „hohes Beschäftigungsniveau“ und dessen Aufnahme in den Amsterdamer Vertrag seinen Ausdruck fand30.
Zu den jeweiligen Interessen der Verbände und der Bundesregierung wird detailiert in den nachfolgenden Abschnitten eingegangen werden. Zum besseren Verständnis vorab ein tabellarischer Überblick der verschiedenen Positionen:
Geschichtliche Entwicklung des „Bündnisses für Arbeit“ 11
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Schroeder, Wolfgang/Esser, Josef, „ Modell Deutschland: Von der Konzertierten Aktion zum „ Bündnis für Arbeit ““ in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3/99, 1999, S.9.
Anm.: Struktur und Aufbau des „Bündnisses für Arbeit“ siehe Anlage II
Sicht der Wirtschaftsverbände 12
II. Sicht der Wirtschaftsverbände
„Die vordringlichste Aufgabe unserer Zeit ist der Abbau der Rekordarbeitslosigkeit. Die Ar- beitslosenquote muß mittelfristig auf den Stand der Deutschen Einigung zurückgeführt wer- den. Gelingt dies in den nächsten Jahren nicht, wird sich die Abwärtsspirale von sinkenden Steuereinnahmen, steigenden Sozialausgaben, sinkenden öffentlichen Investitionen und abnehmender Binnennachfrage nicht durchbrechen lassen. [...] Deshalb ist die Schaffung von Arbeitsplätzen die unabweichliche Notwendigkeit, um den Lebensstandard in der Sozia- len Marktwirtschaft zu erhalten“, so der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in ei- nem Grundsatzprogramm zur Arbeitslosigkeitsbekämpfung Anfang letzten Jahres.31
Die Wirtschaftsverbände sehen durch die herrschende Massenarbeitslosigkeit eine Gefährdung des Standorts Deutschland zu Zeiten der Globalisierung.
Schon 1995 haben die Wirtschaftsverbände die Idee vom „Bündnis für Arbeit“ begrüßt, monierten aber, daß die Idee eines solchen Bündnisses die arbeitspolitischen Realitäten in weiten Teilen außer acht ließe, so Vertreter der Arbeitgeberseite.32
Nun, einige Jahre später, da die Arbeitslosigkeit immer weiter zu steigen scheint und die Bundesregierung Schröder das Bündnis zum „Kernstück der Regierung“33 macht, wird ein neuer Versuch der Kooperation gestartet, den auch die der rot-grünen Bundesregierung eher ferne Arbeitgeberseite intensiv verfolgen möchte.
Dieter Hundt, Präsident der Bundesvereingung Deutscher Arbeitgeber (BDA), sieht im „Bündnis für Arbeit“ eine echte Chance zur Rehabilitierung des Arbeitsmarktes. Mehr noch: der Soziale Friede, also der kompromißfähige Dialog zwischen den beiden Tarifpartnern, sei ein unverzichtbarer Teil der Sozialen Marktwirtschaft. Konsens und Kompromiß statt Konflikt und Kampf, so die BDA.34
Nach herrschender Meinung der Wirtschaftsverbände baut die Soziale Marktwirtschaft in erster Linie auf den Markt, wenngleich sie den sozialen Ausgleich mitberücksichtigt. Danach müsse der Soziale Friede in Verbindung mit ökonomischen Aufgaben gesehen werden, schließlich könne in einer solchen Wirtschaftsordnung nur verteilt werden, was vorher auch erwirtschaftet wurde.35
Die BDA will also vor allem die wirtschaftlichen Fundamente - also die Unternehmen - si- chern.
1. Reform des Sozialstaates
Dazu fordern die Wirtschaftsverbände eine Reform des Sozialstaats.
Sicht der Wirtschaftsverbände 13
Das zentrale Thema, das BDI, BDA, DIHT und ZDH, also die Vertreter der Wirtschaftsverbände im „Bündnis für Arbeit“, immer wieder ansprechen, ist hierbei die Steuerpolitik. Adressat ist die Bundesregierung.
Den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Steuerpolitik begründen die Wirtschafts- verbände mit der aus ihrer Sicht viel zu hohen Belastung der Unternehmen durch die Unter- nehmensbesteuerung. So geraten ausländische Firmen beim Investieren in Deutschland unter Anpassungsdruck und beurteilen den Steuerstandort Deutschland längst negativ. Schlimmer noch: es werde zudem deutlich, daß deutsche Unternehmen ihre Betriebsstätten und Niederlassungen ins benachbarte Ausland verlegen, was ganz wesentlich auf die erheb- lichen Kostennachteile in Deutschland und des hiesigen Steuerbelastungsniveau zurückzu- führen sei.
Die sich daraus resultierende Konsequenz, wäre demnach die regelmäßig ansteigende Anzahl der Arbeitslosen.36
Die Wirtschaftsverbände erkennen hieraus die wirksamste Maßnahme zur Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit - nämlich eine spürbare Senkung der Unternehmenssteuerlast. Denn die Ertragserwartungen potentieller Investoren sei so gering, daß deshalb Innovationen und Investitionen auszubleiben scheinen.
Daher fordern die Wirtschaftsverbände, daß Einkommens- und Körperschaftssteuersätze deutlich gekappt werden. Die jeweiligen Spitzensätze für gewerbliche Einkünfte bzw. einbe- haltene Gewinne sollten danach auf 35% festgelegt werden. Auch die Gewerbeertragssteu- er, die an die Gemeinden fließt, soll nach Ansicht der Wirtschaftsverbände zurückgeführt werden.37 Gerade den Mittelstand trifft diese Steuer erheblich. In den letzten Jahren sei sie in den meisten der 192 erfaßten Gemeinden sogar noch erhöht worden und nicht gesenkt, wie zunächst versprochen.
Wichtig hierbei ist vor allem, daß den Unternehmen eine wirkliche Nettoentlastung garantiert wird, denn, so der BDI, es bringe nichts, wenn eine Senkung dieser Steuern zu Lasten der Wirtschaft gegenfinanziert würde.
Dieser Appell ist an die Politik gerichtet. Sie soll demnach die Kraft aufbringen, den Selbstfinanzierungseffekt einer grundlegenden Steuerreform in Rechnung zu stellen. Finanziert werden könne diese Reform bspw. durch eine Reduzierung der Staatsaufgaben. Internationale Vorbilder (siehe hierzu Kapitel X) zeigen, daß es gelingen kann, überzogene Ansprüche und partikulare Interessen zurückzuweisen. Gerade für Wirtschaftsbereiche, die heute noch in erheblichem Maße gegen den Wettbewerb abgeschirmt werden, bedürfe es langfristiger Konzeptionen, um sie aus der staatlichen Subventionsabhängigkeit heraus- und an normale Marktverhältnisse heranzuführen.
Die vom Bund seit Mitte der achtziger Jahre durchgeführte „Politik der Privatisierung“ wird von allen Wirtschaftsverbänden begrüßt und solle auch konsequent fortgesetzt werden. Im
Sicht der Wirtschaftsverbände 14
Bereich der Länder und Gemeinden sind Privatisierungen noch möglich. Ziel sei es, einen „Schlanken Staat“ zu errichten.
2. Reform der Tarifpolitik
Einen weiteren Schritt hin zur Vollbeschäftigung sehen die Wirtschaftsverbände in einer Re- form der Tarifpolitik. Nach Ansicht des BDA müsse diese auch wichtiger Bestandteil des „Bündnisses für Arbeit“ werden, um langfristig in diesem Bündnis erfolgreich sein zu kön- nen.38 Hierbei gerät die Seite der Wirtschaftsverbände in einen offenen Konflikt mit den Ge- werkschaften, für die das Thema Tarifpolitik im „Bündnis für Arbeit“ tabu ist. Es ist nun fraglich, inwieweit die Tarifpolitik ins „Bündnis für Arbeit“ einzubetten ist. Allerdings verteidigt man die Tarifautonomie nicht, indem man sie tabuisiert. Die Süddeutsche Zeitung schreibt hierzu: [...] Es mag zwar ungewohnt sein, daß sich die Tarifpartner an einem Tisch, an dem auch die in soweit inkompetenten Regierungsamtlichen sitzen, über Lohnleitlinien unterhalten. Es gibt aber Schlimmeres als von alten Gewohnheiten Abschied zu nehmen [...].39
Die Arbeitgeber sehen hierbei die Gefahr, daß ohne Einbeziehung der Tarifpolitik ins „Bündnis für Arbeit“, die Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen überhöhte Lohnforderungen stellen. Diese aber seien angesichts der ablaufenden Konjunktur eine „Versündigung am Standort Deutschland“.40 Zu hohe Lohnzuwächse würden massenhaft Arbeitsplätze vernichten und nur eine langfristig moderate Tarifpolitik, wie in den Niederlanden, Italien oder Irland, könne das Bündnis erfolgreich gestalten.41
Im Bereich der Lohnpolitik wünschen sich die Wirtschaftsverbände die Einrichtung eines Niedriglohnsektors. Dabei soll vor allem für die unzähligen arbeitslosen Geringqualifizierten ein Anreiz geschaffen werden, eine Arbeit anzunehmen, die sie unabhängig von staatlicher Unterstützung macht. Da aber Sozial- und Arbeitslosenhilfe einem Niedriglohn annähernd gleichkommen, wird sich die Motivation der Arbeitslosen zum Wiedereinstieg ins Berufsleben in Grenzen halten.
Die Arbeitgeber sehen hier die Möglichkeit einer Kombination aus Arbeitseinkommen und steuerfinanzierter Transferleistung. Letztere aber zielt dabei auf die individuelle Bedürftigkeit. Diese staatlichen Zuschüsse zielen auf die Sozialversicherungskosten. Nach Ansicht der BDA haben nur erwerbslose Gerinqualifizierte, Langzeitarbeitslose und erwerbsfähige Sozi- alhilfeempfänger Anspruch auf derartige Subventionen.42 Unterstützt sollen danach also nicht die Arbeitsplätze oder Arbeitgeber sondern nur der Beschäftigte im Billig-Job, wenn seine
Sicht der Wirtschaftsverbände 15
Einkommens- und Vermögenslage es erfordern. Eine individuelle Hilfe anstelle einer generellen Subventionierung.43
So würden auch die Anreize zur Annahme eines Niedriglohn-Arbeitsplatzes verbessert wer- den.44 Allerdings müßte der Staat, würde er bspw. bei einem Brutto-Monatsgehalt von DM
3.000,-- einen Teil der Sozialabgaben übernehmen, in die Lohnpolitik eingreifen. Vermutlich liegt es auch deshalb der BDA am Herzen, daß die Lohnpolitik zum Thema des „Bündnis für Arbeit“ wird - schließlich sitzt die Bundesregierungja mit am Verhandlungstisch.
3. Flexibilisierung der Arbeitszeiten
Einen weiteren Grund für die Einbeziehung der Tarifpolitik in das „Bündnis für Arbeit“ sehen die Wirtschaftsverbände in der Möglichkeit, die Arbeitszeiten zu flexibilisieren. Hierbei fordern sie eine Reform des Flächentarifvertrages, zumindest aber eine Liberalisie- rung der Arbeitszeitpolitik. Würden Arbeitszeiten weiterhin kollektiv rationiert werden, so kön- nen sich die Betriebe nicht mehr sachgerecht auf die spezielle Absatzsituation und die Ar- beitspräferenzen der Belegschaft einstellen. Die BDA schlägt daher vor, die Arbeitszeit in Tarifverträgen nicht mehr auf Wochen- oder Monatsbasis, sondern auf das ganze Jahr zu definieren. In Perioden mit großer Nachfrage würde danach mehr, in Perioden geringerer Nachfrage entsprechend weniger gearbeitet werden. So würden also erst dann Mehrarbeits- zuschläge anfallen, wenn das Jahresarbeitszeitvolumen überschritten ist. Durch flexible Jah- resarbeitszeitsysteme könnten dann Arbeitszeiten viel produktiver genutzt werden und das gesamtwirtschaftliche Überstundenvolumen würde drastisch gesenkt. Dies könne dann zu einer Entlastung der Arbeitskosten seitens der Unternehmen führen.
Die Wirtschaftsverbände sind sich auch einig, das Wochenende in den Produktionszyklus mit einzubeziehen. Ihrer Meinung nach könne dies sofort zu einem zusätzlichen Bedarf an Arbeitsplätzen führen und daher beschäftigungsfördernden Charakter haben. In den Flächentarifverträgen aber wird der Samstag tabuisiert.45
Auch der Sonntag müßte in die Arbeitszeit integriert werden können, da einige Branchen diesen Tag als Element flexibler Arbeitszeiten benötigen. Grundsätzlich aber ist der Sonntag als Arbeitstag verboten und die zulässigen Ausnahmen können noch nicht allen Bedürfnissen der Praxis begnügen, so die Meinung des DIHT.46 Eine dahingehende Flexibilisierung der Tarifpolitik sei vor allem dort wichtig, wo sich Unternehmen im internationalen Wettbewerb ausländischen Konkurrenten mit teilweise erheblich besseren Betriebsnutzungmöglichkeiten durch flexible Arbeitszeit gegenüber sehen.47
Sicht der Wirtschaftsverbände 16
Insgesamt, so wurde deutlich, zielen die Wirtschaftsverbände auf eine Erhöhung der betrieblichen Entscheidungskompetenz. Ihrer Meinung nach müssen Tarifverträge betrieblich ausgestaltbare Rahmenbedingungen enthalten, damit sich individuell auf die eigene Situation am Markt eingestellt werden kann, sonst würde der Tarifvertrag zur wachstumshemmenden Fessel am Bein der Unternehmen werden.
In einem weiteren Konflikt mit den Gewerkschaften befinden sich die Wirtschaftsverbände bezüglich der Lage in den neuen Bundesländern. Zwar ist man sich einig, daß investitions- freundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, um den Arbeitsmarkt dort zu beleben. Kontrovers betrachtet wird aber auch hier die tarifpolitische Situation, die ein ge- meinsames Vorgehen erschwert. Nach Meinung der Arbeitgeber zielen die Gewerkschaften hier primär auf eine generelle Anpassung der Löhne an das Westniveau. Die BDA jedoch verlangt, daß die Arbeitnehmer Tarifvereinbarungen mit tragen, die auch auf die jeweilige Situation im Osten zugeschnitten sind.48
Insgesamt ist festzuhalten, daß die Wirtschaftsverbände bei der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit die Unternehmen entlasten wollen. Sie seien die Stütze der Marktwirtschaft. Ein „Bündnis für Arbeit“ kann daher ihrer Meinung nach nur erfolgreich sein, wenn in erster Linie unternehmenssteuer- und tarifpolitische Aspekte beachtet und zu Gunsten der Unternehmungen reformiert werden.
IV. Die Sicht der Gewerkschaften
Da der IG-Metallvorsitzende Klaus Zwickel es 1995 war, der den Anstoß für eine erneute Kooperation zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände und der Regierung zur Lösung gesamtwirtschaftlicher Probleme gab, und den Begriff „Bündnis für Arbeit“ schuf, ist die Gewerkschaftsseite diesem Gedanken eng verbunden. Dies heißt allerdings nicht, daß das „Bündnis für Arbeit“ und sein bisheriger Verlauf aus ihrer Sicht nur positiv zu be- urteilen sind. Was die gewerkschaftliche Position zum Abbau von Arbeitslosigkeit beson- ders kennzeichnet ist die Tatsache, daß ihnen nicht nur, wenn auch natürlich vorrangig, an der quantitativen Ausweitung der Arbeit gelegen ist, sondern sie auch qualitative Standards definieren und sichern will49. Dazu gehören beispielsweise Arbeitsplatz- und Arbeitszeitbedingungen.
Zu Beginn der neuerlichen Initiative eines Bündnisses gab der DGB-Vorsitzende Dieter Schulte zwei Vorsätze und einen Appell für bzw. an das Bündnis bekannt.50 Er bekannte sich zu einer „langfristigen und konfliktfähigen Zusammenarbeit“51 sowie einem „offenen und fairen Umgang miteinander.“52 Sollte dieses gelingen, so würde das „Bündnis für Ar- beit“ „zum Ausdruck eines neuen Politikstils werden, den man als kooperative Demokratie bezeichnen könnte.“53 Für ihn ginge es nicht um Sieger und Besiegte, sondern um den gemeinsamen Nutzen.54 Weiterhin führte er aus, daß die „Alternative zum erstrittenen Konsens Stagnation hieße“ und diese hätte in Deutschland seiner Ansicht nach lange genug vorgeherrscht.
Anders als bei dem ersten Bündnisversuch 199555 sollte vermieden werden, eine zah- lenmäßige Zielvorgabe für den Abbau der Arbeitslosigkeit zu nennen. Es ginge vielmehr darum, sich auf Maßnahmen für konkrete Beschäftigungsziele zu einigen. Inhaltlich for- dert der DGB vor allem den Abbau der Jugendarbeitslosigkeit sowie die Nutzung des Instruments der Arbeitsumverteilung im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, wie beispiels- weise der Abbau von Überstunden, Arbeitszeitverkürzung und die Ausweitung der Teil- zeitarbeit und Altersteilzeit.56
Der obengenannte Appell richtet sich wesentlich an die Wirtschafts- und Arbeitgeberver- bände. Aus Schultes Sicht wurde die Regierung Kohl, die deren „Wünsche, Vorschläge
und Rezepte (gegen die Arbeitslosigkeit) in höchstem Maße verwirklicht57 hatte, vor allem aus diesem Grunde abgewählt“58.
Er fordert, daß die Strategien der Vergangenheit (Deregulierung und Stärkung des markt- lichen Wettbewerbs) zugunsten neuer Wege und Ansätze revidiert würden. Undenkbar ist
- aus gewerkschaftlicher Sicht - eine Konstellation, bei der es nur darum geht, die Ge- werkschaften auf moderate Tarifabschlüsse festzulegen. Auf diese Diskussion der The- matisierung der Lohnpolitik im „Bündnis für Arbeit“ wird später noch gesondert eingegan- gen werden.
In seinem Positionspapier „Ein „Bündnis für Arbeit“, Bildung und soziale Gerechtigkeit“ legte der DGB-Bundesvorstand am 06. Oktober 1998 Wege zu einem neuen Bündnis sowie Leitbilder für ein - aus ihrer Sicht - tragfähiges Bündnis vor.59
Der DGB betont darin unmißverständlich, daß eine grundlegende strategische Neuorien- tierung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen unumgänglich sei, solle das Bündnis funk- tionieren. Untragbar sei die Weiterführung der einseitig auf die Kräfte des Marktes set- zende Angebotspolitik, die die sozialstaatlichen Sicherungssysteme abbaue, die gesell- schaftliche Ungerechtigkeit vermehre sowie den Konsens durch Konfrontation ersetze.60 Die hohe Massenarbeitslosigkeit in Deutschland, die Herausforderung der sozialen Si- cherungssysteme durch die demographische Entwicklung und die Finanzierungsproble- me aller staatlichen Ebenen erfordern Verständigung und Kooperation. Der DGB hält ein „Bündnis für Arbeit“ für notwendig, da der schnelle Abbau der Massenarbeitslosigkeit und die Verwirklichung von mehr sozialer Gerechtigkeit am „ehesten im Zusammenwirken von Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften möglich sei.“61 Die Gewerkschaften signalisieren jedoch auch schon hier ihre Konfliktbereitschaft, indem sie zwar einen fairen Ausgleich der Interessen anstreben, jedoch betonen, daß keinesfalls die Artikulation gegensätzli- cher Interessen „unter den Tisch fallen “62 dürfe.
Als Leitbilder für ein Bündnis schlägt der DGB sieben Punkte vor:63
1. Eine gerechte und solidarische Verteilung von Arbeit und Einkommen
Dieses beinhaltet die Forderung nach Verkürzung der individuellen und kollektiven Ar- beitszeit aufgrund hoher Produktivitätsraten in Industrie und Dienstleistungen in Zusam- menhang mit einem tendenziell sinkenden Arbeitsvolumen. Vorrangig müßten nach Mei- nung des DGB neue Möglichkeiten eröffnet werden, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen, die Altersteilzeit zu verbessern, die Teilzeitarbeit zu fördern und Überstunden abzubauen. Möglich wäre es nach Ansicht der Gewerkschaften, rund die Hälfte der jährlich anfallen-
Die Sicht der Gewerkschaften 19
den 1,8 Milliarden Überstunden in Arbeitsplätze umzuwandeln.64 So soll in Zusammenar- beit mit der Arbeitgeberseite eine Begrenzung der Überstunden vereinbart werden und in Branchen, in denen sie regelmäßig anfilelen, entsprechende Tarifverträge abgeschlossen werden.
Des weiteren wird eine Verkürzung der tariflichen Wochenarbeitszeit ohne Verminderung des Monatseinkommen (finanziert durch Tariffonds) vorgeschlagen. Verbunden werden sollte dieses weiterhin mit mehr Zeitsouveränität und Flexibilität, z.B. durch Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten.
2. Innovative und moderne Industrie- und Dienstleistungsunternehmen
In diesem Punkt geht es um die Sicherung und Schaffung von bestehender und zukünfti- ger Arbeitsplätze durch Förderung von Innovationen. Hierbei sollte es nicht zu einem Ab- bau von Qualität und Innovation durch alleinige Senkung der Lohn- und Lohnnebenkos- ten kommen. Der DGB sieht den Schlüssel für Modernisierung und Experimentierfähig- keit in der Beteiligung und Mitbestimmung von Arbeitnehmern und Gewerkschaften. Die- se Praxis sollte nicht nur gesetzlich sondern auch tarifvertraglich ausgebaut werden.
3. Eine sozialverträgliche und arbeitsplatzschaffende Umwelt- und Energiepolitik
Erwähnt werden hier die Ökosteuer und die Schaffung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten im Energie- und Umweltsektor.
4. Zukunftsfähige Aus- und Weiterbildung
Der DGB weist darauf hin, daß Bildung, Aus- und Weiterbildung das notwendige „innovative Kapital“65 seien, mit dem Wirtschaft- und Gesellschaft den Herausforderungen des Strukturwandels gerecht werden können. Deshalb seien zentrale Ziele der Abbau der Jungendarbeitslosigkeit, die Sicherung des dualen Ausbildungssystems und Investitionen in Bildung, Schulen und Hochschulen.
5. Ein funktionsfähiger Sozialstaat mit sozial gerechter Steuerbelastung
Nach Meinung der Gewerkschaften sollte das Steueraufkommen gerechter verteilt wer- den. Dieses beinhaltet eine Steuer- und Abgabenentlastung der unteren und mittleren Einkommensgruppen, die Förderung von arbeitsplatzschaffenden und sichernden Investi- tionen und Innovationen und die Besteuerung von großem Privatvermögen und von Spekulationsgewinnen.
Zudem sei das Steuersystem zu vereinfache und auch die Leistungen der Sozialversicherung dahingehend zu überprüfen, ob sie effektiv eingesetzt würden. Die Versicherungspflicht solle ausgedehnt werden und mittelfristig müßte ein neues Gleichgewicht zwischen gesetzlicher Sozialversicherung, betrieblicher und tarifvertraglicher Zusatzversorgung sowie privater Eigenvorsorge gefunden werden.
6. Gerechtere Vermögensverteilung
Eine wichtige gewerkschaftliche Forderung ist der Ausbau und die verstärkte Förderung von Beteiligungen der Arbeitnehmer an den Unternehmensgewinnen. Dadurch hätten gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen die Chance, ihre Eigenkapitalbasis zu verbessern. Zu berücksichtigen sei aber die Absicherung dieser Beteiligungen gegen Risiken.
7. Ein sozialer und beschäftigungsförderner Prozeßder europäischen Einigung
Die Vollendung des Binnenmarktes und die gemeinsame Währung böten Chancen für neue und sichere Arbeitsplätze. Der DGB will diesbezüglich die Chancen nutzen, z.B. durch Förderung der europäischen Dimensionen in Aus- und Weiterbildung oder Hilfen für strukturschwache Regionen, und die Risiken mindern, etwa durch eine europäische Mitbestimmungscharta.
Anhand dieser Punkte sollten die grundsätzlichen Tendenzen der gewerkschaftlichen Richtung deutlich geworden sein.
Sieht man nun die konträren Ansichten der Partner im „Bündnisses für Arbeit“, wird sichtbar, welche Konflikte entstehen.
Gerade für die Gewerkschaften ergeben sich aus der Bündnisarbeit Zielkonflikte mit der Bündnisrolle und der originären Aufgabe als Arbeitnehmervertretung. Ein Beispiel dafür stellt die Tarifpolitik dar. Während eine offensive Lohnpolitik mit hohen Abschlüssen, dar- an interessiert ist, kurzfristig einen direkten Beitrag zur Steigerung der Massenkaufkraft zu leisten, wäre eine bündnisorientierte Tarifpolitik eher daran interessiert, mittelfristig das Rentenproblem zu lösen.66 Damit wird der Spagat deutlich, den die Verbände im „Bünd- nis für Arbeit“ vollbringen müssen, um einerseits gesellschaftspolitisch den Erfolg des „Bündnisses für Arbeit“ voranzutreiben und auf der anderen Seite die Interessen der Mit- glieder zu wahren. Denn auf Bündnisebene können hauptsächlich Leitlinien verfaßt wer-
Die Sicht der Gewerkschaften 21
den, die auf verbandlicher und betrieblicher Ebene umgesetzt werden müssen. Als deutlicher Kristallisationspunkt dieser Diskussion hat sich von Anfang an der Thematik der Wahrung der Tarifautonomie entwickelt.
Grundlage des deutschen Sozialstaates sind die Systeme sozialer Sicherungen und die Tarifautonomie, die durch Artikel 9 des Grundgesetzes geschützt ist. Die notwendige Trennung der Tarifpolitik vom Staat ergibt sich schon aus der Tatsache, daß die staatli- chen Sozialversicherungssysteme auf Erwerbsarbeit aufbauen und somit die Ergebnisse der Tarifpolitik maßgeblich über die Ressourcen des Sozialversicherungsstaates mitent- scheiden.67 Damit ist die relativ unabhängige Rolle der Tarifparteien von den betriebli- chen und staatlichen Akteuren gerechtfertigt und sollte auch zukünftig geschützt werden. Die Debatte, inwieweit Themen der Tarifpolitik (Lohnentwicklungen und Arbeitsbedingun- gen) auch Gegenstand der Bündnispolitik sein könnten, wurde bereits in Kapitel 4 erör- tert.
Die Gewerkschaften wehren sich dagegen, auf niedrigere Abschlüsse verpflichtet zu werden und darin das Allheilmittel des Abbaus der Arbeitslosigkeit zu sehen. Sie führen an, daß das reale Arbeitnehmereinkommen zwischen 1992 und 1998 nur um jährlich 0,7% zugenommen hätte.68 Allerdings besteht auch die Gefahr einer Überlastung der Tarifparteien, sollten Themen wie Sicherung des Sozialstaates und der Beschäftigung allein auf dieser Ebene aufgearbeitet werden.69
Vorläufig gelöst ist dieser Konflikt durch das gemeinsame Positionspapier des DGB und BDA, das im Rahmen des letzten Spitzengespräch entstand (siehe hierzu Kapitel VIII). Darin einigten sich die Verbände darauf, daß die Tarifautonomie und der Flächentarifvertrag verteidigt werden müsse, besonders durch Abwehr tarif- und gesetzeswidriger Bündnisse für Arbeit auf betrieblicher Ebene.70 Die Gewerkschaften tragen im Ausgleich dieses Zugeständnisses der Arbeitgeberseite die Forderung nach einer mittel- und langfristig verläßlichen Tarifpolitik und nach einer Reform des - aus Sicht der Unternehmer zu starren - Flächentarifvertrages durch, z.B. Öffnungsklauseln, mit.
Ob dieser Fortschritt allerdings die Kritiker des gewerkschaftlichen Konsenskurses zum Verstummen bringt, die der Meinung sind, daß für die Gewerkschaften im Hinblick auf ihre zukünftige Bedeutung und auf die Entwicklung ihrer Mitgliederzahlen die „traditionel- le“ Rolle einer „herzhaften Opposition“71 besser geeignet sein würde, bleibt abzuwarten.
V. Das Regierungsprogramm für das „Bündnis für Arbeit“
Für die neue Bundesregierung ist die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorrangige Aufgabe und zugleich die zentrale innenpolitische Herausforderung. Schon in den Wahlkämpfen zur Bundestagswahl machte Kanzlerkandidat Gerhard Schröder dies deutlich. Nach seiner Wahl zum Bundeskanzler hat er dann zu verstehen gegeben, daß er sich und seine Bundesregierung an der Arbeitslosenzahl messen lassen will.
Das „Bündnis für Arbeit“ wurde also zum Kernstück des Regierungshandelns. Wenngleich im „Bündnis für Arbeit“ alle Beteiligten gemeinsam das Problem der Massenarbeitslosigkeit be- kämpfen wollen, so hat die Bundesregierung doch eine übergeordnete Rolle. Schließlich bringt sie die notwendigen Gesetze in den Bundestag, schließlich hat sie zu entscheiden, welche Möglichkeiten die geeigneten sind. Würde sie hierbei einem Verbandspartner zu we- nig berücksichtigen, müßte sie mit dessen Ausstieg aus dem Bündnis rechnen. Die Bundes- regierung hat also auch zusammenführenden und moderierenden Charakter Im „Bündnis für Arbeit“. So formuliert Gerhard Schröder auch: „[...] Jeder, der am Tisch des Bündnisses sitzt, soll sagen, was aus seiner Sicht notwendig ist, um die Arbeitslosigkeit in Deutschland zu bekämpfen[...]. Ich erwarte nicht nur Forderungen an den Tischnachbarn, sondern auch, was jeder bereit ist, in das „Bündnis für Arbeit“ einzubringen.[...] Für die Seite der Bundesregie- rung heißt das: wir werden alle Maßnahmen der Politik danach beurteilen, ob sie vorhandene Arbeit sichern oder neue Arbeit schaffen können.“72
Die Bundesregierung hat daher im „Bündnis für Arbeit“ die o.g. „Benchmarking-Gruppe“ eingesetzt. Ein Vorbild für die Bundesregierung sind hierbei bspw. die Niederlande. Dort wurde vor 15 Jahren ein „Bündnis für Arbeit“ ins Leben gerufen. Die Reformwilligen schlossen sich zu einer Generalüberholung des Staatswesens mit Erfolg zusammen (siehe hierzu Kapitel VIII). Die Bundesregierung möchte in ihrem Arbeitsprogramm daran anknüpfen.
1. Steuerreform
Hierzu bedarf es aus Sicht der Bundesregierung zunächst einer umfassenden Steuerreform. Sie sei ein erster Schritt und basiert auf der Einsicht in die ökonomischen Notwendigkeiten. Im Mittelpunkt soll dabei die Entlastung der aktiv Beschäftigten und des Mittelstandes stehen, so Kanzler Gerhard Schröder in seiner Antrittserklärung.73 Ein viel diskutierter Schritt ist hier- bei die ökologische Steuer- und Abgabenreform. Der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grü- nen unterstützt diesen Reformversuch. Nach Ansicht der Bundesregierung sind Natur und Energie endliche und knappe Güter die über den Preis versteuert werden müssen, mit dem einzigen Ziel, Arbeit, die reichlich vorhanden ist, billiger zu machen, damit mehr Menschen Arbeit bekommen.74 Die Einnahmen aus dieser Steuer sollen dann zur Senkung der gesetz- lichen Lohnnebenkosten führen. Die Bundesregierung sieht hierbei die Nettoentlastung der Haushalte im Vordergrund. Diese können zur Belebung der Binnenkonjunktur führen, so daß dann die Menschen auch verstärkt kaufen können, was die Wirtschaft herstellt.75 Aber auch eine Unternehmenssteuerreform nimmt sich die Bundesregierung zum Ziel. Sie will vor allem dem Mittelstand und den Kleinbetrieben die Chance geben, sich auf dem Markt zu etablieren und langfristig dort zu existieren. Sie will den Menschen die Perspektive der Selbständigkeit eröffnen. „Wer eine Existenz gründen, eine gute Idee vermarkten will, dem werden wir nach Kräften helfen“, so Schröder. Dadurch soll der Standort Deutschland ge- stärkt und für Investoren attraktiv werden. Die Entstehung neuer Arbeitsplätze sei dann die logische Folge. Derzeit liegt Deutschland mit 60% auf Platz 2 in der steuerlichen Belastungs- skala hinter Italien. Zum Vergleich: Die Niederlande und Großbritannien belegen mit ca. 30% die niedrigsten Plätze.76
Vorgenommen hat sich die Bundesregierung bei Amtsantritt eine von der Rechtsform unabhängige Besteuerung der Unternehmereinkünfte mit einheitlichem Steuersatz von ca. 35%. Diese soll stufenweise eingeführt werden.
2. Aufbau Ost
Ein weiteres Problem, das Kanzler Gerhard Schröder zur Chefsache erklärt hat, ist der Auf- bau Ost. Die neuen Bundesländer sind im besonderen von der Massenarbeitslosigkeit be- troffen. Hier soll die Wirtschaftsförderung mit mehr Effizienz und Zielgenauigkeit vorangetrie- ben werden. Hierzu bedürfe es einer aktiven Arbeitsmarktpolitik vor Ort. Die Infrastruktur müsse ausgebaut und vor allem müssen Impulse zur Stadterneuerung und Verbesserung der Wohnqualität gegeben werden.77 Auch die Stärkung der Innovationsfähigkeit und der Ausbau der Finanzierungsformen, die den besonderen Problemen ostdeutscher Unterneh- men gerecht werden, gehören zum Förderkonzept der Bundesregierung für den Aufbau Ost. Hier spricht Gerhard Schröder in erster Linie die Banken an, die bei der Bereitsstellung von Geldern für Unternehmensgründungen immer noch zu zögerlich seien. Es gehe hierbei nicht um „Risikokapital“ sondern um „Chancenkapital“, das Unternehmensgründern helfen soll.
Die Bundesregierung hat daher eine umfassende Steuerreform und den Aufbau Ost als wichtige Themen in das „Bündnis für Arbeit“ aufgenommen.
3. Ausbildungspolitik
Ein besonderes Augenmerk setzt die Regierung Schröder auf die Ausbildungspolitik. Sie sieht hier die langfristige Sicherung der Qualität des Standorts Deutschland und will unbe-
Das Regierungsprogram für das „Bündnis für Arbeit“ 24
dingt vermeiden, daß Jugendliche nach ihrer Schulzeit direkt in die Arbeitslosigkeit rutschen. Gefragt seien hier Wirtschaft und öffentliche Verwaltung. Sie stünden in der Pflicht, die Lehr- stellenzahl zu erhöhen. Im „Bündnis für Arbeit“ könne dies mit den Arbeitgebern vereinbart werden. Die Bundesregierung setzt darauf, daß keine Zwangsmaßnahmen zur Mobilisierung von Ausbildungsplätzen nötig sind - wird sich diese aber vorbehalten.78 Um die gegebenen Ausbildungsplätze auch auszufüllen, erwartet Gerhard Schröder aber, daß Mobilität kein Fremdwort werden darf. Das Recht auf Ausbildung beinhalte daher auch ein Pflicht.79 Hierfür hat die Bundesregierung erste Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ein Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit sieht Ausbildungs-, Qualifizierungs- und Beschäftigungs- angebote für 100.000 Jugendliche vor.
4. Weitere Programmpunkte
Weitere wichtige Eckpunkte für die Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit sieht die Bundesregierung in einer Reform der sozialen Sicherungssysteme. Sie will soziale Sicherheit gegenüber den Lebensrisiken garantieren. Dabei müssen Qualität, Zielgenauigkeit und Gerechtigkeit der sozialen Sicherung erhöht werden.
Die Rente mit 60 ist auch für die Bundesregierung ein Thema. Allerdings nur, wenn die Fi- nanzierung hierbei nicht von den Rentenversicherungsträgern übernommen werden muß und wenn es sich um langjährig Versicherte mit 35 und mehr Versicherungsjahren handele.80 Im Bereich der Arbeitszeitpolitik sieht die Bundesregierung die Chance, im „Bündnis für Ar- beit“ Themen wie Überstunden, Altersteilzeit oder normale Teilzeitbeschäftigung zu erläutern. Auch die Einrichtung eines staatlich subventionierten Niedriglohnsektors hält die Bundesre- gierung für möglich, um der großen Massenarbeitslosigkeit Herr zu werden.81
Die beschriebenen, aus ihrer Sicht elementaren Themen hat die Bundesregierung ins „Bündnis für Arbeit“ aufgenommen und hofft so, vergleichbare Erfolge vorzuweisen, wie die europäischen Nachbarn (siehe hierzu: Kapitel VIII).
VI. Ergebnisse der Spitzengespräche
1. Spitzengespräch vom 7. Dezember 1998
Auf dem ersten Spitzengespräch82 am 07. Dezember 1998 unter Vorsitz von Bundeskanzler Gerhard Schröder konnte man darauf verständigen, gemeinsam auf einen Abbau der Arbeitslosigkeit hinzuarbeiten und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nachhaltig zu stärken. Die Aufnahme des Begriffs „Wettbewerbsfähigkeit“ auch im offiziellen Titel des „Bündnisses für Arbeit“ („„Bündnis für Arbeit“, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit“) geht auf Druck der Arbeitgeber zurück.
Es wurde ein Maßnahmenkatalog beschlossen, anhand derer man die Beschäftigungs- probleme langfristig lösen will. Grob gegliedert kann man diese Vorschläge in die Rubri- ken Sozialstaatsreform, Wettbewerbsfähigkeit und direkt Arbeitsmarktpolitik unterteilen:
1. Sozialstaatsreform
- Strukturelle Reform der Sozialversicherung/Senkung der Lohnnebenkosten
- Vermögensbildung und Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer verbessern
- Perspektiven für geringqualifizierte Arbeitnehmer verbessern (auch Arbeitsmarkt-
politik)
2. Wettbewerbsfähigkeit
- Unternehmenssteuerreform
- Verbesserung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen · Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen verbessern
- Fach- und Themendialoge für Beschäftigung, Innovationen und Wettbewerbsfä- higkeit (auch Arbeitsmarktpolitik)
- Bedingungen für Unternehmensgründungen verbessern
3. Direkte Arbeitsmarktpolitik
- Beschäftigungsfördernde Arbeitszeitverteilung und flexiblere Arbeitszeiten · Rentenübergang verbessern
- Beschäftigungsaufbauende Tarifpolitik
- Neue Initiativen im Kampf gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit
Das Ergebnis der Spitzengespräche 26
Bezüglich des exakten Wortlauts der offiziellen gemeinsamen Erklärung des „Bündnisses für Arbeit“ sei auf die Anlage IIVI des Anhanges verwiesen.
2. Spitzengespräch vom 26. Februar 1999
Im Vorfeld des 2. Spitzengespräches wurde bereits deutlich, daß die Verhandlungen im Bonner Kanzlerbungalow unter schwierigen Vorzeichen standen. Hans-Olaf Henkel, Prä- sident des BDI, drohte bereits mit dem Ausstieg aus dem Bündnis. Grund für seine Mißstimmung waren die Tarifverhandlungen mit den aus seiner Sicht viel zu hohen Lohn- forderungen angesichts der schwachen Konjunkturlage im Bereich der Metallindustrie und die seiner Meinung nach verfehlte Regierungspolitik seitens Kanzler Gerhard Schrö- der.
Ein weiteres Problem brachte die Forderung Dieter Hundts, das Thema Tarifpolitik ins Bündnis mit einzubringen, was auf großen Widerstand bei den Gewerkschaftlern stieß. Positiv zu bewerten war die Bereitschaft der Beteiligten, das Bündnis auch nach den Kontroversen weiterzuführen. Anzeichen für einen Durchbruch aber gab es noch nicht. Am Ende der Gesprächsrunde konnten Annäherungen in drei Bereichen erzielt werden: Die Arbeitgeber wollen ihr Ausbildungsangebot für 1999 ausbauen.
Die Partner im Bündnis sollen über eine Arbeitsgruppe beim Bundesfinanzministerium an den nächsten Stufen von Unternehmens- und Ökosteuerreform beteiligt werden. Auch im Bereich der staatlichen Subventionierung von Niedriglöhnen konnten Fortschritte verzeichnet werden.83
3. Spitzengespräch vom 6.Juli 1999
Auch das 3. Spitzengespräch stand zunächst unter keinem guten Stern.
Im Lager der Wirtschaftsverbände war man sich weiterhin uneinig bezüglich eines Verbleibens im Bündnis. BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel sah im Bündnis keine Möglichkeit der Zusammenarbeit. Dieter Hundt hingegen wollte unbedingt daran festhalten. Er sieht im Bündnis eine Chance.
Auch nach dem dritten Gespräch existieren die Fronten weiterhin - immerhin aber scheinen die Linien weicher zu werden. In einem gemeinsamen Papier von BDA und DGB (siehe An- lage IIVII) bekräftigten die Verbände den Wunsch nach gemeinsamer Orientierung in der Haushalts-, Finanz-, Sozial- und Tarifpolitik und schmiedeten somit ein „Bündnis im Bündnis“.
Das Ergebnis der Spitzengespräche 27
Des weiteren einigte man sich auf eine konkrete Ausbildungsplatzgarantie für das Jahr 2000. Auch die Partner im Bündnis schienen zufrieden: „Da werden Dinge möglich, die ich vor ei- nem halben Jahr noch nicht für möglich gehalten habe“, so DGB-Chef Dieter Schulte.84
VII. Internationale Beispiele für ein „Bündnis für Arbeit“
Damit das „Bündnis für Arbeit“ langfristig Erfolg haben kann, haben Bundesregierung und Verbände die „Benchmarking-Gruppe“ beauftragt, in einem europäischen Vergliech festzu- stellen, welche Maßnahmen sich dort als besonders wirksam erwiesen haben und was da- von in Deutschland nützlich sein könnte. „Man muß das Rad ja nicht immer neu erfinden“, so der ehemalige Kanzleramtsminister Bodo Hombach. Wichtig ist für ihn allerdings, daß man genau auf die Problemstellung in Deutschland eingeht, denn „nur wenn die Diagnose stimmt, kann auch die Therapie greifen“.85
Als mögliches Vorbild wird immer die Konsensökonomie, das sog. „Sociaal-Ekonomische Raad“ der Niederlande genannt. Auch das Königreich Dänemark hat in nur fünf Jahren die Arbeitslosigkeit durch einem Sozialpakt zwischen Kooperation und Wettbewerb halbiert und könnte so ein Muster für die deutsche Bundesregierung darstellen.
Insgesamt gibt es zahlreiche europäische Vorbilder für ein „Bündnis für Arbeit“, die in den letzten fünf bis fünfzehn Jahren ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbesserten, die öffentlichen Haushalte sanierten und so die Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpften. Neben den Niederlanden und Dänemark, auf die der Folgetext näher eingehen wird, sind dies bspw. Finnland, Griechenland, Portugal, Italien, Norwegen und Irland.
Möglich war dies nur, weil sich diese Länder von ihren alten traditionellen Modellen verab- schiedeten. Deutschland hingegen hält noch immer daran fest und wird dafür im Ausland schon belächelt.86 Nach Ansicht des New Yorker „Wall Street Journal“ müsse die Regieirung Schröder, angesichts des globalen Wettbewerbs, endlich aus den alten Denkstrukturen aus- brechen, die fünf Jahrzehnte lang die deutsche Wirtschaft dominiert hätten.87 Die Wissenschaftler der „Benchmarking-Gruppe“ ,Wolfgang Streeck und Rolf Heinze, glau- ben hierbei, daß „das eigentliche Beschäftigungsdefizit der deutschen Volkswirtschaft im Bereich niedrigproduktiver Dienstleistungsarbeit liege“.88 Anderswo sei diese Wende längst vollzogen worden. In den Niederlanden, wo bspw. Teilzeitjobs und Zeitarbeitsfirmen eine ganze Armada von Dienstleistungswilligen beschäftigen. Oder in Dänemark, die den Mut hatten, Abschied von alten Industriejobs zu nehmen. Auch die USA, die oftmals als „unsozi- al“ dargestellt werden, konnten eine Vollbeschäftigung durch Stärkung des Dienstleistungs- sektors erreichen.89
1. Das Königreich Niederlande - Ein Muster der Zusammenarbeit
Grundlage für die rasche Verbesserung der Arbeitslosigkeit in den Niederlanden war der Internationale Beispiele für ein „Bündnis für Arbeit“ 28 Konsens zwischen den Sozialpartnern. Die Führer der Gewerkschaftsvertretung FNV und des Dachverbandes der Zentralen Arbeitgebervereinigung haben zunächst nach Gemeinsamkeiten in ihren Vorstellungen und nicht die Unterschiede gesucht. Man erklärte sich bereit, langfristig mäßige Lohnsteigerungen zu akzeptieren. Gleichzeitig wurde die Arbeitszeitverkürzung und mehr Teilzeitarbeit angeboten. Dieses „Abkommen von Wassenaar“ 1982 wird noch heute als Symbol des wiedergewonnen Konsens gefeiert.90
Zur Regelung der Alltagsbeschäftigung gibt es in den Niederlanden schon seit 1945 die „Stiftung für Arbeit“ und seit 1950 den „Sociaal-Ekonomische Raad“. Gremien, die von ihrem Aufbau der deutschen „Steuerungs-Gruppe“ bzw. der „Benchmarking-Group“ ähneln. Diese Gremien führen in den Niederlanden einen ständigen Dialog zu allen Tarif- und Beschäftigungsfragen. Wenngleich dies zeitaufwendig scheint, so führen deren Vorschläge doch zu einer hohen Akzeptanz bei der Regierung. Ein besonderes Augenmerk werfen die Gremien dabei auf die Förderung von Teilzeitarbeit.91
So konnte in den Niederlanden eine rasche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt erreicht wer- den. Mittlerweile arbeit mehr als ein Drittel aller Arbeitnehmer unter 35 Stunden pro Woche. Die Telzeitquote liegt bei den Männern bei ca. 16%, bei den Frauen bei ca. 66%. Gefördert wird dabei die Teilzeitarbeit in den Niederlanden durch eine Aufstockung des Gehalts, wenn dieses unter das Mindestlohnniveau zu sinken droht. Daneben enthalten schon 80% aller Tarifverträge Bestimmungen für Teilzeitbeschäftigte. Die Zeitarbeitsfirmen gehen dabei wie folgt vor: sie entrichten Beiträge zu Betriebsrenten, bieten Fortbildungen an und zahlen auch bei Nichtbeschäftigung den Lohn weiter, da es hier eigene Tarifverträge gibt. Diese Rech- nung scheint aufzugehen, denn die Zahl der Zeitarbeitsfirmen wächst weiter.
Insgesamt lagen die Lohnzuwächse 1997 über denen in Deutschland, wenn auch zwischen 1980 und 1995 die Löhne in den Niederlanden nur um 70% durchschnittlich stiegen und in Deutschland um 98%.
Das hohe Beschäftigungsnivaeu beruht nicht zuletzt auch auf geringqualifizierten und schlechter bezahlten Jobs. So ist ein Teil der „flexiblen“ Arbeiter weniger als 12 Stunden in der Woche beschäftigt. Viele Arbeiter üben auch zwei solcher Jobs aus. So gelang eine im europäischen Vergleich überdurchschnittliche Steigerung der Beschäftigungs- und Erwerbsquote. Im Durchschnitt hat sich die Zahl der Beschäftigten zwischen 1982 und 1997 um 1,7% erhöht.92
2. Königreich Dänemark - Zwischen Kooperation und Wettbewerb
Im Königreich Dänemark gelang in noch kürzerer Zeit die Halbierung der Arbeitslosenzahl. Internationale Beispiele für ein „Bündnis für Arbeit“ 29 Diesem drastischen Abbau der Arbeitslosigkeit liegen allerdings auch ungewöhnliche Maßnahmen zugrunde. Ausgangslage war auch in Dänemark die Frage, wie Parteien, Staat, Arbeitgeber und Ge- werkschaften ein gegenseitiges Einvernehmen erzielen, das die Wettbewerbsfähigkeit er- höht.93 Wenn die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird, kann das Ergebnis ein Anstieg der Beschäftigung sein. Hierbei waren zunächst die Arbeitgeber gefragt. Sie würden mehr Men- schen beschäftigen, wenn sie auf diese weise mehr Geld verdienen können. Eine Garantie dafür konnte man nicht geben, da die Entscheidung über die Beschäftigung weiterer Arbeits- kräfte allein vom einzelnen Arbeitgeber und seinen Rentabilitätsberechnungen abhängt.94
In den dänischen Sozialpakt für Beschäftigung wurden dann die Schlüsselthemen hinsichtlich des Arbeitsmarktes aufgenommen: Lohnpolitik, Arbeitszeitpolitik, Produktivität, Arbeitsorganisation, Bildung, Ausbildung und Arbeitslosenpolitik.
Die Gewerkschaften sahen ein, daß sie ihre Lohnforderungen in den Tarifverhandlungen der makroökonomischen Situation anpassen mußten. Dazu gehörte später auch die Einsicht, daß Arbeitnehmer in konjunkturschwachen Zeitenkein Anrecht auf ihren Anteil am Wirt- schaftswachstum haben.95 So begann in Dänemark bereits in den achtziger Jahren eine so- ziale Partnerschaft.
Eine höchst umstrittene Beschäftigungsmaßnahme wurde dann zu Beginn der neunziger Jahre eingeleitet: sog. „Heimservice-Firmen“ nehmen Familienmüttern und -vätern die Hausarbeit ab. Den Lohn zahlen je zur Hälfte der Staat und der Auftraggeber. So konnten Familienmütter und -väter entlastet werden und es wurden Arbeitsressourcen freigesetzt. Außerdem konnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Zusammenfassend sind die Elemente des dänischen Erfolges eine stabile Wirtschaftspolitik, das Festhalten an den Grundprinzipien des Wohlfahrtstaates sowie eine hohe Flexibilität. Letztere wird deutlich bei dem Modell der „Job-Rotation“ und dem Urlaubsmodell. Hierbei wird die bestehende Arbeit geteilt. Arbeitslose übernehmen die Stellen während der Weiter- bildungs-, der Mutterschutz- oder einer längeren Urlaubsreise. Hierzu gibt es ein Jahr lang Zuschüsse. Gleichzeitig wurden in Dänemark großzügig Frühpensionierungen ermöglicht. Damit sank die Arbeitslosenquote in fünf Jahren von 12,4% auf ca. 7,6%.96 Abschließend läßt sich sicherlich feststellen, daß Vergleiche der verschiedenen Länder mit Deutschland schwierig sind, da ja schon die entsprechenden Systeme sich unterscheiden. Dennoch eignen sie sich, Ideen für eine offensive Beschäftigungspolitik umzusetzen.
VIII. Alternative Konzepte einer Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
Im weiteren sollen nun exemplarisch verschiedene Formen der Arbeitsmarkt- und Be- schäftigungsförderungspolitik dargestellt werden. Zu Beginn wird auf das Konzept der Deregulierung und Flexibilisierung arbeitsrechtlicher Normen zur Förderung des Arbeits- marktes eingegangen, welches seinen Ursprung in den frühen achtziger Jahren hatte. Aus neuerer Sicht folgt danach das Konzept der Benchmarking-Gruppe des „Bündnisses für Arbeit“, das die Schaffung eines subventionierten Niedriglohnsektor propagiert, bevor abschließend noch einmal ausführlich das Konzept der „Rente mit 60“ vorgestellt wird.
1. Deregulierung und Flexibilisierung als neo-liberales Konzept von CDU und FDP
Die Anhänger des Neoliberalismus vertreten die Auffassung, daß die anhaltende Arbeits- losigkeit durch verstärkte Flexibilisierung des Arbeitsmarktes zu bekämpfen wäre.97 Durch entsprechende Maßnahmen sollen die Anpassungsfähigkeit erhöht und Beschäfti- gungshemmnisse abgebaut werden. Neben der Flexibilisierung der Löhne und Lohn- strukturen sowie der Flexibilisierung der Arbeitszeit steht auch die Forderung nach einem Abbau des Bestandschutzes von Arbeitsverträgen im Mittelpunkt der Deregulierungsdis- kussion.98 Darunter fallen Kündigungsschutzregelungen, Sozialplanbestimmung sowie tarifliche Vereinbarungen, sofern sie auf die Sicherung der bestehenden Arbeitsverhält- nisse hinwirken. Für die Befürworter der Deregulierung besteht ein Gegensatz zwischen gesamtwirtschaftlicher Effizienz und sozialpolitischen Zielen. Ihrer Meinung nach führe eine Reduzierung des Bestandschutzes zur Entlastung der Unternehmen und trage damit zum Abbau der Arbeitslosigkeit bei.99 Der bestehende soziale Schutz aus Zeiten der Vollbeschäftigung sei nicht mehr angemessen und müsse daher eingeschränkt wer- den.100
Anhand des Beispiels des Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1985 soll exemplarisch eine Maßnahme beschrieben werden, die als Ausdruck dieser Debatte verstanden werden kann, um später Wirkungsanalyse zu betreiben.
Vordenker des Beschäftigungsförderungsgesetzes waren 1982/83 die FPD/CDU-Politiker Graf Lambsdorf, George und Albrecht. Es trat am 01. Mai 1985 befristet bis zum
01.01.1990 in Kraft101 Das BeschFG stellte zunächst eine vorübergehende Ausnahmere- gelung dar, die in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit für mehr Beschäftigung sorgen sollte. Sie wurde zweimal verlängert, zuletzt 1994 mit Geltungsdauer bis zum 31.12.2000. Inhalt des Gesetzes ist, neben Regelungen zur Teilzeitarbeit in den Paragraphen 2 bis 6 (unter an- derem das Verbot zur unterschiedlichen Behandlung von teilzeitbeschäftigten Arbeitneh- mern in §2), die grundsätzliche Zulässigkeit der Befristung von Arbeitsverträgen. Diese ist nach der letzten Änderung durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz 1996, welches auch die Bestimmungen des Kündigungsschutzes lockerte (Anhebung der Kleinbetriebsregelung von 5 auf 10 Arbeitnehmern) und die Entgeltfortzahlung im Krank- heitsfall verschlechterte (Zahlung von nur 80% des Lohnes während der Dauer des Ver- dienstausfalls), generell bis zu einer Dauer von zwei Jahren möglich. Bis zum Erreichen dieser Gesamtdauer ist eine dreimalige Verlängerung der Befristung zulässig. Damit schränkte der Gesetzgeber die bisherige BAG-Rechtssprechung zum §620 BGB ein, wo- nach es bei Gefahr der Umgehung des Kündigungsschutzes eines sachlichen Grundes zur Befristung bedarf.102 Für Arbeitnehmer ab dem 60. Lebensjahr gelten weder Höchst- befristungsdauer noch Verlängerungsbeschränkung.103
Ziel des Gesetzes war es demnach, zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaf- fen und Unternehmen einen Anreiz zur Einstellung von mehr Arbeitnehmern zu geben. Der Gesetzgeber wollte die Arbeitgeber veranlassen, bei einer Verbesserung der Auf- tragslage statt über längere Zeiträume Überstunden oder Sonderschichten zu vereinba- ren, weitere Arbeitnehmer einzustellen. Dem lag die Einschätzung zugrunde, daß die Unternehmer das geltende Arbeitsrecht nicht für ausreichend flexibel hielten, um bei ver- änderter Auftragslage schnell personalwirtschaftlich reagieren zu können.104 Hierbei spielt wohl die psychologische Komponente eine große Rolle, die gerade in Kleinbetrieben mit geringem juristischen Know How zu Einstellungshemmnissen führe.105
Die Gewerkschaften bezweifelten, ob der Kündigungsschutz wirklich in diesem Maße ein Einstellungshemmnis sei, da er ohnehin erst bei sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit entstehe. Sie wandten sich entschieden gegen eine zukünftige „Hire und Fire“- Politik.106 Nach Ansicht der Deregulierungsgegner könne Bestandschutz gesamtwirtschaftlich gesehen auch effizienzsteigernd wirken, wenn man die betriebsspezifischen Ausbildungserträge und die Wiedereingliederungskosten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer berücksichtige.107 Allgemein befürchtete man eine Gefährdung der deutschen Rechtskultur und eine Aushöhlung der bestehenden Rechtsnormen.108
Von der Unternehmensseite wurde dieses Regelungen positiv aufgenommen und auch im Zeitverlauf hielt man es für ein effektives Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen.109 Nach ihren Aussagen wurden allein 1992 45.000 Personen aus befristeten Arbeitsverhältnissen in unbefristete übernommen und somit bislang verschlossene Beschäftigungspotentiale zumindest teilweise erschlossen.110
Von gewerkschaftlicher Seite wies man auf die Gefahr hin, daß sich Mitnahme- und Verdrängungseffekte einstellen würden, die darauf hinaus liefen, daß Arbeitsnehmer, die sonst unbefristet eingestellt worden wären, einen befristeten Arbeitsvertrag erhielten und somit unbefristet eingestellte Arbeitnehmer verdrängt würden.111
Zur Wirkung des Beschäftigungsförderungsgesetz wurden zwei Evaluationsstudien im Auftrage des Bundesministerium für Arbeits- und Sozialordnung durchgeführt (1987/88 und 1992/93).112 Diese Evaluation war für die Befürworter, als auch die Gegner der Be- fristungsregelung, ernüchternd. Weder die Befürchtungen, noch die Hoffnungen haben sich quantitativ bestätigt.113 Neueinstellungen, die sonst unterblieben oder verschoben worden wären, wurden nur im geringen Umfang getätigt. Quantitativ betrachtet, standen 1992 der Zusatzbeschäftigungseffekt und der Substitutionseffekt in einem Verhältnis von 3:1. In absoluten Zahlen ist der Beschäftigungseffekt (1992: 45.000-85.000) im Vergleich zu den Arbeitsmarktproblemen (1992: über 2 Millionen Arbeitslose in Westdeutschland) allerdings relativ klein.114 Es wären auch nur 7-16% der befristeten Neueinstellungen nicht nach alten Recht zulässig gewesen.115. Jede zweite Befristung mündete in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Nun könnte man argumentieren, daß, da sich die geäußerten Befürchtungen nicht in dem Maße bewahrheitet haben und ein - wenn auch geringer - Beschäftigungseffekt entstan- den ist, die Regelungen des Beschäftigungsförderungsgesetz beibehalten werden sollen, weil sonst möglicherweise auf Vorteile für Arbeitnehmer, die auf diese Weise eine Be- schäftigung finden, verzichtet werde.116 Allerdings müßte die Regelung wohl im jedem Fall modifiziert werden, etwa im Rahmen von Auswahlrichtlinien gemäß 95 BetrVG, die Übernahmeverpflichtungen des Arbeitgebers in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat regeln.117 In der Literatur wird auch der Vorschlag einer Risikoprämie diskutiert, die die Verlagerung des Betriebsrisikos des Arbeitgebers auf den Arbeitnehmer ausgleichen soll.118
Anhand des Beispiels des viel diskutierten Beschäftigungsförderungsgesetzes sind einige Punkte der Diskussion „Bestandschutz versus Deregulierung“ erörtert worden. So wie es scheint, können deregulierende Maßnahmen allein die heutigen Probleme des Arbeits- marktes nicht lösen. Zudem ist fraglich, ob die Vorteile die offensichtlichen Nachteile ü- berwiegen.
Alternative Konzepte einer Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 33
2. Konzept der Benchmarking-Gruppe zur Einführung eines Freibetrages bei den
Sozialabgaben auf niedrig entlohnte Arbeit
Die Benchmarking-Gruppe im „Bündnis für Arbeit“ entwickelte einen weiteren Vorschlag zur Beschäftigungsförderung. Im internationalen Vergleich hatten sie festgestellt, daß in Deutschland eine Beschäftigungslücke im Niedriglohnsektor existiere.119 Nach ihren Erkenntnissen ergeben sich Wachstums- und Beschäftigungspotentiale ins- besondere im Dienstleistungssektor, die man durch Einführung eines generellen Freibe- trages für Sozialabgaben bei niedrigen (Stunden-)Verdiensten erschließen könne.120 Als Referenzmodell wird dabei der Freibetrag bei der Einkommensteuer genannt. Die Grenze des Freibetrages sollte bei einem monatlichen Gehalt im Rahmen von 1500 - 2800 DM liegen.
Vertreten wird dieser Vorschlag in den Öffentlichkeit insbesondere von dem Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Wolfgang Streeck, einem Mitglied der Benchmarking-Gruppe. Er ist der Meinung, daß Beschäftigung zu produktivitätsgerechten Löhnen auch dort stattfinden sollte, wo dies aufgrund hoher Lohnnebenkosten nicht mög- lich sei.121 Dieses solle durch die Subventionierung der Sozialabgaben quasi „künstlich“ herbeigeführt werden. Eine Wende auf dem Arbeitsmarkt lasse sich nur mittels Erschlie- ßung neuer Beschäftigungpotentiale herbeiführen, federführend sei hierbei die Expansion des Dienstleistungssektors. Vermieden werden sollte jedoch eine Verdrängung der höhe- ren Lohngruppen durch die Subventionen, während die Schaffung eines Abstand zur So- zialhilfe erwünscht ist.122 Natürlich steht auch dieses Konzept in der Kritik (seine Finan- zierbarkeit, der Aspekt der sozialen Gerechtigkeit sowie die Schwierigkeit bei der Festle- gung der Höchstgrenze des zu subventionierenden Gehaltes), dennoch tendiert gerade die Bundesregierung zu dieser Möglichkeit.
3. Konzept der Gewerkschaften „ Rente mit 60 “
Die Arbeitnehmerseite, insbesondere der IG-Metallvorsitzende Klaus Zwickel, hat im Vor- feld des dritten Spitzengespräches einen Vorschlag zur Diskussion gestellt, der heftig umstritten ist. Er fordert - zumindest begrenzt auf die nächsten fünf Jahre - die Möglich- keit einer „Rente mit 60“,123 für alle Arbeitnehmer, die mindestens 35 Jahre rentenversi- chert sind, und den Platz für einen (jüngeren) Arbeitslosen frei machen wollen. Nach geltendem Recht ist dies bisher nur unter bestimmten Voraussetzungen für ver- schiedene Gruppen möglich: Beschäftigte, die vom Altersteilzeitgesetz Gebrauch ma-
Alternative Konzepte einer Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 34
chen oder mindestens 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, Frauen, Schwerbehinderte oder Langzeitarbeitslose.124
Die Finanzierung der früheren Rente soll durch Tariffonds erfolgen, in die Arbeitnehmerund Arbeitgeberverbände einzahlen, und die durch den Staat steuerlich begünstigt werden. Damit wäre eine Drittelfinanzierung gewährleistet.
Zwickel hält dabei auf eine Beschäftigungswirkung von 1,2 Millionen Neueinstellungen für realistisch.125 Dem widerspricht der Geschäftsführer des Verbandes der Rentenversiche- rungsträger Franz Ruland. Er ist der Meinung, daß nur ein Arbeitsloser pro sieben frei werdende Stellen beschäftigt wird. Dies hätten Erfahrungen mit früheren Vorruhestands- regelungen gezeigt.126
Auch bei den anderen Partnern im „Bündnis für Arbeit“ wird der Vorschlag eher skeptisch betrachtet, da zum einen die Finanzierung schwierig und zum anderen es wohl zu erwar- ten sei, daß hierdurch die Rentenbeiträge steigen und die gegenwärtige Lage nur ver- schärfen würden.127
IX. Schlußbemerkung
„Unser drängenstes und schmerzhaftestes Problem bleibt die Massenarbeitslosigkeit. Sie führt zu psychischer Zerstörung, zum Zusammenbruch von Sozialstrukturen. Dem einen nimmt sie die Hoffnung, dem anderen macht sie Angst“, so Gerhard Schröder in seiner Antrittsrede. Zu Recht, denn die Arbeitslosigkeit belastet das deutsche Gemein- wesen derzeit mit Kosten von jährlich 170 Milliarden D-Mark. Es gilt also, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, die unmittelbar das Angebot und die Nachfrage auf dem Ar- beitsmarkt positiv beeinflussen können. Beschäftigungsmaßnahmen, Ausbildungspolitik, Aufbau Ost, Umschulung von Arbeitslosen aber auch gesetzliche Anreize für die Unter- nehmen, mehr Arbeitsplätze bereitzustellen, müssen hierbei einbezogen werden. Die Bundesregierung hat sich diese Politik der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aber auch der Förderung des Wachstums und der Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähig- keit zum Ziel gesetzt.
Wenngleich nun deutlich wurde, wie schwer es zu sein scheint, seitens der Verbände Kompromisse einzugehen, so ist das „Bündnis für Arbeit“ dennoch nicht zum Scheitern verurteilt. Im Rahmen der Gesprächsrunden der Spitzenvertreter wurde dies deutlich. Wo zu Beginn noch verhärtete Fronten herrschten, wurde im ablaufenden Jahr ersichtlich, daß eine Annäherung möglich ist. Dies ist durchaus als Erfolg zu bewerten, da Kritiker der Bündnisidee bereits im Vorfeld eine Kooperation nicht für möglich hielten.
Dennoch müssen sich die Verhandlungspartner auf die gesetzten Ziele im Bündnis konzentrieren und auf konkrete Schritte einigen und diese auch umsetzen, statt in erster Linie an ihre eigenen Interessen zu denken, damit die Spitzengespräche nicht zu einem „Debattierclub“ werden. Mittlerweile sollte nicht mehr die Frage gestellt werden, ob sondern wie eine Kooperation möglich ist.
Was ein „Bündnis für Arbeit“ braucht, sind Akteure, die bereit sind, Verantwortung zu ü- bernehmen und den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Denn auf dieser Ebene können nur Leitlinien und Maßnahmen entstehen; die konkrete Umsetzung muß auf Ebene der Länder, Verbände, Kommunen und Betrieben erfolgen, so daß dort vorher Akzeptanz und Bereitschaft zur Mitarbeit geschaffen werden muß. Diese Akzeptanz kann aber vor allem nur dann erreicht werden, wenn zwischen den beiden Tarifpartnern ein ständiger Dialog zu allen Beschäftigungsfragen vorhanden ist, und es hier zu einer sachlichen Verständigung kommt, damit es auch die Bundesregierung einfacher hat, Gesetzesentwürfe erfolgreich auf den Weg zu bringen.
Ein solche Verständigung kann in einem derartigem Spitzengespräch durchaus erreicht werden. Daher soll an dieser Stelle die Idee für ein Bündnis für Arbeit gewürdigt werden.
Jedoch: es gibt noch viel Arbeit - zumindest für das Bündnis für Arbeit !
[...]
1 vgl. hierzu: Maier, Gerhard (Hrsg.), Arbeitsmarktpolitik, S.33
2 vgl. Streeck/Schmitter, From National Corporatism to Transnational Pluralism in: Politics and Society 19, S.135 aus: Nohlen, Dieter (Hrsg.), Wörterbuch Staat und Politik, S.365
3 vgl. Nohlen a.a.O.
4 vgl. Nohlen a.a.O.
5 vgl. Nohlen, Dieter, a.a.O., S.368f.
6 vgl. Schroeder, Wolfgang/Esser, Josef, „Modell Deutschland: Von der „Konzertierten Aktion“ zum „Bündnis für Arbeit““ in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3/99, 1999, S.3ff.
7 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.4.
8 vgl. Kap. II dieser Ausarbeitung
9 vgl. Sontheimer, Kurt/Bleek, Wilhelm, Grundzüge des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, München 1999, 127ff.
10 vgl. §1 StabG vom 10.06.1967.
11 vgl. §3 StabG vom 10.06.1967.
12 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.4f.
13 vgl. ebda, S.5
14 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.5.
15 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.6.
16 vgl. ausführlich Kap.7.
17 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.6.
18 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.8.
19 vgl. Graphik
20 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.10
21 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.12.
22 vgl. ebda.
23 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.8.
24 vgl. ebda.
25 Auf die jeweiligen (Zwischen-) Ergebnisse wird im Verlauf der Ausarbeitung noch eingegangen werden
26 vgl. Graphik im Anhang.
27 vgl. Schroeder, W./Esser, J., a.a.O.S.9
28 vgl. Der Spiegel vom 10.05.1999, aus, http://www.ig-metall.de/
29 vgl. Graphik im Anhang
30 vgl. EUV, Titel VIII, Artikel 125-130.
31 vgl. BDI, „Steuerentlastung für mehr Arbeitsplätze und Investitionen“ aus: http://www.bdi-http://.de/c210de.htm
32 siehe hierzu: Kirchner, Dieter, „Raus aus dem Korsett“, in Rheinischer Merkur vom 26.01.1996 und Langfeldt, Enno im Interview im General-Anzeiger vom 21.03.1996
33 so der ehem. Kanzleramtsminister in einem Interview mit der R heinischen Post vom 04.01.1999
34 vgl. hierzu ausführlich die Web-Site des BDA: http://www.arbeitgeber.de/bdawww.../
35 BDA, a.a.O.
36 vgl.: BDI-Grundsatzprogramm vom 15.01.1998 in: http://www.bdi-http://.de/c210de.htm
36 vgl.: Statement von Dr.Dieter Hundt (Präsident BDA) am 07.07.1999 und: BDI-Grundsatzprogramm vom 15.01.1998, a.a.O.
37 vgl.: BDI-Grundsatzprogramm vom 15.01.1998, a.a.O.
38 Dieter Hundt (Präsident des BDA) in: Rheinische Post vom 09.02.1999
39 Leitartikel „Das „Bündnis für Arbeit“ - außer Kontrolle?“, Süddeutsche Zeitung vom 15.04.1999
40 Dieter Hundt in: Rheinische Post vom 09.02.1999
41 Dieter Hundt, a.a.O.
42 Reinhard Göhner (Hauptgeschäftsführer BDA) in: Handelsblatt vom 11.05.1999 und Dieter Hundt in: Süddeutsche Zeitung vom 18.05.1999
43 dieser Meinung schließt sich auch der BJU (Bundesverband junger Unternehmer) an. vgl. hierzu: Presseinfo r- mation des BJU zum „Bündnis für Arbeit“ vom 30.09.1999 aus: http://www.bju.de/
44 Reinhard Göhner, a.a.O.
45 siehe hierzu auch: http://www.arbeitgeber.de/bdaw.../
46 DIHT-Präsident Hans -Peter Stihl im Interview vom 02.03.1999 mit der Rheinischen Post
47 siehe hierzu auch: http://www.arbeitgeber.de/bdaw.../
48 Die BDA zur tarifpolitischen Entwicklung 1998/99 aus:http://www.arbeitgeber.de/bdaw.../
49 vgl. IG Metall, Stellungsnahme zum Zwischenbericht der Arbeitsgruppe „Benchmarking“, 19.Mai 1999, http:// www.igmetall.de/, 1999.
50 vgl. Schulte, Dieter, Wir haben zum „Bündnis für Arbeit“ zwei Vorsätze und einen Appell, Beitrag für Einblick 24/98.
51 vgl. ebda.
52 vgl. ebda.
53 vgl. ebda.
54 vgl. ebda.
55 1995 wurde als Ziel gesetzt, die Arbeitslosigkeit in diesem Jahrtausend um 50% zu reduzieren.
56 vgl. Schulte, Dieter, a.a.O., zur weiteren Diskussion der beschäftigungsfördernden Maßnahmen vgl. im Folgenden Kapitel 7
57 vgl. Schulte, Dieter, a.a.O.
58 vgl. ebda.
59 vgl. DGB -Bundesvorstand, Positionspapier: Ein neues „Bündnis für Arbeit“, Bildung und soziale Gerechtigkeit, 06.11.1998, http://, www.dgb.de, 1998.
60 vgl. ebda, S.1.
61 vgl. ebda, S.2.
62 vgl. ebda, S.2.
63 vgl. DGB, a.a.O., S.4ff.
64 vgl. Schulte, Dieter, Ende der Arbeitsgesellschaft?, Rede im Walter Eucken Instituts am 02.12.1998, Freiburg, 1998, http:// www..dgb.de/.
65 vgl. DGB, a.a.O. S.5.
66 vgl. Schroeder, Wolfgang/Esser, Josef, Neues Leben für den Rheinischen Kapitalismus, Blätter der deutschen und internationalen Politik, 1/99, S.56.
67 vgl. Peters, Jürgen, Tarifautonomie und Tarifpolitik - Wie geht es weiter?, Gewerkschaftliche Monatshefte, 50.Jahrgang, 9/99, Düsseldorf, 1999, S.521f.
68 vgl. Peters, Jürgen, a.a.O., S.523.
69 vgl. Peters, Jürgen, a.a.O., S.524f.
70 vgl. BDA/DGB-Papier vom 6.Juli 1999 in der Anlage
71 vgl. Daniels, Arne, Der kalkulierte Totalschaden, Die Zeit Nr.40, 30.09.1999,S.23
72 Gerhard Schröder in: einblick 24/98 „„Bündnis für Arbeit“ - Herausforderung an alle.“
73 Gerhard Schröder, Regierungserklärung vom 10.11.1998
74 Gerhard Schröder, a.a.O.
75 Gerhard Schröder, a.a.O.
76 Nach Angaben der Bundesregierung aus: http://www.bundesregierung.de/02/0203/01/
77 siehe hierzu: Arbeitsprogramm der Bundesregierung für 1999 aus: http://www.bundesregierung.de/02
78 Gerhard Schröder, a.a.O.
79 Gerhard Schröder, a.a.O.
80 siehe hierzu: „Daten und Fakten zur Rente mit 60“ aus: http://www.buendnis.de/03...
81 hierzu ausführlich: „Neues Konzept für Niedriglöhne“ in: Handelsblatt vom 10.05.1999
82 Aus der Wirtschaft nahmen an dem Gespräch der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie Hans-Olaf Henkel, der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Dieter Hundt, der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Dieter Philipp sowie der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages Hans Peter Stihl teil. Auf Seiten der Gewerkschaften beteiligten sich der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Dieter Schulte, der Vorsitzende der Deutschen Angestellten Gewerkschaft Roland Lasen, der Vorsitzender Industriegewerkschaft Metall Klaus Zwickel, der Vorsitzende der Industriegewerk- schaft Bergbau, Chemie, Energie Hubertus Schmoldt und der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr Herbert Mal. Außerdem nahmen die Minister Lafontaine, Müller, Riester, A. Fischer und Hombach den dem Gespräch teil.
83 Siehe hierzu auch: Marc Beise, Peter Thelen in: Handelsblatt vom 26./27.02.1999 und Margarethe van Ackeren in:Rheinische Post vom 26.02.1999
83 hierzu ausführlich: Anne Daniels i n: Die Zeit vom 30.09.1999 und
85 Bodo Hombach in einem Interview mit der Rheinischen Post vom 04.01.1999
86 so Knaup, Niejahr, Schäfer i n: „Schröders Denkfabrik“ aus: Der Spiegel 19/1999, S. 33f.
87 Knaup, Niejahr, Schäfer, ebda.
88 Zitat Streeck in Der Spiegel 19/1999 a.a.O.
89 Knaup, Niejahr, Schäfer, ebda.
90 Hierzu ausführlicher: Visser, Jelle, „15 Jahre „Bündnis für Arbeit“ in den Niederlanden“ in:Gewerkschaftliche Monatshefte 10´98, S.661f.
91 Visser, Jelle, a.a.O.
92 Visser, Jelle, a.a.O., S. 665
93 Lind, Jens „Der Sozialpakt in Dänemark“ in: Gewerkschaftliche Schriften 11´98, S.672
94 Lind, Jens, a.a.O.
95 Lind, Jens , a.a.O., S.672 f.
96 vgl. hierzu: Lind, Jens, a.a.O., S.672 f. und http://www.cdu.de/politik/
97 Vgl. Neumann, Helmut, Deregulierung des Bestandschutzes?, WSI-Mitteilungen 6/1990,S.400.
98 Vgl. ebda.
99 Vgl. Neumann, Helmut,a.a.O.,S.400.
100 Vgl. ebda.
101 Vgl. Kittner Michael, Einleitung zum BeschFG 1985, Frankfurt am Main, 1999, S.909f.
102 Vgl. Kittner, Michael, a.a.O., Einleitung zum BGB, S.580.
103 Vgl. §1 Abs.2 BeschFG.
104 Vgl. Kittner Michael, Einleitung zum BeschFG 1985, Frankfurt am Main, 1999, S.909f
105 Vgl. Halbach, Günther, Beschäftigungsförderungsgesetz 1985, Bonn, 1985.
106 Vgl. Bielensky, Harald, Deregulierung des Rechts befristeter Arbeitsverträge“, WSI-Mitteilungen, 1997, S.533.
107 Vgl. Neumann, Harald, a.a.O,S.401.
108 Vgl. Herschel, Wilhelm, Die Gefährdung der Rechtskultur, Arbeit und Recht, 1985, S265f.
109 Vgl. Heise, Dietmar/Lessenich, Holger/Merten, Phillip, Erleichterte Zulassung befristeter Arbeitsverhältnisse, Arbeitgeber, 4/49, 1994, S.94.
110 Vgl. ebda.
111 Wlotzke, Ottfried, das gesetzliche Arbeitsrecht in einer sich wandelnden Arbeitswelt, Der Betrieb, 1985, S.758.
112 Vgl. Bielensky, Harald, a.a.O., S.534f.
113 Vgl. ebda.
114 Vgl. ebda.
115 Vgl. ebda.
116 Vgl. Bielensky, Harald, a.a.O., S.534f
117 Vgl. Kittner Michael,a.a.O., S.912.
118 Vgl.Keller, Bernd/Seifert, Hartmut, Regulierung atypischer Beschäftigungsverhältnisse, WSI-Mitteilungen, 9/1993, S.538f.
119 Vgl. Strategiepapier der Arbeitsgruppe Benchmarking des „Bündnisses für Arbeit“, Unausgeschöpfte Potentia- le, 1999, http:// www.ig.metall.de.
120 Vgl. Strategiepapier der Arbeitsgruppe Benchmarking des „Bündnisses für Arbeit“, a.a.O.
121 Vgl. Daniels, Arne, Für eine neue Solidarität, Die Zeit Nr.16. 15.04.1999, S.38.
122 Vgl. Daniels, a.a.O.
123 Vgl. Daniels, Arne, Der kalkulierte Totalschaden, Die Zeit Nr.40, 30.09,1999, S.23.
124 Vgl.ebda.
125 Vgl. Allgemeine Zeitung, 30.09.1999, http:// www.igmetall.de
126 Vgl.ebda.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der historische Kontext des "Bündnisses für Arbeit"?
Der Neokorporatismus, die Beteiligung von Interessengruppen an der Politik, prägte die Nachkriegszeit und führte zur "Konzertierten Aktion" (1967-1977), ein Versuch, Inflation und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dieses scheiterte 1977. Der Vorschlag zur Schaffung eines „Bündnisses für Arbeit“ wurde erstmalig am 30. Oktober 1995 von dem IG Metall - Vorsitzenden Klaus Zwickel gemacht.
Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen der "Konzertierten Aktion" und dem "Bündnis für Arbeit" von 1998?
Das "Bündnis für Arbeit" sieht sich größeren Problemen und schwierigeren Ausgangslagen gegenüber als die "Konzertierte Aktion". Die Komplexität der Probleme hat sich deutlich gesteigert.
Wie ist das "Bündnis für Arbeit" strukturiert und aufgebaut?
Das Kanzleramt ist der politische Organisator. Die Struktur umfasst Spitzengespräche, eine Steuerungsgruppe und Arbeitsgruppen. Eine Benchmarking-Gruppe unterstützt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Welche Perspektiven vertreten die Wirtschaftsverbände im "Bündnis für Arbeit"?
Die Wirtschaftsverbände fordern eine Reform des Sozialstaates, insbesondere eine Senkung der Unternehmenssteuerlast und eine Reform der Tarifpolitik, einschließlich der Flexibilisierung der Arbeitszeiten und der Einrichtung eines Niedriglohnsektors. Sie wollen die Unternehmen entlasten.
Welche Forderungen erheben die Gewerkschaften im "Bündnis für Arbeit"?
Die Gewerkschaften betonen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik und fordern eine gerechte Verteilung von Arbeit und Einkommen, innovative Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, eine sozialverträgliche Umwelt- und Energiepolitik, zukunftsfähige Aus- und Weiterbildung, einen funktionsfähigen Sozialstaat, eine gerechtere Vermögensverteilung und einen sozialen europäischen Einigungsprozess. Sie wollen die Tarifautonomie wahren.
Welches Programm verfolgt die Bundesregierung im "Bündnis für Arbeit"?
Die Bundesregierung setzt auf eine umfassende Steuerreform, den Aufbau Ost, eine verbesserte Ausbildungspolitik und Reformen der sozialen Sicherungssysteme. Sie will die Massenarbeitslosigkeit bekämpfen und den Standort Deutschland stärken.
Welche Ergebnisse wurden bei den Spitzengesprächen des "Bündnisses für Arbeit" erzielt?
Es gab Verständigungen über einen Abbau der Arbeitslosigkeit, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, eine Reform der Sozialversicherung, die Verbesserung der Vermögensbildung und Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer, eine Unternehmenssteuerreform, die Verbesserung der Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen, eine beschäftigungsfördernde Arbeitszeitverteilung und neue Initiativen im Kampf gegen Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit. Ein „Bündnis im Bündnis“ zwischen DGB und BDA festigte die Zusammenarbeit.
Welche internationalen Beispiele für ein "Bündnis für Arbeit" gibt es?
Die Niederlande (Konsensökonomie, Sociaal-Ekonomische Raad) und Dänemark (Sozialpakt zwischen Kooperation und Wettbewerb) werden als Vorbilder genannt. Auch Finnland, Griechenland, Portugal, Italien, Norwegen und Irland haben ähnliche Modelle implementiert.
Welche alternativen Konzepte zur Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik werden diskutiert?
Die Deregulierung und Flexibilisierung arbeitsrechtlicher Normen (neo-liberales Konzept), die Einführung eines Freibetrages bei den Sozialabgaben auf niedrig entlohnte Arbeit (Benchmarking-Gruppe) und die "Rente mit 60" (Gewerkschaften) werden als Optionen betrachtet.
Was ist die Schlussfolgerung des Dokuments?
Das Dokument schließt mit der Feststellung, dass das "Bündnis für Arbeit" trotz der schwierigen Kompromissfindung der Verbände nicht zum Scheitern verurteilt ist. Die Verhandlungspartner müssen sich auf die gesteckten Ziele konzentrieren und konkrete Schritte umsetzen, um die Spitzengespräche nicht zu einem "Debattierclub" werden zu lassen. Die Idee für ein Bündnis für Arbeit wird gewürdigt, es gibt aber noch viel zu tun.
- Citar trabajo
- Ulf-Dieter Reimer (Autor), 1999, Das Bündnis für Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96575