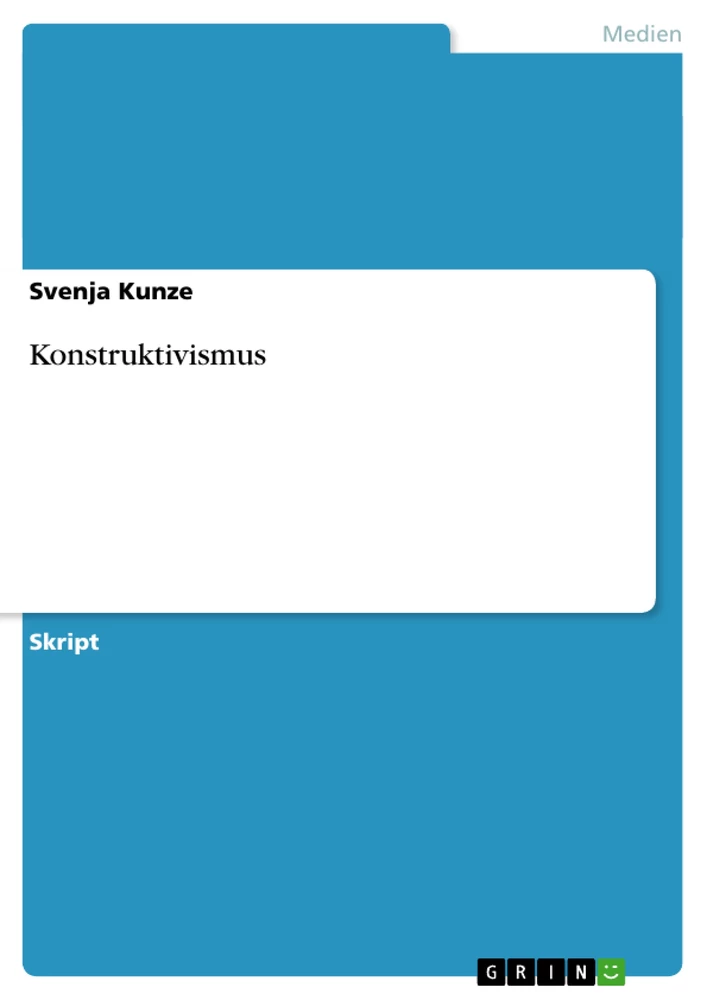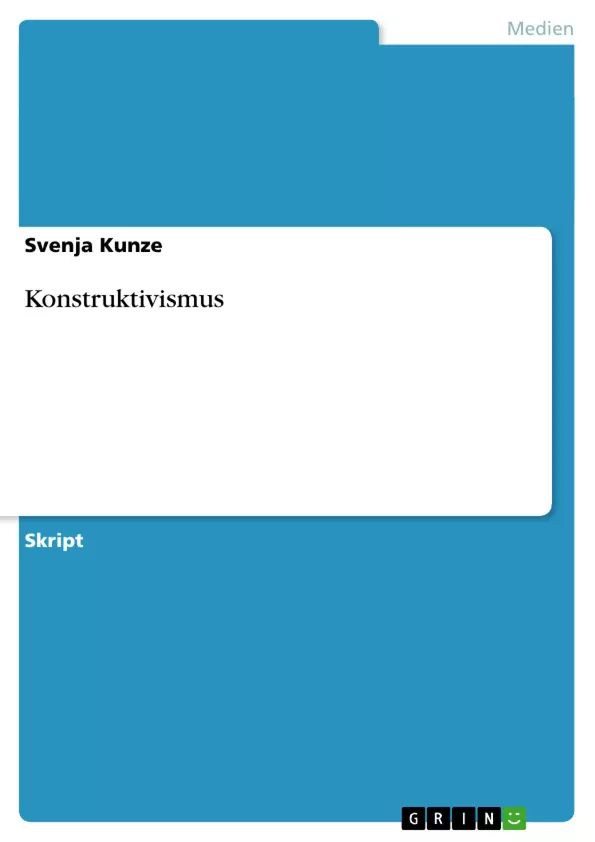Konstruktivismus
1. Grundannahmen und Fragestellungen
Die Welt, die uns umgibt, ist nicht so wahrnehmbar, wie sie ist. Wir können sie nur beobachten und unser eigenes Abbild konstruieren. "Wirklichkeit" ist die aus unserem eigenen Denken und Merken konstruierte Umwelt. "Realität" ist das, von dem wir annehmen, das es hinter der "Wirklichkeit" liegt, über das man aber keine Aussagen machen kann.
Der radikale Konstruktivismus will diese Trennung zwischen "Wirklichkeit" und "Realität" vollkommen durchführen und besteht darauf, daß Wissen sich ausschließlich auf die "Wirk- lichkeit" beziehen kann. Der rKonst. ist dabei eher ein interdisziplinärer Diskurs als eine ab- geschlossene Theorie; die Grundlagen liegen sowohl in den Naturwissenschaften als auch in den Kultur-/ Sozialwissenschaften.
Als Grundfrage des Kostr. könnte man formulieren: Wie kann man empirisch erklären, was kognitiv/ kommunikativ geschieht, wenn wir wahrnehmen/ erkennen/ interagieren/ kommunizieren?
2. Grundlagen
2.1 Neurobiologische und kybernetische Voraussetzungen
Direkten Kontakt zur "Umwelt" haben nur die Sinnesrezeptoren, die jeweils nur auf eine spezifische Reizart (physikalische/ chemische Veränderungen) und auch da nur auf ein bestimmtes Spektrum (z.B. Schallwellen mit der Frequenz von 50Hz bis 18.000 KHZ) reagieren. Die Sinnesrezeptoren geben nur unspezifische, quantitative Reize an das Gehirn weiter (-> "Prinzip der undifferenzierten Codierung", von Foerster, Kybernetiker). Diese Reize sind Spannungsänderungen der Zellmembran, ein "neuronaler Einheitscode" (Roth), der keine Bedeutung im Sinne von "Der Ball ist rund" übermittelt.
Das neuronale System des Menschen arbeitet zirkulär, d.h. Nervenzellen interagieren aus- schließlich mit Nervenzellen, und läßt sich mit den Begriffen der organisationellen Geschlossenheit, Selbstreferenz und Autonomie charakterisieren (Varela/ Maturana, Biologen). Daraus folgt insgesamt, daß die eigentliche Leistung beim Erkennen nicht von den Sinnesorganen, sondern vom Gehirn erbracht wird. Es gibt keinen direkten Input, erst das Gehirn verarbeitet die unspezifischen Reize, die die Sinnesrezeptoren von der "Umwelt" übermitteln, nach internen Regeln zu Bedeutung: "Wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn."
2.2 Die Theorie des Unterscheidens
Frage: Wie kommt Wahrnehmung zustande, wenn es keinen Bedeutungstransfer gibt?
Maturana beginnt mit der Untersuchung von Wahrnehmungsprozessen mit dem lebenden Indi- viduum, dem Beobachter. Seiner Auffassung nach ist Beobachten eine Form von Aktivität, ein intentionaler Akt, denn der Prozeß des Beobachtens ist die Erzeugung von Einheiten, mit denen Beobachter interagieren. Voraussetzung für das Erkennen eines Gegenstandes ist, diesen beschreiben zu können. Um ihn beschreiben zu können, muß er von seinem Hintergrund unter- schieden werden. Beobachten ist "Bezeichnung anhand einer Unterscheidung" (Luhmann nach Spencer Brown/"draw a distiction").
Die Unterscheidung ist eine Grundoperation, die nicht mehr gelöscht werden kann und eine grundlegende Asymmetrie einführt. Man beobachtet, ist eine Unterscheidung erstmal gezogen, immer entweder die eine oder die andere Seite. Die jeweils benutzte Unterscheidung kann im Unterscheidungsprozeß nicht zugleich beobachtet werden, das ist der "Blinde Fleck" der Unterscheidung.
2.3 Beobachterproblem
Der Beobachter eines Systems kann nicht gleichzeitig das System beobachten und sich gleichzeitig beim Beobachten beobachten (-> "Blinder Fleck"). Der Beobachter und das Beobachten werden als ein Teil des Systems betrachtet, das wiederum beobachtet werden kann - von einem Beobachter 2. Ordnung. Dieser kann nun Aussagen über den Beobachter erster Ordnung machen, sich selbst aber nicht beim Beobachten beobachten, auch seine Beobachtung hat also einen "Blinden Fleck" usw.usf...
3. Bewußtsein und Kommunikation
3.1 Bewußtsein und Bewußtseinsbildung
Das Bewußtsein ist eine Konstruktion des Gehirns, d.h. das Gehirn als operational geschlossenes System erhält über Sinnesorgane Reizquanten und verwandelt diese in qualitative Zustände, die Bewußtseinsinhalte. Bewußtsein ist Voraussetzung für Kommunikation, ohne Bewußtsein kann keine Kommunikation stattfinden; Kommunikation/ Interaktion ist aber genauso Voraussetzung für Bewußtsein, denn ohne den Bezug zu anderen Individuen kann man keine Vorstellung von Objekten, Raum, Zeit, Ich...Bewußtsein entwickeln. Bewußtsein bildet sich durch Erfahrungen. Das Individuum handelt auf der Bewußtseinsebene immer auf Basis bereits gemachter Erfahrungen, Kognitionen erzeugen Kognitionen durch Selbstbezug. Man lebt im Bewußtsein nie im selben Zeitfenster wie das Gehirn, denn erst muß das Gehirn auf der neuronalen Ebene arbeiten, dann tritt die Wahrnehmung von Bewußseinsinhalten ein. Diese "Zeitverschiebung" ist der Grund, warum das Bewußtsein nicht intentional auf die neuronalen Operationen des Gehirns zugreifen kann.
3.2 Kommunikation
Kommunikation im konstruktivistischen Sinne bedeutet weder Übertragung von Bedeutung noch gemeinsames Verstehen noch Austausch von Sinn. Vielmehr ist Kommunikation Ausdruck des Bewußtseins eines Individuums, also ein Prozeß individueller Sinnkonstruktion aus Anlaß der Wahrnehmung eines Medienangebots in einer Kommunikationssituation. Sie bietet den Teilnehmern subjektabhängige Möglichkeiten, jeweils eigene Informationen zu produzieren. Kommunikation ist soziales Handeln mit der Absicht der Verständigung. Verständigung ist aber nur dann möglich, wenn wir uns mit anderen ein konsentuiertes Wirklichkeitsmodell als Grundlage allen Handelns teilen. Entscheidende Kriterien zur Brauchbarkeit solcher Wirklichkeitsmodelle sind Konsens, Brauchbarkeit, Nützlichkeit (und nicht Wahrheit/ Objektivität). Im Kommunikationsprozeß sind drei Aspekte zu unterscheiden:
- Die Herstellung von Beziehungen zwischen den Kommunikationspartnern
- Die (individuelle) Produktion von Information aus Anlaß von Medienangeboten
- Die Handlung als Folge von Kommunikationsprozessen
Kommunikation entwickelt sich immer weiter und ist dabei gebunden an den jeweiligen Stand der Wissenschaft, die gesellschaftliche Situation, kulturelle Voraussetzungen.
4. Sprache
Entsprechend dem Konstruktivismus hat jeder aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen andere Vorstellungen von einem Begriff. Durch neue Assoziationen verändern sich diese Vor-stellungen ständig. Durch den Spracherwerb lernt man die Bedeutung eines Begriffs, die als sozial viabel gilt. Sprache ist laut Schmidt ein Mittel, das die Benennung von Unterscheidungen (also das Beob- achten?) materialisieren und für andere wahrnehmbar machen kann. So entsteht letztlich ein Netz von Unterscheidungen und deren Bezeichnungen, die Gesellschaft baut ihr Wirklichkeitsmodell auf.
5. Kultur
Kultur ist das akzeptierte und gesellschaftlich verbindliche Programm zur Interpretation von Entscheidungssystemen (= Wirklichkeitsmodellen?). Kultur im Sinne des erweiterten Kultur- begriffs ist dabei nicht beschränkt auf kulturelle Erscheinungsformen/ Kunst, sondern muß als ein Generierungsprogramm aufgefaßt werden. Kultur und gesellschaftliches Wirklichkeitsmodell entstehen gleichzeitig.
Kultur wird als Programm konzipiert, um eine Gleichsetzung mit den Erscheinungsformen, die aus der Anwendung des Programms resultieren, zu vermeiden. Kultur ist gleichzeitig verbindlich und statisch, aber auch dynamisch während die Codierung, quasi die Hardware, indifferent ist. Unterscheidungen sind kulturübergreifend, die Bewertung der Unterscheidungen durch das Programm Kultur machen die Eigenart einer Gesellschaft aus ("seman-tische Spezifik"). Analog zur Gesellschaft differenziert sich die Kultur in Subsysteme aus, was einerseits die Lei- stungsfähigkeit erhöht, andererseits aber auch das Kulturprogramm als Ganzes unbeobachtbar macht.
"Der Mensch ist Sch ö pfer aller Kultur, aber jeder Mensch ist Gesch ö pf einer spezifischen Kultur." (Schmidt)
6. Medien
Medien nach der Definition von Schmidt sind Kommunikationsmittel, Medienangebote, Ge-räte und Techniken, Organisationen. Medien koppeln Bewußtsein und Kommunikation. Me-dienan- gebote zählen zur Umwelt von Kognition und Kommunikation von Individuen. Sie können bei ihren Nutzern Anlässe für Kommunikationsprozesse liefern. Die Bedeutung steckt nicht im Medienangebot, sondern wird erst durch den Nutzer konstruiert. Was also ein Angebot bedeutet, ist nicht verallgemeinerbar.
Massenmedien haben die Funktion, ein angeblich allen gemeinsames Wirklichkeitsmodell zu unterstellen; die Inszenierung von Wirklichkeiten gibt soziale Orientierung. Medienwirklichkeit kann nie "richtig" oder "wahr" sein, sie muß aber viabel sein
"Mit dem Fernsehen ö ffnet sich kein Fenster zur Welt, sondern ein Fenster zu unserer Kultur". (Schmidt)
7. Anwendung in Kommunikationswissenschaft und -Praxis
Kommunikationswissenschaftler brauchen keine neuen Methoden, müssen sich aber bewußt sein, daß auch sie nur konstruieren und als Beobachter zweiter Ordnung an den Blinden Fleck gebunden sind.
- Wirkungsforschung:
Vom Ansatz her lautet die Fragestellung. "Was machen die Menschen mit den Medien?". Da in Medienangeboten keine objektive Bedeutung steckt, kann es auch keine verallge- meinerbare Wirkung geben. Wirkungen sind Zeit-, Kontext- und Nutzer abhängig. Wirkungen beeinflussen Wirkungen (Merten).
- Nachrichtenwertforschung:
Fragestellung: nach welchen Regeln konstruieren Medien Wirklichkeit?
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Grundannahmen des Konstruktivismus laut diesem Text?
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, nicht die "wahre" Welt ist, sondern eine Konstruktion unseres eigenen Denkens und Erinnerns. "Wirklichkeit" ist die konstruierte Umwelt, während "Realität" das ist, was angeblich dahinter liegt, über das aber keine Aussagen gemacht werden können. Der radikale Konstruktivismus betont die Trennung zwischen "Wirklichkeit" und "Realität" und konzentriert sich auf die "Wirklichkeit".
Was ist die Grundfrage des Konstruktivismus?
Die Grundfrage lautet: Wie kann man empirisch erklären, was kognitiv/kommunikativ geschieht, wenn wir wahrnehmen/erkennen/interagieren/kommunizieren?
Welche neurobiologischen und kybernetischen Voraussetzungen werden im Text genannt?
Nur Sinnesrezeptoren haben direkten Kontakt zur "Umwelt" und reagieren selektiv auf Reize. Sie geben unspezifische Reize an das Gehirn weiter. Das neuronale System arbeitet zirkulär, ist organisationell geschlossen, selbstreferentiell und autonom. Die eigentliche Leistung beim Erkennen wird vom Gehirn erbracht, nicht von den Sinnesorganen. "Wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Gehirn."
Was ist die Theorie des Unterscheidens?
Beobachten ist eine Form von Aktivität, ein intentionaler Akt, der die Erzeugung von Einheiten beinhaltet. Voraussetzung für das Erkennen ist die Unterscheidung eines Gegenstands von seinem Hintergrund. Beobachten ist "Bezeichnung anhand einer Unterscheidung". Die Unterscheidung ist eine Grundoperation, die eine Asymmetrie einführt. Die benutzte Unterscheidung kann im Unterscheidungsprozess nicht gleichzeitig beobachtet werden, was den "Blinden Fleck" darstellt.
Was ist das Beobachterproblem?
Der Beobachter eines Systems kann nicht gleichzeitig das System beobachten und sich selbst beim Beobachten beobachten (-> "Blinder Fleck"). Der Beobachter und das Beobachten werden als Teil des Systems betrachtet, das wiederum beobachtet werden kann (von einem Beobachter 2. Ordnung). Dieser Prozess setzt sich fort.
Wie wird Bewusstsein und Bewusstseinsbildung im Konstruktivismus erklärt?
Bewusstsein ist eine Konstruktion des Gehirns. Reizquanten werden in Bewusstseinsinhalte umgewandelt. Bewusstsein ist Voraussetzung für Kommunikation, und Kommunikation ist Voraussetzung für Bewusstsein. Bewusstsein bildet sich durch Erfahrungen. Das Individuum handelt auf der Bewusstseinsebene auf Basis bereits gemachter Erfahrungen. Es gibt eine "Zeitverschiebung" zwischen neuronalen Operationen und Bewusstseinsinhalten.
Wie wird Kommunikation im konstruktivistischen Sinne verstanden?
Kommunikation ist weder Übertragung von Bedeutung noch gemeinsames Verstehen noch Austausch von Sinn, sondern Ausdruck des Bewusstseins eines Individuums. Sie ist ein Prozess individueller Sinnkonstruktion. Verständigung ist möglich, wenn ein konsentuiertes Wirklichkeitsmodell geteilt wird. Kriterien zur Brauchbarkeit sind Konsens, Brauchbarkeit, Nützlichkeit. Aspekte der Kommunikation sind Beziehungsherstellung, Informationsproduktion und Handlung.
Welche Rolle spielt Sprache im Konstruktivismus?
Jeder hat aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen andere Vorstellungen von einem Begriff. Durch Spracherwerb lernt man die Bedeutung eines Begriffs, die als sozial viabel gilt. Sprache ist ein Mittel, das die Benennung von Unterscheidungen materialisieren und wahrnehmbar machen kann.
Was versteht der Text unter Kultur?
Kultur ist das akzeptierte und gesellschaftlich verbindliche Programm zur Interpretation von Entscheidungssystemen (=Wirklichkeitsmodellen). Kultur ist ein Generierungsprogramm, das gleichzeitig mit dem gesellschaftlichen Wirklichkeitsmodell entsteht. Kultur ist sowohl verbindlich und statisch als auch dynamisch. Die Bewertung der Unterscheidungen durch das Programm Kultur macht die Eigenart einer Gesellschaft aus.
Wie werden Medien im Konstruktivismus definiert?
Medien sind Kommunikationsmittel, Medienangebote, Geräte und Techniken, Organisationen. Medien koppeln Bewusstsein und Kommunikation. Medienangebote können bei Nutzern Anlässe für Kommunikationsprozesse liefern. Die Bedeutung steckt nicht im Medienangebot, sondern wird durch den Nutzer konstruiert. Massenmedien haben die Funktion, ein angeblich allen gemeinsames Wirklichkeitsmodell zu unterstellen.
Wie wird der Konstruktivismus in der Kommunikationswissenschaft angewendet?
Kommunikationswissenschaftler müssen sich bewusst sein, dass auch sie nur konstruieren und an den Blinden Fleck gebunden sind. In der Wirkungsforschung wird gefragt: "Was machen die Menschen mit den Medien?". Wirkungen sind Zeit-, Kontext- und Nutzer-abhängig. In der Nachrichtenwertforschung wird gefragt: nach welchen Regeln konstruieren Medien Wirklichkeit? Objektivität ist eine Illusion.
- Quote paper
- Svenja Kunze (Author), 2000, Konstruktivismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96594