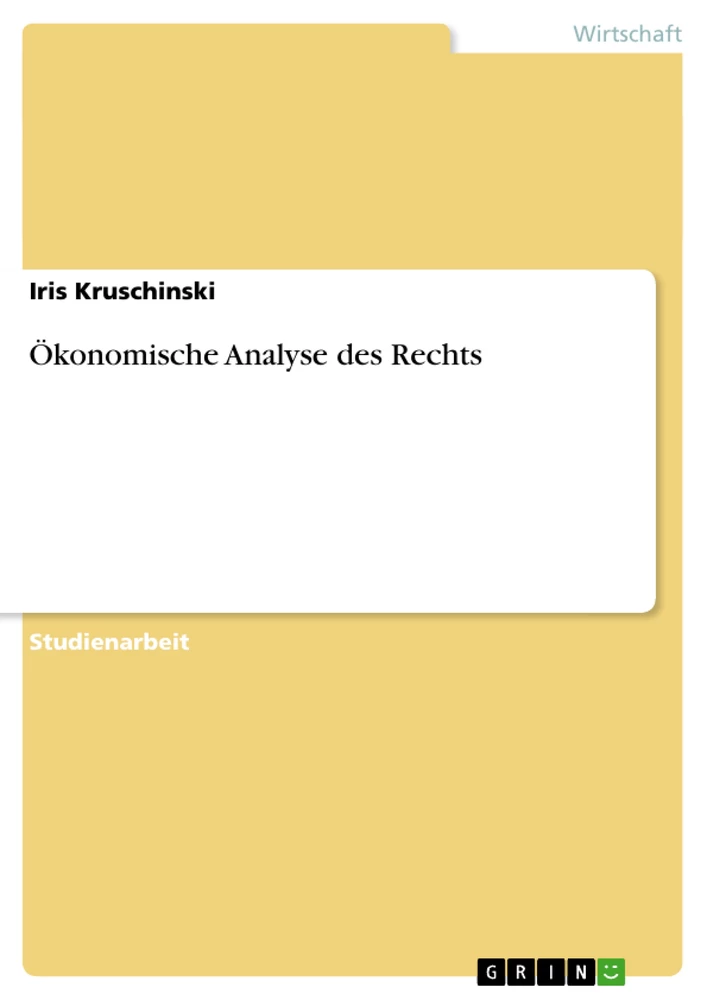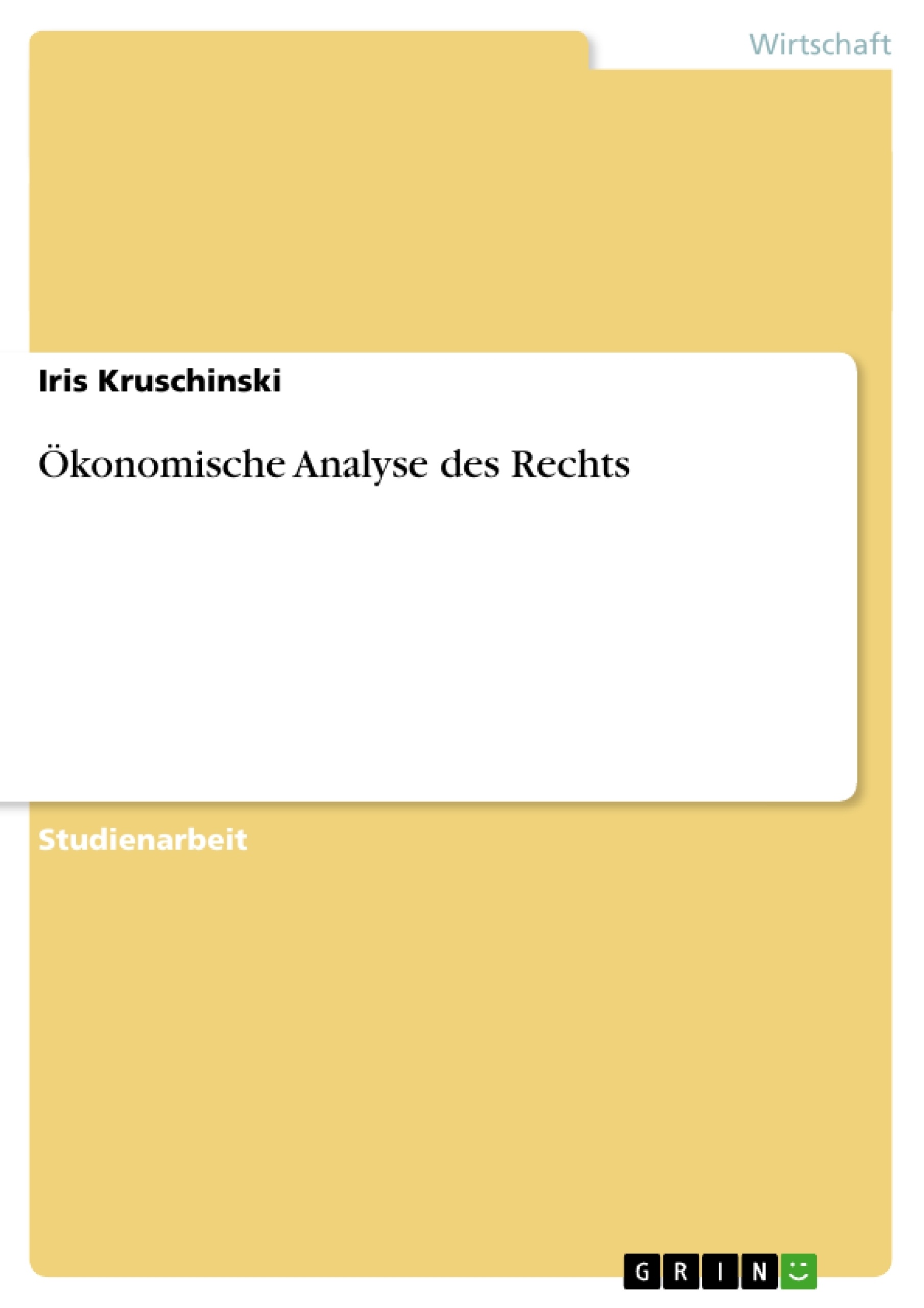Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung
1.1 Hinführung zum Thema
1.2 Gang der Untersuchung
2. Grundlagen der ökonomischen Analyse des Rechts
2.1 Das ökonomische Verhaltensmodell "homo oeconomicus"
2.2 Das ökonomisch Effizienzziel
2.2.1 Effizienz
Exkurs: externe Effekte
2.2.2 Verteilung
2.2.3 Gerechtigkeit
3. Gibt es einen juristischen Effizienzbegriff ?
4. Folgerungen für die Justiz
5. Anforderungen an das Recht
6. Praxisbeispiel: schönes sauberes Singapur
7. Schlussbetrachtung Literaturverzeichnis
1. Einführung
1.1 Hinführung zum Thema
Die mikroökonomische Theorie beschäftigt sich seit langem damit, exakt die Bedingungen zu beschreiben, unter denen eine Gesellschaft "das ökonomische Effizienzziel" erreicht. Allerdings legt sie hierbei "vollkommene Konkurrenz" zugrunde. Unter diesen vorgegebenen Bedingungen erreicht eine Gesellschaft auch das Ziel der Effizienz, jedoch ist in der Realität keine der vielen Voraussetzungen für eine vollständige Konkurrenz erfüllt. Weiterhin setzt die Theorie der Ökonomische Analyse des Rechts Iris Kruschinski "vollständigen Konkurrenz" einen bestimmten rechtlichen Rahmen voraus1. Dieser vernachlässigt aber, dass durch die Justiz erlassene Rechtsnormen und - vorschriften nicht nur den Nutzen und den Preis von Gütern, sondern auch menschlichen Handlungen beeinflussen. Es stellt sich also nun die Frage, wie sich Änderungen der Rechtsnormen - und vorschriften auf die Handlungen von Personen der Gesellschaft und damit auf das Ziel der ökonomischen Effizienz auswirken.
Ende der siebziger Jahre begannen ökonomische Wissenschaftler intensiv, sich mit dieser Frage zu beschäftigen und mit Hilfe der daraus entwickelten "ökonomische Analyse des Rechts" wird seitdem versucht, Ökonomie, Recht und menschliche Handlungen in Bezug zueinander zusetzen.
1.2 Hinführung zum Thema
Der erste Abschnitt dieser Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der ökonomischen Analyse des Rechts. Auch die Frage, ob es einen juristischen Effizienzbegriff gibt, wird hier kurz angesprochen. Daran anschließend sollen die sich - aus den gewonnen Ergebnissen des ersten Abschnitts - ergebenen Folgerungen und Anforderungen an die Gesetzgeber und die Justiz untersucht werden. Anhand eines Praxisbeispiels "Schönes sauberes Singapur" werden die erläuterten Aspekte noch einmal dargestellt werden. Der letzte Abschnitt stellt eine Zusammenfassung und Schlussbetrachtung dar.
2. Grundlagen für die ökonomische Analyse des Recht
Die ökonomische Analyse des Rechts ist ein Teilgebiet der Ökonomik und beschäftigt sich mit positiven und normativen Fragestellungen . Die positive Fragestellung ist, welche Folgen rechtliche Regeln auf die Realität haben. Sie unterstellt hierbei, dass Individuen rational und eigennützig handeln und legt ihren Analysen das ökonomische Verhaltensmodell des "homo oeconomicus" zugrunde. Aber auch normative Aussagen werden gemacht. So werden nicht nur die Folgen ermittelt, sondern es erfolgt auch eine Bewertung danach, "ob sie einem in einer bestimmten Weise definierten ökonomischen Effizienzkriterium genügen".2 Hierbei stützt sich die ökonomische Analyse des Rechts auf die Erkenntnisse der Wohlfahrtsökonomik.
2.1 Das ökonomische Verhaltensmodell "homo oeconomicus"
Das Verhaltensmodell des "homo oeconomicus" ist die erste wichtige Säule der ökonomischen Analyse des Rechts. Auf seiner Grundlage ermittelt die ökonomische Analyse des Rechts die durch Rechtsnormen und juristische Regelungen ausgelösten Folgen in der Rechtswirklichkeit. Die größte Rolle spielt der "homo oeconomicus" bei der Beschreibung des Verhaltens von Unternehmen und Haushalten auf Märkten, also in der Mikroökonomik. Der amerikanische Nobelpreisträger Gary S. Becker war einer der ersten Wissenschaftler, die dieses Modell ausgedehnt haben. "Im Zentrum von Beckers Arbeit steht der Gedanke, dass das ökonomische Verhaltensmodell ein universell anwendbares Modell menschlichen Verhaltens ist und dass Individuen nicht nur im Wirtschaftsleben, sondern auch in andren Lebensbereichen rational und nutzenmaximierend handeln."3
Rationalität bedeutet, dass jeder Konsument eine vollständige und transitive Präferenzordnung besitzt. Wird er vor die Wahl von 2 Handlungsalternativen A und B gestellt, muss er in der Lage sein, anhand einer ordinalen Skala anzugeben, ob er die Alternative A B vorzieht oder umgekehrt B A oder ob er zwischen beiden Alternativen indifferent ist. Einen solchen ordinalen Vergleich muss er für alle Handlungsalternativen anstellen können. Die sich daraus ergebene Präferenzordnung aller Alternativen ist transitiv. Wenn er A B vorzieht und B C vorzieht, dann bevorzugt er auch A vor C.4
Nutzenmaximierung bedeutet auf dieser Grundlage, dass ein Konsument sich für die Handlungs- alternative entscheidet, die er am meisten präferiert. Diese Entscheidung ist allerdings nicht nur von der Präferenzordnung, sondern auch von äußeren Umständen abhängig. Güter sind knappe Ressourcen und daher beschränkt. Sie haben daher einen Preis. Der Konsument jedoch hat nur ein bestimmtes Einkommen zur Verfügung und kann sich daher nur bestimmte Güterkombinationen leisten. Er wird sich für die Güterkombination entscheiden, die bei einem bestimmen vorgegebenen Einkommen und den gegebenen Preisen seinen Präferenzen am meisten entspricht.5
2.2 Das ökonomisch Effizienzziel
Die Ermittlung der sich aus Rechtsnormen ergebenen Folgen anhand des ökonomischen Verhaltensmodels "homo oeconomicus" stellt nur den ersten Schritt der ökonomischen Analyse des Rechts dar. An sie schließt sich die Bewertung an. Eine Bewertung kann jedoch nur erfolgen, wenn Bewertungsmaßstäbe zugrunde liegen.
"Ausgangspunkt ist dabei die Überlegung, dass jeder gesellschaftlichen Ordnung eine Vorstellung über ihren optimalen Gesamtzustand zugrunde liegt. Der Inhalt dieser Vorstellung definiert - ökonomisch gesprochen - das gesellschaftliche Wohlfahrtsoptimum."6
Problematisch ist bei der Bestimmung des Wohlfahrtsoptimum, dass nicht ein einzelner Wertmaßstab zugrunde gelegt werden kann, sondern dass es verschiedene Kriterien gibt, die auch noch im Konflikt miteinander stehen können. Für die Gestaltung der Rechtsordnung haben diese Kriterien den Charakter regulativer Ziele, an denen sich die Rechtsnormen orientieren sollen. Nachfolgend soll auf die entscheidensten Kriterien eingegangen werden.
2.2.1 Effizienz
Das Ziel einer Gesellschaft ist es, die vorhandenen knappen Güter so als Produktionsmittel einzusetzen, dass sie im Sinne der Optimierung der gesellschaftlichen Wohlfahrt möglichst nutzenbringend verwendet werden. Mit der Identifizierung von Kriterien für die Bestimmung eines solchen "Allokationsoptimums" beschäftigt sich die Wohlfahrtsökonomik schon sehr lange. Doch wird auch heute noch zur Formulierung des Effizienzkriteriums auf die bereits vor rund 95 Jahre von Vilfredo Pareto entwickelte Formel zurückgegriffen.7
Eine ökonomische Situation ist Pareto-effizient, wenn es keine Möglichkeit gibt, zumindest eine Person besser zu stellen, ohne jemand anderen schlechter zu stellen.8 Umgekehrt heißt dies, dass eine Situation Pareto-ineffizient ist, wenn es noch eine Möglichkeit gibt, zumindest eine Person besser zu stellen, ohne jemand anderen zu benachteiligen.
Besonders entscheidend an dieser Formel ist, dass es keinen gesellschaftlichen Wohlstand geben kann, der unabhängig vom Nutzen der einzelnen Individuen ist. Nur ein Individuum an sich kann entscheiden, ob eine Zustandsveränderung einen Nutzengewinn mit sich führt oder nicht.
Das Allokationsoptimum verweist somit auf soziale Entscheidungsverfahren, die bestimmte Bedingungen erfüllen müssen, damit der Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher und individueller Wohlfahrtsfunktion gewährleistet ist. Die Ökonomie schreibt gerade in diesem Zusammenhang der Justiz eine zentrale sozialorganisatorische Funktion zu.9
An einem einfachen Beispiel soll jedoch die Problematik dieser Pareto-Formel gezeigt werden. Das Grundgesetz gibt durch Artikel 14 III 1 und 2 die Möglichkeit zur Enteignung.
"Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaßder Entschädigung regelt."
Sofern durch diese Entschädigung einerseits der Enteignete indifferent ist, zwischen dem Zustand vor und dem Zustand nach der Entschädigung und anderseits Dritte dadurch profitieren - z.B. Ausbau einer vielbefahrenen Straße mit morgendlichen Staus - ist das Pareto-Kriterium erfüllt und der Sachverhalt ist somit effizient. Doch wie bereits oben erwähnt, impliziert diese Formel, dass es keinen gesellschaftlichen Wohlstand geben kann, der unabhängig vom Nutzen der Individuen ist. Doch dieses kann am Beispiel der Enteignung widerlegt werden.
Die Durchführung eines staatlichen Projektes, wie z.B. die Verbesserung der Infrastruktur, dient dem Gemeinwohl und verbessert somit die gesellschaftlichen Wohlfahrt. Aber die Verwirklichung eines größeren Projektes führt zu Beeinträchtigung unterschiedlichster Art. Von schwerwiegensten finanziellen Einbußen durch Grundstücksenteignung bis hin zu ideellen Beeinträchtigungen wie "Umweltverschandelung". Wenn alle Personen, deren Interessen auch nur marginal berührt werden, entschädigen werden würden - wie es der Grundsatz der Pareto-Effizienz fordert -, wäre dies mit erheblichen Kosten verbunden, die letztendlich die Gesellschaft tragen muss. Dieser Problematik hat sich bereits das Bundesverwaltungsgericht angenommen, nach dessen Urteilssprechung eine - zu Schutzvorkehrungen bzw. Geldentschädigungen verpflichtende - nachteilige Wirkung auf Rechte anderer nur bei erheblichen und deshalb nicht mehr zumutbaren Beeinträchtigungen vorliegt. Unterbleibt gemäß dieser Rechtsprechung aber die Entschädigung, so ist diese Maßnahme Pareto- ineffizient.
Diese Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes orientiert sich an einem erweiterten Effizienzkriterium, welches Nicholas Kaldor und John Hicks entwickelt haben.
Wie bereits gezeigt weist das Pareto-Kriterium "Schwachstellen" auf. Für die Bewertung verschiedener sozialer Zustände ist es für die Wirtschafts- und Rechtspolitik unbrauchbar. Rechtliche Regeln oder wirtschaftliche Großprojekte zur Verbesserung der Gesellschaftswohlfahrt betreffen eine Vielzahl von Individuen einer Gesellschaft, aber fast jede Veränderung wirkt sich fast zwangsläufig für irgendeine Person negativ aus.
Nach dem Effizienzkriterium von Kaldor/Hicks ist ein Zustand X gegenüber einem anderen Zustand Y auch dann eine Verbesserung und dadurch effizient, wenn eine oder mehrere Personen in X schlechter gestellt sind. Voraussetzung hierfür ist nur, "dass die Vorteile der Gewinner so groß sind, dass sie die Verlierer kompensieren können - so dass diese indifferent wären gegenüber dem Zustand Y - und dass für die Gewinner ein Restvorteil bleibt."10 Die Gewinner sind jedoch nicht zur Kompensation der Verlierer verpflichtet, entscheidend ist nur, dass diese es mit dem Restvorteil könnten. Auch ist dieses Kriterium gegenüber dem Pareto-Kriterium dadurch erweitert, dass anstatt ordinaler Nutzenmessung die kardinale Nutzenmessung verwendet wird.
Auf Grundlage der kardinalen Nutzenmessung und auf Basis des Effizienzkriterium wird es einer Wirtschafts- oder Rechtspolitik möglich, anhand von z.B. Kosten/Nutzen-Vergleichen zu ermitteln, ob eine geplante Veränderung sinnvoll ist und zu einer Verbesserung der Gesellschaftswohlfahrt führt. Mit dem Pareto-Kriterium wäre dies aufgrund ordinaler Nutzenmessung und mit einer sehr eingeschränkten Definition, wann eine Situation effizient ist, nur schwerlich möglich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Effizienzkriterium - unabhängig davon, welche Definition nun gewählt wird - ein entscheidender Maßstab ist, nach dem soziale Entscheidungs- verfahren zu bewerten und rechtlich zu gestalten sind. Der im folgenden Exkurs erläuterte allokationstheoretische Aspekt der "externen Effekten" erweist sich jedoch bei der Gestaltung als problematisch.
Exkurs: externe Effekte
Unter "externer Effekt" wird ein Umstand bezeichnet, bei dem Entscheidungen eines Wirtschaftssubjektes vielfältige Auswirkungen auf andere Wirtschaftssubjekte haben, ohne dass die Auswirkungen immer dem Handelnden zugeschrieben werden. Solche "externen Effekte" können sowohl bei der Produktion als auch beim Konsum auftreten und können positiv oder negativ sein.11 Die durch "externe Effekte" entstehende Kosten gehen nicht in die Kalkulation des Handlenden ein, sondern werden nicht selten von der Gesellschaft getragen. Daher spricht man auch oft von sozialen Kosten bzw. sozialen Erträgen.
"Externe Effekte" sind somit ein Problem, weil sie das Nutzenniveau eines Individuums beeinflussen und somit zu Pareto-ineffizienten Allokation führen können, weil die betroffene Person durch die Handlung einer anderen schlechter gestellt wird. Weiter verzerren "externe Effekte" auch die Knappheitsrelation und führen zu einer Vergeudung von Ressourcen. Durch die Verlagerung von Kosten auf Dritte, welche nicht in die Kalkulation eingehen, wird ein produziertes Gut relativ gesehen billiger. Die Produktionsmenge ist dadurch größer und Ressourcen werden übermäßig ausgenutzt.12
Um eine Ineffizienz zu vermeiden ist es daher eine sehr bedeutsame Aufgabe des Staates und der Justiz, Verfahren und Regeln aufzustellen, damit "externe Effekte" dem eigentlichen Verursacher zugerechnet oder gleich "internalisiert" werden
2.2.2 Verteilung
Zu den zentralen Erkenntnissen der Wohlfahrtstheorie zählt auch die Einsicht, dass die Bedürfnisse eines Menschen abhängig sind vom Grad ihrer Befriedigung. Allgemein gesagt bedeutet dies, dass die Bedürfnisstruktur einer Gesellschaft von ihrer Vermögensverteilung abhängig ist. Ein Güterbündel wird von unterschiedlichen Menschen unterschiedlich bewertet, was bedeutet, dass sich ein am Effizienzziel orientiertes Optimum des Einsatzes der verfügbaren Ressourcen immer nur im Bezug auf eine bestimmte Güter- oder Einkommensverteilung feststellen lässt.
"Die Frage, ob der wirtschaftliche Wohlstand in einer gegebenen Situation ein Maximum darstellt oder nicht, kann nicht einmal dann mit Sicherheit beantwortet werden, wenn sich beweisen lässt, dass unter den gegebenen Bedingungen das Sozialprodukt nicht maximiert ist. Immer muss damit gerechnet werden, dass ein vergleichsweise niedriges, aber "gerecht" verteiltes Sozialprodukt im Hinblick auf die Zielsetzung Wohlstandsmaximierung günstiger ist als ein höheres Volkseinkommen, dessen Verteilung als "ungerecht" empfunden wird."13
Eine grundlegende Schwierigkeit des Verhältnisses zwischen Effizienz und Verteilungsoptimum liegt darin, dass die moderne Allokationstheorie im Hinblick auf das Pareto-Kriterium von der Unmöglichkeit kardinaler Nutzenmessung und interpersonellen Nutzenvergleichen ausgeht. Das Verteilungsproblem setzt aber zur Verwirklichung gerade diese Nutzenmessungen und Nutzenvergleiche voraus. Würde sich die modere Allokationstheorie auf das bereits beschriebene Effizienzkriterium von Kaldor/Hicks beziehen, würde sich dieses Problem gar nicht ergeben.
Dieses Problem betrifft jedoch weitestgehend nur die Wissenschaftler. Für die Rechtsordnung stellen sich eher die Verteilungskriterien als ein Problem dar.
Die vorherrschende Ressourcenknappheit verhindert, dass alle Individuen mit der gleichen Menge aller Güter ausgestattet werden können. Da das nicht möglich ist, stellt das Verteilungsproblem einen nicht vermeidbaren und fortwährenden Konflikt dar. Anhand von unterschiedlichsten Kriterien wird versucht, die gerechtest Verteilung der Güter zu erreichen, die jedoch in einem Spannungsverhältnis stehen.
Nach dem Leistungsprinzip werden die Güter entsprechend der Leistung des Individuums für die Gesellschaft verteilt, während das Bedürfnisprinzip versucht, die Güter so zu verteilen, dass jedes Gesellschaftsmitglied sein Nutzen so weit wie möglich maximieren kann. Auch das Existenzminimum, die Chancengleichheit eines jeden Gesellschaftsmitglied und die Bereitstellung von öffentlichen Gütern werden als Verteilungskriterien genannt.
Die Rechtsordnung hat nun die Aufgabe, Gesetze und Regeln zu erlassen, damit diese Vielzahl von unterschiedlichsten Verteilungskriterien mit verschiedensten Maßstäben sinnvoll miteinander kombiniert werden, um ein Verteilungsoptimum zu erreichen.
2.2.3 Gerechtigkeit
Gerechtigkeit wird als ein weiteres regulatives Ziel der Rechtsordnung verstanden und kann nach der schon von Aristoteles vorgeschlagenen Einteilung in "ausgleichende Gerechtigkeit" und "austeilende Gerechtigkeit" unterschieden werden.
Die "ausgleichende Gerechtigkeit" fordert die absolute Gleichheit von Leistung und Gegenleistung, beispielsweise von Ware und Preis oder von Schaden und Ersatz. Diese Interpretation impliziert, dass "das für die Allokationseffizienz maßgebliche Pareto-Kriterium und die aus ihm resultierende Forderung nach Internalisierung externer Effekte"14 als eine Art der "ausgleichenden Gerechtigkeit" zu verstehen ist. Eine Rechtsordnung könnte auch nur schwerlich als gerecht bezeichnet werden, wenn sie nicht dafür sorgt, dass jedem die Folgen seiner Handlung zugerechnet werden und dass alle Personen in angemessener Weise an Entscheidungen beteiligt werden, durch die sie und Ihre Bedürfnisse beeinflusst werden. "Die im Effizienzziel enthaltene Verbindung des Gedankens der Wohlstandsmaximierung mit der Forderung nach einem gesellschaftlichen Entscheidungsverfahren, in welchem sich die individuellen Präferenzen durchsetzen können, stellt also die ökonomische Interpretation des Gedankens der "ausgleichenden Gerechtigkeit" dar."15
In dem Gedanken, dass sich Leistung und Gegenleistung entsprechen, da eine Rechtsordnung sonst ungerecht wäre, decken sich "ausgleichende" und "austeilende" Gerechtigkeit. Jedoch ist eine Rechtsordnung auch ungerecht, wenn sie nicht auch das Bedarfsprinzip berücksichtigt und für eine leistungsunabhängige gleichmäßige Verteilung von Grundrechten sorgt. Diese versucht die "austeilende Gerechtigkeit" zu berücksichtigen.
3. Gibt es einen juristischen Effizienzbegriff ?
Wie bereits erläutert, ist in der Wohlfahrtsökonomik "die Effizienz" das Ziel, welches erreicht werden soll und an dem alle anderen Ziele gemessen werden. Wenn z.B. ein politisches Ziel erreicht werden soll, wobei es zur Benachteiligung einiger Individuen kommt, sollte dieses Ziel auf Grundlage des Pareto-Kriteriums nicht angestrebt werden. Anders ist dieses in der Justiz. Wenn Juristen von "Effizienz" sprechen, dann wird damit in der Regel gemeint, dass irgendein vorgegebenes Ziel mit einem möglichst geringen Aufwand oder dass mit einem gegebenen Aufwand ein bestimmtes Ziel möglichst in hohen Maße erfüllt wird (Mini-Max-Prinzip).16 Hierbei ist also nicht die Effizienz das Ziel, sondern ein beliebiges Ziel, das nach Überprüfung der Zweck/Mittel-Relation optimiert werden soll.17
4. Folgerungen für die Justiz
Wie gezeigt wurde, ist ein zentraler Gegenstand der Wirtschaftswissenschaft die Frage, wie eine Gesellschaft knappe Güter, welche ihr zur Verfügung stehen, so einsetzt, dass ein möglichst hoher Grad an Bedürfnisbefriedigung erreicht wird. In dem Maße, wie der Gesellschaft das gelingt, ist sie effizient.18 Aus Sicht der ökonomischen Analyse des Rechts "ist es daher eine legitime und notwendige Aufgabe der Rechtswissenschaft, rechtliche Regeln danach zu beurteilen, in welchem Maße sie die Verschwendung von Ressourcen verhindern und damit die Effizienz erhöhen."19
Es hat sich aber weiterhin gezeigt, dass Rechtsnormen nicht nur am Effizienzziel orientiert sein können, sondern dass selbstverständlicherweise auch die Aspekte Verteilung und Gerechtigkeit für die Justiz eine Rolle spielen müssen. Durch die Institutionalisierung von Grundrechten, Chancen- gleichheit und Leistungsprinzip sowie die Gewährung eines Existenzminimums wird versucht, den Gleichheitsgedanken im Bezug auf Verteilung und Gerechtigkeit - im wesentlichen formal --zu verwirklichen.
Da sich die Justiz lediglich auf formale Regelungen beschränkt, können materielle Ungleichheiten weiterhin entstehen. "Die ökonomische Rechtfertigung solcher Ungleichheiten besteht in der Annahme, dass sie letztlich der Wohlstandsmehrung zugunsten aller dienen: Indem den Individuen lediglich Handlungs möglichkeiten (in Gestalt von Grundrechten) und gewisse Nutzungs chancen (in Gestalt öffentlicher Güter) eröffnet werden, wird letztlich jedem selbst überlassen, seinen individuellen Lebensplan zu verfolgen. Nur soweit materielle Ungleichheiten niemanden nützen, nimmt das Recht selbst die unmittelbare Zuweisung von Ressourcen (in Gestalt der Gewährleistung eines Existenzminimums) vor.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass Allokationseffizienz, Verteilungsoptimum und Gerechtigkeit als diejenigen Steuerungsziele genannt können, auf die alle sozialen und somit auch rechtlichen Institutionen ausgelegt sein sollen.
5. Anforderungen an das Recht
Wie gezeigt wurde, handeln Individuen rational und verfolgen eigennützig ihre eigenen Ziele. Doch welche Wirkung haben Regeln der Justiz in Form von Rechtsnormen auf das Verhalten eines "homo oeconomicus"?
In seinem Aufsatz "Crime and Punishment"20 beschäftigt sich Gary S. Becker mit der modelltheoretischen Analyse präventiver Wirkung strafrechtlicher Normen.
Für einen "homo oeconomicus" ist die Existenz von Rechtsnormen - seien es nun zivil-, straf- oder öffentlich-rechtliche Rechtsnormen - untrennbar mit einer Sanktion verknüpft. Sobald eine Vorschrift sanktionslos ist, verhält sich der "homo oeconomicus" als sei die bestreffende Vorschrift nicht existent, da ein Verstöß gegen sie nichts kostet und die nutzenmaximierende Handlungsalternative nicht beeinflusst wird.
Sobald eine Vorschrift aber mit einer Sanktion belegt ist, wirkt dieses wie eine Handlungsrestriktion, durch die die ursprünglich gewählte Handlungsalternative verteuert wird mit dem Preis, den er für die Übertretung der Vorschrift zu zahlen hat.21 "Je schärfer die Sanktion für eine Normübertretung, desto einschneidender die Handlungsrestriktion".22
Anhand des Beispiels eines Ladendiebstahls soll dieses verdeutlicht werden.23 Der Ladendieb hat bei einem Ladendiebstahl den Nutzen der gestohlenen Ware (B(x)), gleichzeitig aber auch die Kosten, die durch die Möglichkeit der Verhaftung entstehen (C(x)). Da der Ladendieb seinen Nutzen maximieren will, steht er vor dem folgenden Entscheidungsproblem
max B(x) - C(x)
Weiter ist für den Ladendieb noch entscheidend, mit welcher Wahrscheinlichkeit (p) er die Kosten für den Überfall zahlen muss, d.h. wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, erwischt zu werden.
max B(x) - p*C(x)
Der Ladendieb muss also abwägen, welche Kosten er eingehen würde, um den Nutzen aus dem Diebstahl zu haben und wie er das Risiko der Entdeckung einschätzt. Allgemein kann man aber sagen, dass um so die geringer die Strafe (die auferlegte Sanktion) - separat betrachtet - ausfällt, um so eher wird der Dieb den Diebstahl begehen und um so höher die Strafe, um so eher wird er es unterlassen und auf den Nutzen verzichten. Selbstverständlich spielt hier jetzt auch noch die Aufdeckungswahrscheinlichkeit eine Rolle, denn wer würde eine Straftat begehen, aus der ein hoher Nutzen gezogen werden kann, weil die Kosten gering sind, aber die Wahrscheinlichkeit, diese zahlen zu müssen, sehr hoch ist. Demzufolge ist auch die Aufdeckungswahrscheinlichkeit eine Sanktion, die den Ladendieb bei seiner Entscheidungsfindung beeinflusst.
Es darf an dieser Stelle aber nicht vernachlässigt werden, dass dem Geschädigten und dem Staat durch den Ladendiebstahl Kosten entstehen. Für den Geschädigten sind das der Wert des gestohlenen Gutes und Kosten für Schutzvorkehrungen (Schlössern, Wachpersonal...). Die Position des Geschädigten soll an dieser Stelle vernachlässigt werden, da sie für die weitere Interpretation belanglos ist.
Für den Staat entstehen Kosten für die Verbrechensbekämpfung sowie deren Aufdeckung. Der Staat wird selbstverständlich bemüht sein, seine Kosten zu minimieren oder wenigstens die Kosten durch die auferlegten Strafen zu decken und wird daher für Verbrechen mit einer geringen Aufdeckungswahrscheinlichkeit hohe Strafen festlegen.
An dieser Stelle ist es Aufgabe der Justiz ein Gleichgewicht zwischen Verbrechen und Strafe zu erreichen, um hier Unverhältnismäßigkeiten zu vermeiden. Das folgende Beispiel soll eine dieser Unverhältnismäßigkeiten und Auswirkungen auf die Bevölkerung veranschaulichen.
6. Praxisbeispiel: schönes sauberes Singapur
"Der Stadtstaat Singapur wirbt damit, nach Japan den höchsten Lebensstandard in Asien zu haben. Mit Steigerungsraten von knapp 10 % gehörte die Stadt in den letzten Jahren zu den wachstums- stärksten Ländern der Welt. Das soziale Netz gilt allgemein als vorbildlich, die Kriminalitätsrate ist niedrig."24 Doch hinter der Fassade eines asiatischen Musterlandes verbirgt sich nach Ansicht von Oppositionskritikern ein antidemokratischer, autoritärer Staat, indem die menschliche Freiheit noch ein unerreichtes Gut ist. Die seit mehr als 30 Jahren alleinregierende Partei "People's Action Party" hat ihre eigene Vorstellung von wirtschaftlichem Erfolg, Sozialsystem, Disziplin und Umwelt- bewusstsein. Disziplin ist ein Schulfach, im Umweltministerium gibt es eine Abteilung "Erziehung" und eine Filmzensurbehörde überprüft sämtliche in- und ausländische Medien auf deren Inhalt. Doch der Erfolg scheint ihnen recht zu geben. Alles läuft, alles funktioniert, vom Nahverkehrssystem bis zur Flughafenabfertigung, vom Telefonanschluß bis zur Kinderbetreuung. Doch das alles lässt sich nicht ohne Erziehung, Disziplin und strenge Strafen erreichen.
Jedes Jahr im November veranstaltet das Umweltministerium eine "Grüne Woche". Es wird sich dann um den schönsten Garten und saubersten Wohnblock gestritten. Plakate mahnen zu mehr Umweltbewusstsein. "Lass' den Wasserhahn nicht tropfen!" "Schalte das Licht aus, wenn du aus dem Zimmer gehst!". Flugblätter raten "Benutze Nachfüllpackungen! und "Beschreibe Papier von beiden Seiten".25 Das hört sich alle sehr fortschrittlich und positiv an, doch ist erfahrungsgemäß bekannt, dass Erziehung allein nicht wirkt. "Umweltsündern" drohen daher in Singapur hohe Strafen.
Der Staat bzw. die Regierung in Singapur hatte es sich als Ziel gesetzt, dass Singapur im Jahr 2000 eine Stadt mit gesunden Menschen und intakter Umwelt ist.26 Zum einen, weil dieses als ein erstrebsames Ziel gilt und zweitens, weil dem Staat die Kosten bekannt sind, die durch kranke Menschen und durch Säuberungsmaßnahmen entstehen.
An dieser Stelle sollen die Kosten für Säuberungsmaßnahmen am Beispiele von Kaugummis mit dem in Kapitel 5 angesprochenem Beispiel der Kosten der Verbrechensbekämpfung verglichen werden. Auch hier wird die Regierung Kostenminimierung und auch Kostendeckung anstreben.
Die Regierung stellte fest, dass das Säubern von durch ausgespuckten Kaugummis verunreinigten Gehsteigen und Bahnsteigen enorme Kosten verursacht. Anfängliche Erziehungsmaßnahmen wurden unternommen, um die "Spucker" vom "Nichtspucken" zu überzeugen. Doch diese Versuche schlugen fehl und es wurde weiter gespuckt und die Bürgersteige verunreinigt. Der Staat musste weiterhin säubern und hatte zusätzlich zu den Reinigungskosten auch noch die Kosten der "Nicht-Spucken"- Kampagne. Die Konsequenzen die daraus gezogen worden, waren radikal. Um die Bürgersteige sauber zu halten, wurde nicht nur das Ausspucken von Kaugummis verboten, sondern das Kauen von Kaugummis und die Einfuhr von Kaugummis wurde verboten und mit sehr hohen Strafen belegt. So beträgt die Strafe für die Einfuhr von Kaugummis DM 10.000,-- und das Ausspucken kostet mehrere Hundert Mark Strafe27.
Für diese hohe Strafen gibt es die gleichen Gründe wie sie bereits am Beispiel des Ladendiebstahls gezeigt wurden.
1) Abschreckung der Spucker
2) Kostendeckung der entstehenden Säuberungskosten
3) hohe Strafen um die geringe Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung zu kompensieren
Genau an dieser Stelle wird die bereits in Kapitel 5 angesprochene Unverhältnismäßigkeit zwischen "Verbrechen" und Strafe deutlich. Es ist sicherlich sinnvoll, das Ausspucken von Kaugummis zu verbieten, um die Reinigungskosten des Staates zu minimieren. Wie hoch jedoch die Strafe dann sein sollte, darüber müsste lange diskutiert werden. Aber sogar das Kauen und die Einfuhr von Kaugummis als Verbrechen zu bezeichnen und bei hohen Strafen zu verbieten, schränkt die Rechte der Bevölkerung ein, die gerne Kaugummi kauen, aber ihr Kaugummi vorschriftsmäßig entsorgen. Es handelt sich also um einen negativen externen Effekt im Konsum. Ein Personenkreis spuckt ihre gekauten Kaugummis "wild in die Gegend", so dass es zum erwähnten Kaugummiverbot kommt. Durch dieses Verbot werden andere Personen betroffen, die Kaugummis nicht "wild" ausspucken, aber von nun an keine Kaugummis mehr kauen dürfen. Doch zu diesen Einschränkungen von Rechten und Freiheiten bekennt sich die Regierung jedoch offen. Regeln der Justiz um hier die in Kapitel 2 und 4 beschriebenen Aspekte zu erfüllen und Unverhältnismäßigkeiten zwischen "Verbrechen" und Strafe zu verhindern existieren nicht, da sich keiner traut, gegen die alleinherrschende "People's Action Party" vorzugehen und somit für mehr Gerechtigkeit, Freiheit der Menschen und Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen.
7. Schlussbetrachtung
Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse der "ökonomischen Analyse des Rechts" lassen sich wie folgt thesenartig zusammenfassen:
- Menschen reagieren auf Rechtsnormen und - vorschriften wie "homo oeconomicus", also rational und nutzenmaximierend
- Die sich durch die Rechtsnormen ergebenen Folgen werden bewertet nach den Kriterien der ökonomischen Wohlfahrtstheorie: Effizienz, Verteilung, Gerechtigkeit
- es ist die Aufgabe aller Institutionen des Rechtssystems, Entscheidungen zu treffen, die den gesellschaftlichen Wohlstand erhöhen oder ihn zumindest nicht verringern und sich ergebene Unverhältnismäßigkeiten zwischen Verbrechen und Strafe zu verhindern
Die fast einstimmige Meinung der dieser Arbeit zugrundeliegende Literatur ist, dass es mit Hilfe der ökonomischen Analyse des Rechts möglich ist, Ökonomie, Recht und menschliche Handlungen miteinander in Bezug zu setzen und die sich aus diesen Beziehungen ergebenen Konflikte zu bewältigen. Nach Meinung der Verfasserin der Hausarbeit ist dieser Ansatz nur sehr theoretisch durchdacht. In der Realität ist die Bewältigung dieser Konflikten nicht einfach darstellbar, weil unterschiedlichste Interessen existieren und die zu erreichen Ziele verschiedenster Gruppen oder Personen einer Gesellschaft miteinandern konkurrieren. Auch ist das Erstellen von Standards z.B. für Vorgehensweisen der Gerichte und zu fällende Urteile nicht in der Praxis einsetzbar, weil fast jeder Sachverhalt einen gewissen Anteil an Individualität enthält, welcher bei standardisierten Verfahren meist unberücksichtigt bleiben würde. So konnte mit dem Praxisbeispiel: "Schönes, sauberes Singapur" gezeigt werden, dass das Verbot von Kaugummi kauen bei hohen Strafen nach der ökonomischen Analyse des Rechts unverhältnismäßig ist und einen negativen externen Effekt darstellt, der eigentlich vermieden werden sollte. Das Beispiel Singapur hat eindeutig gezeigt, dass nicht nur die Regierung solche Einschränkungen von Rechten und Freiheiten in Kauf nimmt, sondern auch die Einwohner Singapurs. Wie bereits in der Einführung gesagt, sind die Definitionen von Effizienz und Gerechtigkeit von den Empfindungen der einzelnen Individuenabhängig. Da aber eine gesamte Bevölkerung keine aktiven Unternehmungen gegen solche Maßnahmen anstrengt, muss davon ausgegangen werden, dass andere Definitionen von Effizienz und Gerechtigkeit vorliegen. Wer kann also sagen, was effizient und gerecht ist, als das die Möglichkeit besteht, allgemeingültige Schlüsse daraus zuziehen ???
Literaturverzeichnis
Becker, Gary S.
Crime and Punishment (1969): An Economic Approach, in: 76 Journal of political Economy, S. 169-217
Behrens, Peter
Die ökonomischen Grundlagen des Rechts, Tübingen 1996
Eidenmüller, Horst
Effizienz als Rechtsprinzip, Tübingen 1998
Grundgesetz,
32. Aufl., 1994
Michalski, Wolfgang
Grundlegung eines operationalen Konzeptes der Social Costs, 1965
Schäfer, Hans-Bernd / Ott, Claus
Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin/Heidelberg/New York, 1986, S. 1
Schmitz, Udo / Weidtmann, Bernd
Volkswirtschaftslehre Handbuch, Stuttgart 1994
Varian, Hal R.
Grundzüge der Mikroökonomik, 3. Aufl., München/Wien, 1995
Internetseiten:
Die Welt Online Archiv
In Singapur ist Freiheit ein noch unerreichtes Gut URL: (http://www.welt.de/daten/1998/04/22/0422au72009.htx?print=1) Abfrage: 04.05 2000
Die Welt Online Archiv
Schönes sauberes Singapur Erziehung und strenge Strafen sollen das Umweltbewusstsein fördern URL: (http://www.welt.de/daten/1995/11/28/1128s1115582.htx?print=1) Abfrage: 04.05.2000
[...]
1 vgl. Hans-Bernd Schäfer / Claus Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin / Heidelberg / New York, 1986, S. 4
2 Horst Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip, Tübingen, 1998, S. 21
3 vgl. ebenda, S. 31
4 vgl. ebenda, S. 29
5 vgl. Udo Schmitz / Bernd Weidtmann, Volkswirtschaftslehre Handbuch, Stuttgart 1994, S. 21
6 vgl. Peter Behrens, Die ökonomischen Grundlagen des Rechts, Tübingen 1996, S. 81
7 vgl. ebenda, S. 84
8 Hal R. Varian, Grundzüge der Mikroökonomik, München/Wien, 1995, S. 18
9 vgl. Peter Behrens, a.a.O., S. 85
10 Peter Behrens, a.a.O., S. 51
11 vgl. Hal R. Varian, a.a.O., S. 531
12 vgl. Peter Behrens, a.a.O., S. 86
13 Wolfgang Michalski, Grundlegung eines operationalen Konzeptes der Social Costs, 1965, S. 15
14 Peter Behrens, a.a.O., S. 101
15 Peter Behrens, a.a.O., S. 102
16 vgl. Udo Schmitz / Bernd Weidtmann, a.a.O.; S. 21
17 vgl. Horst Eidenmüller, a.a.O., S. 55 ff.
18 vgl. Hans-Bernd Schäfer / Claus Ott, Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, Berlin/Heidberg/Tokyo, 1986, S. 1
19 Hans-Bernd Schäfer / Claus Ott, a.a.O., S. 1
20 vgl. Gary S. Becker, Crime and Punishment(1969): An Economic Approach, in: 76 Journal of political Economy S. 169-217
21 vgl. Horst Eidenmüller, a.a.O. , S. 35
22 Horst Eidenmüller, a.a.O. S. 35
23 Beispiel entnommen aus Hal R. Varian, a.a.O., S. 553 ff.
24 Die Welt Online Archiv, In Singapur ist Freiheit ein noch unerreichtes Gut, URL: (http://www.welt.de/daten/1998/04/22/0422au72009.htx?print=1), Abfrage: 04.05 2000
25 vgl. Die Welt Online Archiv, Schönes sauberes Singapur Erziehung und strenge Strafen sollen das Umweltbewusstsein fördern, URL: (http://www.welt.de/daten/1995/11/28/1128s1115582.htx?print=1), Abfrage: 04.05.2000
26 vgl. Die Welt Online Archiv, Schönes sauberes Singapur Erziehung und strenge Strafen sollen das Umweltbewusstsein fördern, a.a.O.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Analyse des Rechts aus ökonomischer Sicht. Es untersucht, wie sich rechtliche Regeln und Normen auf das Verhalten von Individuen und die gesellschaftliche Effizienz auswirken.
Was sind die zentralen Themen, die in dieser Analyse behandelt werden?
Die zentralen Themen umfassen die Grundlagen der ökonomischen Analyse des Rechts, das ökonomische Verhaltensmodell des "homo oeconomicus", das Konzept der Effizienz (einschließlich Pareto-Effizienz und Kaldor-Hicks-Effizienz), Verteilung, Gerechtigkeit, externe Effekte und die Anforderungen an das Rechtssystem.
Was versteht man unter dem "homo oeconomicus" im Kontext dieser Analyse?
Der "homo oeconomicus" ist ein Modell des rationalen und eigennützigen Verhaltens, das in der ökonomischen Analyse des Rechts verwendet wird. Es wird davon ausgegangen, dass Individuen ihre Entscheidungen so treffen, dass sie ihren Nutzen maximieren.
Was bedeutet "Effizienz" in diesem Kontext und welche verschiedenen Arten von Effizienz werden diskutiert?
Effizienz bezieht sich auf die optimale Allokation von Ressourcen, um die gesellschaftliche Wohlfahrt zu maximieren. Das Dokument diskutiert insbesondere die Pareto-Effizienz (keine Möglichkeit, jemanden besser zu stellen, ohne jemand anderen schlechter zu stellen) und die Kaldor-Hicks-Effizienz (die Vorteile der Gewinner sind groß genug, um die Verlierer zu kompensieren).
Was sind "externe Effekte" und warum sind sie ein Problem?
Externe Effekte sind Auswirkungen der Entscheidungen eines Wirtschaftssubjekts auf andere, ohne dass diese Auswirkungen dem Handelnden zugerechnet werden. Sie sind ein Problem, weil sie zu einer ineffizienten Allokation von Ressourcen führen und das Nutzenniveau anderer Individuen negativ beeinflussen können.
Welche Rolle spielen Verteilung und Gerechtigkeit in der ökonomischen Analyse des Rechts?
Verteilung und Gerechtigkeit sind wichtige Kriterien, die bei der Gestaltung der Rechtsordnung berücksichtigt werden müssen. Eine effiziente Allokation von Ressourcen muss auch mit einer gerechten Verteilung und dem Gerechtigkeitsempfinden der Gesellschaft in Einklang stehen.
Welche Folgerungen ergeben sich aus der ökonomischen Analyse des Rechts für die Justiz?
Die Justiz sollte bei der Gestaltung von Rechtsnormen darauf achten, dass diese die Verschwendung von Ressourcen verhindern und die Effizienz erhöhen. Gleichzeitig müssen auch die Aspekte Verteilung und Gerechtigkeit berücksichtigt werden.
Welche Anforderungen werden an das Rechtssystem gestellt?
Das Rechtssystem sollte Anreize schaffen, die Individuen dazu bewegen, sich im Sinne der gesellschaftlichen Wohlfahrt zu verhalten. Dies kann durch Sanktionen für Normübertretungen und durch die Internalisierung externer Effekte erreicht werden.
Was ist das Praxisbeispiel "Schönes sauberes Singapur" und was wird daran veranschaulicht?
Das Praxisbeispiel "Schönes sauberes Singapur" veranschaulicht, wie strenge Gesetze und hohe Strafen zur Durchsetzung von Umweltstandards eingesetzt werden können. Es wird jedoch auch kritisiert, dass diese Maßnahmen unverhältnismäßig sein und die Rechte der Bevölkerung einschränken können.
Was sind die Schlussfolgerungen der Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die ökonomische Analyse des Rechts ein nützliches Instrument zur Analyse und Gestaltung von Rechtsnormen ist. Es wird jedoch auch betont, dass die Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis aufgrund der Komplexität der gesellschaftlichen Realität und der unterschiedlichen Interessen der Akteure schwierig sein kann.
- Quote paper
- Iris Kruschinski (Author), 2000, Ökonomische Analyse des Rechts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96688