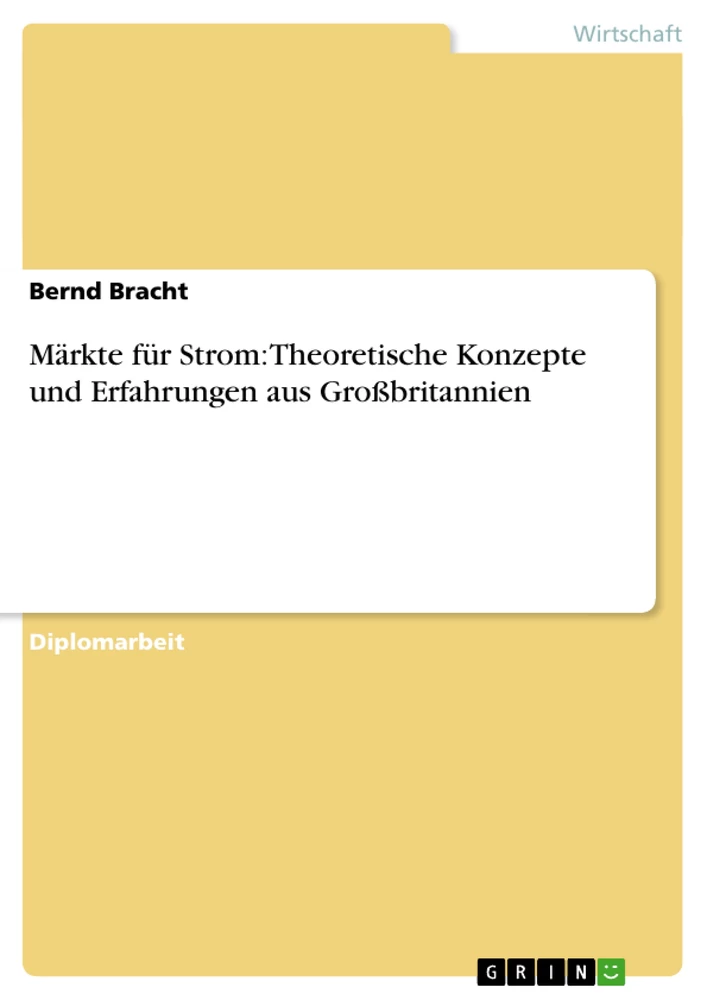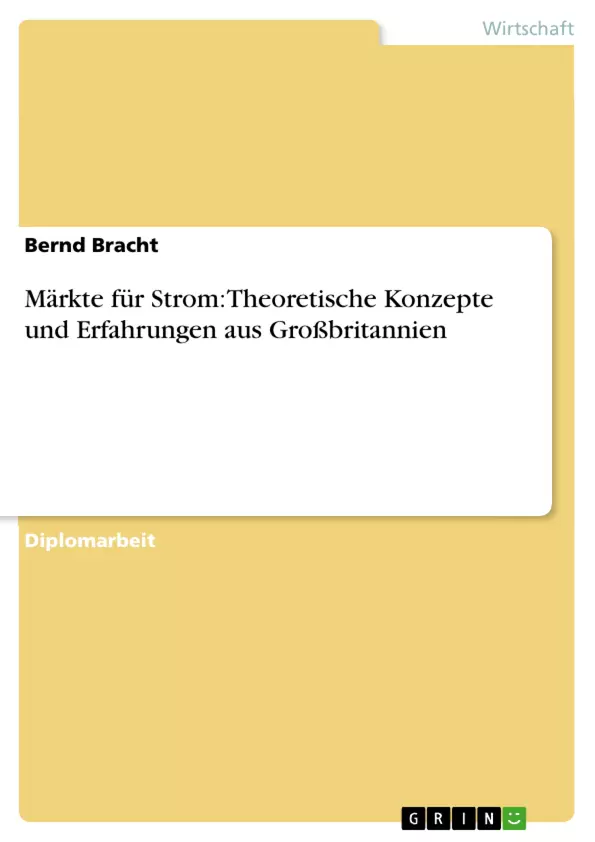In dieser Arbeit werden wirtschaftspolitische Empfehlungen für den Bereich der Elektrizitätswirtschaft getroffen. In einem ersten Schritt wird die Elektrizitätswirtschaft vor dem Hintergrund der heutigen Erkenntnisse in die normative Theorie der Regulierung eingeordnet. Zuerst werden traditionell von interessierter Seite vorgeschützte „Besonderheiten“ dieses Industriesektors diskutiert, die mit Hilfe des normativ-theoretischen Instrumentariums überprüft werden. Diese Schritte dienen dem ersten Hauptziel dieser Arbeit. Erklärtes Ziel dieser Arbeit ist es zum einen die Deregulierungspotentiale, die durch die neueren theoretischen Erkenntnisse und technologischen Weiterentwicklungen entstanden sind, vor klarem theoretischen Hintergrund offen zu legen. Zum anderen wird der Frage nachgegangen, inwieweit das englisch-walisische Deregulierungsmodell als „Leitbild“ für Reformen in anderen Ländern, wenn nicht sogar für die gesamte EU, dienen kann. Dabei wird überprüft, inwieweit die Umstrukturierung der englisch-walisischen Elektrizitätswirtschaft den angesprochenen Zielen der Effizienzsteigerung durch Marktöffnung und Wettbewerb gerecht wird. Diese Frage kann getrennt nach Erzeugermarkt und Versorgermarkt diskutiert werden. Die Analyse beschränkt sich in dieser Arbeit dabei allein auf den Erzeugermarkt, wobei das Hauptaugenmerk auf das innovativste Element des neuen Erzeugermarktes, den Strompool, gelegt wird. Dieser steht im Zentrum der Kritik der Wettbewerbsgegner. Gelingt es, diesem „Pool-Modell“ positive Effizienzeigenschaften zu bescheinigen, dürfte sich dessen Funktion als „Leitbild“ für eine Regulierungsreform in anderen Ländern stabilisieren. Einem „Strompool“ als wettbewerbliches Kernstück eines europäischen Energiebinnenmarktes steht dann nichts mehr im Wege.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Methodik
- Gang der Untersuchung
- Rechtfertigung und Zielsetzung staatlicher Regulierungstätigkeit
- Normative Theorie der Regulierung
- Das Konzept der Pareto-Effizienz zur Beurteilung von Allokationen
- Zum Begriff des natürlichen Monopols
- ,,Traditionelle" Sichtweise: fallende Durchschnittskosten
- ,,Neuere" Sichtweise: subadditive Kostenstruktur
- Theorie bestreitbarer Märkte
- Demsetz-Wettbewerb (Franchise Bidding)
- Intermodaler Wettbewerb (Monopolistische Konkurrenz)
- Schlußfolgerungen für den Regulierungsbedarf
- Synthese
- Einordnung der Elektrizitätswirtschaft in die Regulierungstheorie
- Besonderheiten der Elektrizitätswirtschaft
- Argumente für die Rechtfertigung der Ausnahmestellung
- Kritik der „Besonderheitenlehre“
- Anwendbarkeit der normativen Regulierungstheorie
- Economies of scale
- Economies of scope
- Deregulierung der Elektrizitätswirtschaft
- Synthese
- Privatisierung und Deregulierung der Stromversorgung in England/Wales
- Historische Entwicklung
- Struktur und Regulierung vor der Privatisierung
- Der Energy Act 1983 und seine Wirkungen
- Privatisierung der Elektrizitätswirtschaft in England/Wales
- Struktur, Regulierung und Funktionsweise des neuen Systems
- Struktur nach der Privatisierung im Überblick
- Institutionelle Rahmenbedingungen (Electricity Act 1989)
- Grundcharakterisierung des Spotmarktes
- Funktionsweise des Strompools
- Parallelkontraktmarkt für Sicherungsgeschäfte
- Synthese
- Effekte des geplanten Wettbewerbs - der Erzeugermarkt
- Marktstruktur, Marktanteile und Entwicklung der Poolpreise
- Das Modell von Harbord/von der Fehr
- Modellannahmen
- Modellanalyse
- Low-demand periods
- High-demand periods
- Variable-demand periods
- Eine alternative Preisbildungsregel
- Kritische Würdigung der Modellergebnisse
- Zusammenfassung und Perspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Regulierung von Strommärkten, insbesondere mit den theoretischen Konzepten und den Erfahrungen aus Großbritannien. Ziel ist es, die ökonomischen Grundlagen der staatlichen Regulierungstätigkeit im Bereich der Elektrizitätsversorgung zu analysieren und die Auswirkungen der Deregulierung und Privatisierung auf die Funktionsweise des Strommarktes zu untersuchen.
- Normative Theorie der Regulierung
- Anwendbarkeit der Regulierungstheorie auf die Elektrizitätswirtschaft
- Privatisierung und Deregulierung der Stromversorgung in England/Wales
- Modellierung der Auswirkungen des Wettbewerbs auf den Erzeugermarkt
- Zusammenfassung und Perspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit definiert. Kapitel 2 untersucht die theoretischen Grundlagen der staatlichen Regulierungstätigkeit. Es werden verschiedene Konzepte wie Pareto-Effizienz, natürliche Monopole, bestreitbare Märkte und der Demsetz-Wettbewerb diskutiert.
Kapitel 3 ordnet die Elektrizitätswirtschaft in die Regulierungstheorie ein. Es werden die Besonderheiten der Elektrizitätswirtschaft erläutert und die Anwendbarkeit der normativen Regulierungstheorie auf diesen Sektor diskutiert.
Kapitel 4 befasst sich mit der Privatisierung und Deregulierung der Stromversorgung in England/Wales. Es wird die historische Entwicklung des Strommarktes in Großbritannien betrachtet, die Struktur des neuen Systems nach der Privatisierung beschrieben und die Funktionsweise des Spotmarktes erklärt.
Kapitel 5 analysiert die Auswirkungen des Wettbewerbs auf den Erzeugermarkt in England/Wales. Es wird ein Modell von Harbord/von der Fehr vorgestellt, das die Entwicklung der Poolpreise unter verschiedenen Marktbedingungen untersucht.
Schlüsselwörter
Elektrizitätswirtschaft, Regulierung, Deregulierung, Privatisierung, natürliches Monopol, bestreitbarer Markt, Demsetz-Wettbewerb, Spotmarkt, Poolpreise, Modellanalyse, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein natürliches Monopol in der Elektrizitätswirtschaft?
Ein natürliches Monopol liegt vor, wenn ein einzelnes Unternehmen den Markt aufgrund subadditiver Kostenstrukturen (z. B. hohe Fixkosten für Stromnetze) kostengünstiger versorgen kann als mehrere Wettbewerber.
Wie funktioniert das „Strompool-Modell“ aus England und Wales?
Der Strompool ist ein zentraler Spotmarkt, auf dem Erzeuger ihre Energie anbieten. Er dient als wettbewerbliches Kernstück der Marktöffnung und als Vorbild für europäische Regulierungsreformen.
Was bedeutet Deregulierung im Strommarkt?
Deregulierung zielt darauf ab, staatliche Eingriffe abzubauen und Wettbewerb in Bereichen einzuführen, die früher als Monopole galten, insbesondere im Erzeuger- und Versorgermarkt.
Welche Ziele verfolgt die normative Theorie der Regulierung?
Sie nutzt Konzepte wie die Pareto-Effizienz, um zu beurteilen, wann staatliche Eingriffe ökonomisch gerechtfertigt sind, um Marktversagen zu korrigieren und die Wohlfahrt zu steigern.
Was ist der Demsetz-Wettbewerb?
Der Demsetz-Wettbewerb (Franchise Bidding) ist ein Konzept, bei dem der Wettbewerb „um den Markt“ stattfindet, indem Lizenzen für die Versorgung in einem Bieterverfahren vergeben werden.
- Quote paper
- Dr. Bernd Bracht (Author), 1998, Märkte für Strom: Theoretische Konzepte und Erfahrungen aus Großbritannien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9673