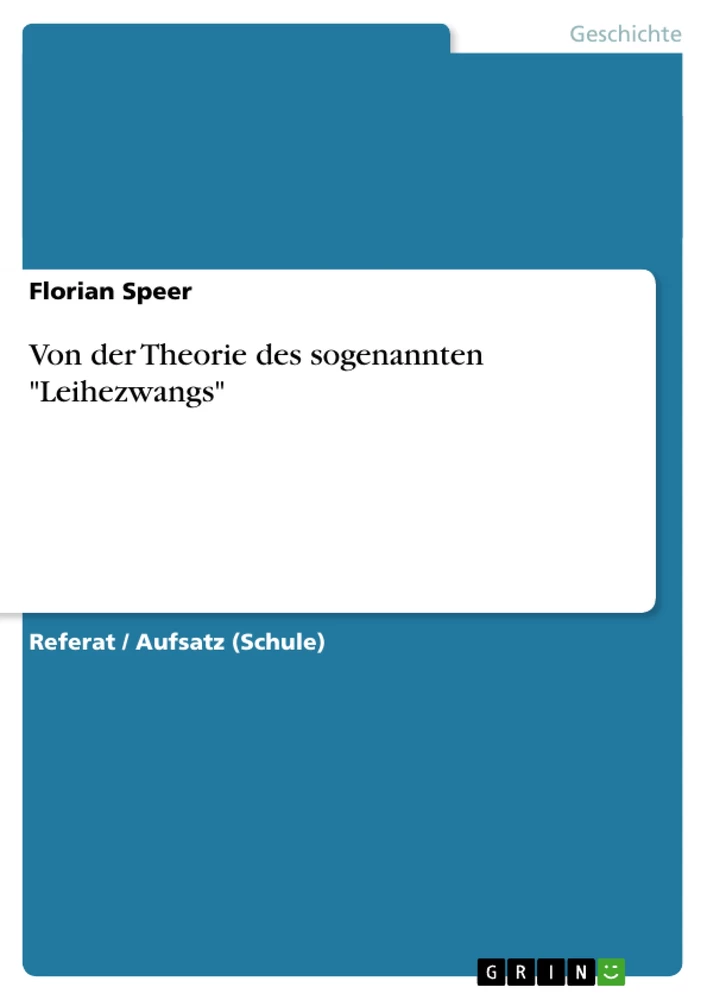Gliederung
1. Einführung ins Thema: Überlieferung - Begriffsbestimmung - Fragestellung
2. Wird im Sachsenspiegel ein bestehendes Gesetz zum Leihezwang ausgedrückt?
3. Fand der im Sachsenspiegel genannte Rechtssatz des Leihezwangs praktische Anwendung?
3.1 Fahn- oder Fürstenlehen als Instrument der Politik am Beispiel der Gelnhauser Urkunde von 1180
3.1.1 Die Gelnhauser Urkunde in der Sicht der älteren Forschung
3.1.2 Exkurs zur Vorgeschichte der Gelnhauser Urkunde
3.1.3 Der Leihezwang und die Gelnhauser Urkunde von 1180
3.2 Vorteilsvergabe durch nicht angewandten Leihezwang - ein Hinweis auf die fehlende Verankerung des Leihezwangs im Rechtsbewußtsein
3.3 Weitere Umstände, die auf ein Fehlen des Leihezwangs im Rechtsbewußtsein deuten
4. Zusammenfassung
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1 Quellen
5.2 Literatur
1. Einführung ins Thema: Überlieferung - Begriffsbestimmung - Fragestellung
Im 19. Jahrhundert begann die Geschichtswissenschaft Überlegungen anzustellen, wieso sich die Länder Frankreich und Deutschland, trotz gemeinschaftlicher Wurzeln im Karolingerreich nahezu entgegengesetzt entwickelten. Während in Deutschland eine stete Entwicklung zum Territorialstaates und damit verbunden eine Schwächung der Zentralmacht zu verzeichnen war, hatte sich Frankreich zentralistisch ausgeprägt.
Bei Erforschung der Ursachen stieß man auf einen Rechtssatz, der in einem der ältesten deutschen Rechtsbücher, dem Sachsenspiegel, dreimal an unterschiedlichen Stellen Erwähnung findet: zweimal im Landrechtteil, einmal im Lehnsrechtteil des Werkes.
Dieser Rechtssatz lautet im Landrechtsteil:
Die keiser l î et alle geistl î che vorstenl ê n mit deme ceptre, al werltl î che vanl ê n l î et her mit vanen. Nich ê n vanl ê n ne m û t her och haben j â r unde tach ledich. (Ssp Landrecht III, 60, §1)1 und:
Men en m û t och nich ê n richte teilen, noch ganz l î en noch teil die deme iz d â gelegen is, s ô daz d â volge an s î und iz die lantl û te l î den solen; iz ne s î eyn sunderlich gr â vescaf, die in eyn vanl ê n h ô re, die ne m û t men nicht ledich haben; also ne m û t der koning nich ê n vanl ê n, her ne virl î et binnen j â re unde tage. (Ssp Landrecht III, 53 §3.2
Im Lehnsrecht lautet der entsprechende Passus:
Iz ne mach och nieman nich ê n gerichte l î en, daz yme gelegen is, iz ne s î eyn sunderlich gerichte, daz in s î n gerichte h ô re, alse gr â veschaph d û t in de marke unde in andere vanl ê n,daz m û t her wol verl î en, unde ne m û t iz s â n mit rechte nicht ledich behalden uber eyn j â r. Also ne m û t die koning nich ê n vanl ê n. (Ssp Lehnr. 71 §3)3
Dieser Satz, der König habe ihm heimfallende Fahnlehen innerhalb von Jahr und Tag wieder auszugeben, wurde immer öfter als Begründung für die besondere Entwicklung Deutschlands herangezogen. Während des ganzen 19.Jahrhunderts und bis zur Mitte dieses Jahrhunderts glaubte man, es habe sich in Deutschland kein größeres Krongut bilden können, weil der Rechtssatz des Sachsenspiegels die stete Ausgabe von Fahnlehen erzwang. Die Möglichkeit zum Ausbau eines einheitlichen Flächenstaates sei damit verhindert worden. Der wichtigste Verfechter dieser Überzeugung war dann im frühen 20. Jahrhundert der Historiker Mitteis, der sie in seiner 1933 erschienen Arbeit Lehnrecht und Staatsgewalt zu einer sogenannten Lehre vom Leihezwang zusammenfaßte und sie später als einen Eckstein der Verfassungsgeschichte bezeichnete.4
Der Begriff Leihezwang selber, der für dieses Phänomen benutzt wurde, entstammt allerdings anderen Zusammenhängen und ist noch relativ neu: er wurde von Heinrich Brunner in den 90er Jahren des 19.Jahrhunderts im Zusammenhang mit einer besonderen Rechtssituationen in der Agrargeschichte benutzt.5 Dieser Begriff setzte sich zwar in der Agrargeschichte nicht durch, wurde aber sehr bald als terminus technicus in Geschichtsbetrachtungen des Lehenswesens übernommen und fand Eingang in die Schulbücher.
Skeptiker traten nur sehr vereinzelt auf. Erstmalig wurde die Theorie des Leihezwanges von Herbert Gunia in seiner Dissertationsschrift zurückgewiesen.6 Diese Arbeit wurde wenig beachtet, was zum Teil daran liegen mochte, daß der darin mehrfach angegriffene Heinrich Mitteis selber die Rezension vornahm, zum anderen Teil aber auch in offensichtlichen Fehlern begründet ist.7 Eine Revision der bis dahin recht unerschütterlichen Theorie wurde ausgelöst durch die 1962 erschienene Habilitationsschrift des Werner Goez, der das Phänomen des sogenannten Leihezwangs recht vielschichtig beleuchtete.8 Er kam letztlich zu dem Schluß, es habe den so bezeichneten Leihezwang faktisch nicht gegeben, die Theorie sei ursächlich begründet in einem falschen Verständnis des Sachsenspiegels und der dahinter stehenden Intention des Eike von Repgow.
Goezes Arbeit fand allgemein eine anerkennende Würdigung. Doch wurde auch Kritik laut: ohne den Schluß Goezes anzuzweifeln, ein Leihezwang sei in der Praxis nicht nachzuweisen und der Repgow'sche Rechtssatz habe für die alltägliche Politik keine Bedeutung gespielt, wies H.G. Krause in der Zeitschschrift für Rechtsgeschichte Goezes Interpretation des Sachsenspiegels zurück und wies seinerseits nach, daß Repgow tatsächlich einen Leihezwang für Fahnlehen in seinem Sachsenspiegel habe ausdrücken wollen.
Das Problem dieser im 19. Jahrhundert aufgekommenen Theorie vom Leihezwang ist nun mehrschichtig und muß in zwei Fragekomplexe untergliedert werden:
- Hat Eike von Repgow in seinem Sachsenspiegel tatsächlich einen Leihezwang im Sinne gehabt, als er seinen Satz von der Wiederausgabe der Fahnlehen formulierte? Hier haben wir es vor allem mit einem literarisch-sprachgeschichtlichen und rechtsgeschichtlichem Problem zu tun.
- Hatte der im Sachsenspiegel genannte Rechtssatz des Leihezwanges Auswirkungen auf die Politik der deutschen Könige? Hier ist von besonderem Interesse der Zeitabschnitt, der mit der Gelnhauser Urkunde (1180) und mit der Abfassung des Sachsenspiegels (1220-23) beginnt und bis zur Wahl Kaiser Karls V., im Jahre 1519, währt. Karl und seine Amtsnachfolger hatten die Nicht-Ausgabe von Krongut zu beschwören, unterlagen einem Einbehaltungszwang.
2. Wird im Sachsenspiegel ein bestehendes Gesetz zum Leihezwang ausgedrückt?
Eike von Repgow, Verfasser des Sachsenspiegel, entstammte der Schicht der Edelfreien und wurde vermutlich im Dorf Reppichau bei Dessau geboren. Er ist in der Zeit von 1209 bis 1233 in sechs Urkunden belegt. Sein Sachsenspiegel wurde ursprünglich zwischen 1220 und 1223/4 in lateinischer Sprache geschaffen. Später, zwischen 1224 und 1227 fertigte Repgow eine deutsche Übersetzung auf Bitten Hoyers von Falkenstein an, in niederdeutsch- elbostfälischer Sprache. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile, in das Landrecht und das Lehnsrecht. Intention des Sachsenspiegel war die Aufzeichnung (die Spiegelung) ungeschriebener, geltender ostfälischer Rechtsgewohnheiten aus der Gerichtspraxis und dem täglichen Leben.9 Dazu flossen in die Arbeit noch Rechtsprinzipien aus Reichs- und Landfriedensgesetzen mit ein. Das Werk hatte Vorbildcharakter für spätere Rechtsbücher (Schwabenspiegel, Deutschenspiegel, Görlitzer Rechtbuch) und beeinflußte verschiedene nord- und ostdeutsche Stadtrechte. Dennoch handelt es sich um eine private Rechtsaufzeichnung ohne hoheitliche Sanktion. Auch flossen Rechtsansichten hinein, die der tatsächlichen Rechtslage zuwider liefen, wie der Satz, daß der Kaiser die Bischöfe ernenne, obwohl seit dem Wormser Konkordat bereits 100 Jahre vergangen waren.10
Das Ansehen des Sachsenspiegels als Quelle für die Wissenschaft unterlag im Laufe der Zeiten einer sehr unterschiedlichen Wertung. Zwischen einem blinden Verlassen auf den Wortlaut bis hin zur Abqualifizierung Eike von Repgows als Phantasten, den man besser nicht zitiert, schwankten die Beurteilungen.11 Heute wird seine Arbeit mit verfeinerten Methoden untersucht, um den Kerngehalt zu ermitteln.
Für das vorliegende Problem des Leihezwangs wies H.G.Kraus die Interpretation des Sachsenspiegel von Werner Goez zurück und stellte eine Untersuchung zu diesem Thema vor. Er verglich verschiedene Textfassungen: den von Karl August Eckardt als lateinische Urfassung oder zumindest als direkte Ableitung davon erkannten und editierten Auctor vetus de beneficiis 12, den gedruckten deutschen Sachsenspiegel und das Görlitzer Rechtsbuch. Zudem stellte er Vergleiche zwischen dem Auctor vetus und den betreffenden Texterwähnungen im Landrecht und im Lehnrecht des Sachsenspiegels an. Beabsichtigt war mit dieser Untersuchung, die Arbeits- und Denkweise des Eike von Repgow zu verdeutlichen, um damit den Stellenwert der Nennungen über die Vergabe von Fahnlehen innerhalb von Jahr und Tag besser interpretieren zu können.
Sehr bestimmt wies Kraus die Interpretation Goezes zurück und kam zu dem Ergebnis, daß der Text von Repgow sehr wohl im wortwörtlichen Sinne zu verstehen ist, daß der deutsche König nach Ssp Landr. III, 60 § 1 verpflichtet ist, Fahnlehen auch dann wieder auszugeben, wenn niemand einen pers ö nlichen Anspruch darauf erheben kann.13
Allerdings betonte Krause, daß aus dem Nachweis der Richtigkeit der Inhaltsbedeutung der betreffenden Textstellen im Sachsenspiegel keinesfalls eine Aussage zur reichsrechtlichen Praxis und des allgemeinen Rechtsbewußtseins getroffen werden kann. Im Gegenteil; hier pflichtete Krause Goez bei und konnte eine Übereinstimmung der von Repgow aufgestellten Prinzipien mit der Wirklichkeit im Rechtsleben des Reiches nicht feststellen. Krause machte ferner darauf aufmerksam, daß sowohl Mitteis als auch Goez den Leihezwang als ein Lehnsrechtliches Prinzip sahen und behandelten, daß aber Eike von Repgow den entsprechenden Passus wohl bewußt in sein Landrecht eingefügt hatte und ihn nicht lehnsrechtlich verstand. Für Repgow standen nicht die zu verlehnenden Territorien im Vordergrund, sondern an erster Stelle die Amtsaufgaben. Er sah die Träger von Fahnlehen in erster Linie als (Lehens-) Inhaber herrscherlicher Funktionen und königlicher Gerichtsbarkeit. An diese Amts-Lehen waren dann allerdings Territorien gebunden.
Krause stellte heraus, daß in der Stauferzeit die Träger von Fahnlehen sich selbst zwar nicht als königliche Beamte, sonder als Inhaber autogener Adelsgewalt verstanden, die Fürstentümer allerdings in der Rechtsauffassung dieser Zeit vor allem mit der sich von König herleitenden Gerichtsbarkeit identifiziert wurden. Für Repgow waren die Fahnlehen also in erster Linie Gerichtslehen. Als Beleg der damaligen Auffassung dienen Krause die verfassungsgeschichtlichen Ausführungen des Giselbert von Mons.14
Darüber hinaus bedauert es Krause, daß im Zusammenhang mit der Leihezwangfrage nicht eingehend untersucht wurde, ob, oder in welchem Umfang, die von Repgow gespiegelten Verhältnisse in seiner näheren Umgebung nicht tatsächlich Realität waren. Ist auch ein Einfluß der von Repgow vertretenen Prinzipien auf die Rechtsrealität im Reich nicht erkennbar, wie unten noch ausgeführt wird, so ist ihr Einfluß auf eine entsprechende regionale Rechtspraxis nicht auszuschließen und bedarf einer Untersuchung.
3. Fand der im Sachsenspiegel genannte Rechtssatz des Leihezwanges praktische Anwendung?
Wenn nun, wie oben dargelegt, der Leihezwang zwar im Sachsenspiegel verzeichnet ist und von Eike von Repgow so verstanden wurde, so muß sich die Frage anschließen, in wie weit dieses Rechtsprinzip in den Köpfen der politisch handelnden Personen verankert war, und welchen Einfluß es im politischen Alltagsgeschäft gewonnen hat.
Die im 19.Jahrhundert aufgekommene, und bis zur Mitte dieses Jahrhunderts verfochtene Lehre vom Leihezwang und seinen für die Reichentwicklung bedeutsamen Folgen stützte sich in erster Linie auf die Angaben im Sachsenspiegel. Obwohl Mitteis einige Beispiele aus den Urkundenbeständen zur Untermauerung dieser Lehre vom Leihezwang anzuführte, fand tatsächlich keine eingehende Untersuchung statt, um diese Lehre, von Goez als Dogma bezeichnet, an Hand der Rechtspraxis zu überprüfen.15 Das Verdienst von Werner Goez liegt nun vor allem in der Konfrontation des Rechtsprinzips mit den Quellen und dem daraus erbrachten Nachweis, daß ein Leihezwang in der Rechtspraxis tatsächlich keine Bedeutung hatte.16
Nach der Untersuchung Krauses ist der Abschnitt Landrecht III 60 § 1 des Sachsenspiegels, der sogenannte "locus classicus", positiv so zu verstehen, daß der deutsche König verpflichtet ist, Fahnlehen auch dann wieder auszugeben, wenn niemand einen persönlichen Anspruch darauf erheben kann.17 Bei Untersuchung der Verleihepraxis wurde aber deutlich, daß Situationen, wo ein Fahnlehen heimfiel und dem König zur Neuausgabe zur freien Verfügung stand, gar nicht so häufig waren. Stattdessen findet sich eine Fülle von Fällen, wo der König verpflichtet war, einem Anspruch auf Investitur nachzukommen wo dieser aber ein echter Heimfall gar nicht vorausgegangen war.
Die Situation, wo der Sohn den Vater beerbte, ist die häufigste Form der Weitergabe von Lehnsgut. Die Erblichkeit von Lehen hatte sich bereits durchgesetzt und der Tod eines Lehnsmannes bedeutete keinen Heimfall. Das gilt gleichermaßen für das in den westlichen Teilen des Reiches praktizierte Recht einer weiblichen Erbfolge.
Weitere Fälle, die eine freie Verfügung ausschlossen, waren:
- Das Erbrecht der Agnaten. Schon das Lehnsrecht Konrads II. von 1037 läßt die Vererbung auf die Enkel beim Tod des Sohnes zu, ebenso die Verebung auf den Bruder, wenn kein Sohn vorhanden ist. Hierbei war der Begriff des feudum paternum besonders wichtig: die Agnaten hatten nur Erbansprüche auf diejenigen Lehnsteile, die ihr und des Erblassers erster gemeinsamer Vorfahre bereits besessen hatte. Das Agnatenerbrecht bestand auch in Fällen von Felonie und Resignation weiter. Allerdings galt das Prinzip, daß Teilung ein Lehen zerstört. Die einzelnen aus Teilung hervorgegangenen Stücke galten in diesem Fall als neu konstituierte Lehen. Ein Kognatenerbrecht war nur dort möglich, wo auch die weibliche Lehensfolge üblich war.
- Freie Vererbung über Testament: In der Regel war ein Lehen nicht mittels Testament vererbbar. Wollte der Inhaber eines Reichslehen dennoch mittels Testament darüber verfügen, war die Zustimmung des Königs zwingen erforderlich, anderenfalls war die Testamentsverfügung nichtig. Der Fall war selten. Ein Sonderfall der Weitergabe mittels testamentarischer Verfügung war die Erbverbrüderung. Bei dieser Erbverbrüderung, zu der ebenfalls die Zustimmung des Königs erforderlich war, setzten sich zwei Familien gegenseitig zum Erben ihrer Lehen ein, für den Fall, daß eine Familie ausstarb.
- Die Eventualbelehnung. Hier belehnt der König einen neuen Lehnsmann, obwohl sich das Lehen noch in den den Händen eines Inhabers befindet und ein Übergang des Lehens nur beim Tod ohne Erben in Frage kommt. Durch den Tod geht das Lehen automatisch auf den neuen Lehnsmann über, dessen Belehnung ja bereits stattgefunden hatte. Ein Heimfall ist hier nur theoretisch vorhanden, denn das Lehnsverhältnis des neuen Lehnesmannes beginnt unmittelbar mit dem Tod des alten Lehnsnehmers.
- Expektanz oder Anwartschaft. Hier verspricht der König einem Anwärter, ihn mit einem bestimmten oder mit dem nächsterreichbaren Lehngut zu belehnen, für den Fall, daß der Heimfall eintritt. Zwar tritt bei der Expektanz ein echter Heimfall ein, allerdings steht das Lehnsgut nicht mehr in der freien Verfügungsgewalt des Königs.
- Die Gesamtbelehnung. Sie war eigentlich bei Fahnlehen verboten, wurde dennoch in einigen Teilen des Reiches praktiziert.18 Sie verhinderte in der Regel den Heimfall völlig, denn hierbei wurde ein Lehen mehreren Personen gleichzeitig und gemeinsam übertragen.
Goezens Untersuchung über die Verlehnungspraxis der deutschen Könige zeigt, daß eine Fülle von Sonderregelungen die Heimfallmöglichkeit und die Ausgabe von Fahnlehen stark begrenzten. Unter den Fällen, wo dem König ein Fahnlehen zur freien Verfügung stand, findet sich, soweit heute bekannt, keine Verlehnung die erkennen ließe, daß der König bewußt aus dem im Sachsenspiegel erhobenen Verleiheprinzip gehandelt hätte, und das auch nur dort und im Nachfolgewerk, dem Schwabenspiegel, verzeichnet ist.19
Die ältere Forschung zog zum Beleg der Richtigkeit der Theorie vom Leihezwang die sogenannte Gelnhauser Urkunde von 1180 als Paradigma heran, doch gerade hier lassen sich aus dem Zusammenhang ihrer Vergabe -ebenso wie in anderen Fällen- ganz andere Intentionen erkennen. Ein Bewußtsein von einem Leihezwang scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. Das soll an verschiedenen Beispiele erläutert werden.
3.1 Fahn- oder Fürstenlehen als Instrument der Politik am Beispiel der Gelnhauser Urkunde von 1180
3.1.1 Die Gelnhauser Urkunde in der Sicht der älteren Forschung
Die von Mitteis zum Beweis des Rechtsprinzips des Leihezwangs angeführte Gelnhäuser Urkunde (1180) wird von ihm als die erste Anerkennung dieses Prinzips bezeichnet.20 Mitteis begründete den Leihezwang als ein "Muß" im Zuge der Herausbildung des Reichsfürstenstandes, um das zwischen Königtum und dem vierten Heerschild entstandene Vakuum zu füllen. Die Wiederbesetzung des freien Platzes bei Heimfall soll dem König zur verfassungsmäßigen Pflicht gemacht worden sein.21 Mitteis sieht in den Ereignissen von Schließung des Reichsfürstenstandes, Leihezwang und die Heerschildordnung einen Verfassungskompromiss zwischen Kaiser Friedrich und dem Fürstenstand, der sich an der Gelnhäuser Urkunde festmacht.22
Diese Sichtweise scheint mir problematisch, da sie die Gelnhäuser Urkunde als Angelpunkt eines allgemeinen Verfassungskompromisses voraussetzt. Sicherlich findet dieser Zeit eine Entwicklung statt, bei der sich ein abgeschlossener Reichfürstenstand herausgebildete, der eine direkte Lehnsbindung niederer Heerschilde an den König unterband, doch die konkrete Anbindung dieser Entwicklung an die Gelnhäuser Urkunde scheint bedenklich und die der Urkunde zugrunde liegenden Ereignisse nicht zu berücksichtigen. Auch weicht die neuere Forschung von der Mitteis'schen Sichtweise ab und spricht von langfristigen Tendenzen, die durch die Ereignisse des Jahres 1180 beschleunigt, nicht aber zu diesem Zeitpunkt bereits realisiert waren.23
Für die Frage nach dem Leihezwang bedeutet das: Es liegt dieser Urkunde zwar ein Kompromiß zu Grunde, doch weniger ein verfassungsrechtlicher als vielmehr ein auf das politische Tagesgeschehen bezogener. Ich bin der Auffassung, daß diese Urkunde vor allem unter praktischen, politischen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung des Vor- und Folgegeschehens gesehen werden muß.
3.1.2 Exkurs zur Vorgeschichte der Gelnhauser Urkunde
Die Wahl Friedrichs zum König im Jahre 1152 gilt als eine Kompromißwahl der Fürsten zwischen dem babenbergisch-staufischen und dem welfischen Lager.24 Friedrich war in gleicher Weise mit dem einen wie dem anderen Lager verwandt. Zu Beginn seiner Amtszeit stand die Lösung etlicher, das Reich erschütternder Streitigkeiten um Besitz- und Herrschaftsrechte aus der Zeit Konrads III. an. Friedrich suchte, um das Reich zu befrieden, nach einem Ausgleich mit den Fürsten;25 von dieser Ausgleichspolitik profitierte vor allem Heinrich der Löwe. So wurde ihm das strittige Herzogtum Bayern zuerkannt, zu seinen Gunsten wurde auch der Streit um die Investitur der slavischen Bistümer Oldenburg, Mecklenburg und Ratzeburg entschieden. Heinrich wiederum unterstützte Friedrich in seiner Politik und nahm an den ersten Italienfeldzügen teil, so daß gerade die politischen Erfolge der ersten Regierungsjahre auf seiner Hilfe gegründet sind.26
Heinrich war nicht nur mit dem Kaiser verwandt, sondern er stieg auch zum mächtigsten Mann im Reich hinter dem Kaiser auf. Allerdings mußten sich zwischen beiden Persönlichkeiten Spannungen aufbauen, als Heinrich in die Außen- und Innenpolitik des Kaisers eingriff. Er betrieb Heiratspolitik und näherte sich dem englischen Herrscherhaus an, während Friedrich sich politisch um Frankreich bemühte. An den Italienfeldzügen Friedrichs nahm Heinrich seit 1161 nicht mehr teil, vielmehr verlegte er seine Anstrengungen auf eine ausgreifende Ostkolonisation sowie eine Abrundung seines Machtbereichs innerhalb seiner Herzogtümer, insbesondere in Sachsen. Seine rücksichtslose Politik weckte bald den Wiederstand anderer Reichsfürsten, so daß ihm als Opponenten neben Albrecht dem Bären auch die Erzbistümer Magdeburg, Bremen, Köln und verschiedene Bistümer gegenüberstanden.27 Zu einem inneren Bruch mit Friedrich muß es im Jahre 1176 gekommen sein, als er dem Kaiser in Chiavenna die Hilfeleistung versagte. Friedrich war in der Auseinandersetzung mit dem lombardischen Bund in eine prekäre Situation gelangt, doch hatte er weder Lehn- noch landrechtlich die Möglichkeit, Heinrich zur Hilfe zu verpflichten. Heinrich war zur freiwilligen Hilfe nur bereit, wenn Friedrich ihm die Reichsstadt Goslar samt Silbergruben überlassen hätte, was der Kaiser ablehnte.28
Die Situation vor dem Sturz Heinrich des Löwen war so geprägt, daß mit seiner Person ein neuer, unberechenbarer, eigenwilliger und starker Machtfaktor neben dem Kaiser entstanden war, der sich mit etlichen Reichsfürsten zerstritten und das Vertrauen des Kaisers verloren hatte. Heinrich wurde von Philipp von Heinsberg, der die Rechtsvertretung des vertrieben Bischofs Ulrich von Halberstadt übernommen hatte, auf dem Reichstag bei Speyer im Jahre 1178 angeklagt; Friedrich ließ die Klage zu. Auf Grund der Klage, hierbei handelte es sich um ein landrechtliches Verfahren, wurde Heinrich zum Reichstag in Worms, im Januar 1179 vorgeladen, wo er nicht erschien. Auf Grund der Mißachtung der Ladung wurde gegen ihn die Acht ausgesprochen. Es ist aus der Narratio der Gelhäuser Urkunde nicht eindeutig ersichtlich, darum auch umstritten, ob Heinrich bereits auf dem Reichstag in Worms in Acht getan, oder aber das Urteil dort nur beschlossen, die Verkündung aber bis zum Hoftag in Magdeburg im Juni 1179 aufgeschoben und von Heinrichs Erscheinen dort abhängig gemacht worden ist. Die letztere Möglichkeit gilt allgemein als die wahrscheinliche.29 Heinrich war Welfe, darum mußte über ihn nach schwäbischem Recht geurteilt werden. Die Urkunde spricht in diesem Zusammenhang auch ausdrücklich von schwäbischen Standesgenossen, die am Urteil mitwirkten. Edmund Stengel vertritt ebenfalls die Auffassung, daß ein Urteil gegen Heinrich höchstwahrscheinlich bereits in Worms zustande gekommen ist, da sich nur dort die schwäbischen Standesgenossen als eine geschlossene Gruppe feststellen lassen, die Urteilsverkündung aber bis zum Juni ausgesetzt wurde.30 Der Junitermin für die Verkündung der Acht steht damit juristisch einwandfrei in einem fristmäßigen Zusammenhang mit dem Termin der Oberacht-Verkündung, im Sommer 1180. Die Oberacht ist durch zwei Quellen für den Sommer 1180 belegt.31
Parallel zum landrechtlichen Verfahren wurde wegen Mißachtung des Kaisers ein Lehnsrechtliches Verfahren gegen Heinrich eingeleitet. Begründet wurde diese Mißachtung des Kaisers, die Majestätsbeleidigung, mit dem Fernbleiben von Hoftagen, zu deren Teilnahme Heinrich als Lehnsmann verpflichtet gewesen wäre. Es erfolgten im Zuge dieses Lehnsrechtlichen Verfahrens drei Ladungen, die Heinrich alle nicht wahrnahm. Die erste Ladung muß, nach der Darstellung Stengels, nach dem Reichstag in Worms für den Hoftag in Magdeburg erfolgt sein.32 Die zweite Ladung galt für Kayna, die dritte für Würzburg. Hier wurden ihm, im Januar 1180, seine Reichslehen durch den Spruch von Standesgenossen aberkannt. Verurteilt wurde er aber nicht etwa wegen des angeklagten Vergehens der Mißachtung des Kaisers, sondern wegen Mißachtung der Ladungen (contumacia=Widerspenstigkeit). Dieses Verfahren, eindeutig konform mit Lehnsrechtlichen Prinzipien, hatte für Heinrich die völlige Entmachtung zur Folge, während eine Verurteilung wegen Majestätsbeleidigung sicherlich weniger folgenschwer gewesen wäre.33
3.1.3 Der Leihezwang und die Gelnhauser Urkunde von 1180
Die dem Kaiser durch das Urteil in Würzburg zugefallenen Reichslehen Heinrichs des Löwen behielt Friedrich nicht in Reichsbesitz, sondern gab Sachsen in geteilter Form schon im April 1180 zu Gelnhausen wieder als Lehen aus. Diese Tatsache, und der in der in der Dispositio der Urkunde erwähnte Rechtsspruch der Fürsten, wurde in der Vergangenheit als Beweis für einen Leihezwang gewertet. Tatsächlich findet sich in dieser Urkunde aber keine, weder direkte oder indirekte, Nennung des Leihezwangs, der erstmals im Sachsenspiegel in den Zwanziger Jahren des nachfolgenden Jahrhunderts erwähnt wurde. Auch die Wiederausgabe der Welfischen Herzogtümer nach der Verurteilung Heinrichs des Löwen bietet keinen Hinweis auf den Leihezwang, vielmehr deuten die Umstände auf andere Notwendigkeiten. Ein Problem in der Auseinandersetzung mit Heinrich dem Löwen lag vor allem darin, daß ein wie auch immer gearteter Rechtsspruch nur dann Wirkung zeigen konnte, wenn die Möglichkeit zur Vollstreckung gegeben war. Aus diesem Grund hätte ein rein landrechtliches Verfahren nur dann Wirkung gezeigt, wenn die Oberacht, der Heinrich im Sommer 1180 verfallen war, auch hätte durchgesetzt werden können. Da aber Heinrich als bedeutender Reichsfürst über zahlreiche Lehnsleute verfügte, hätte die Durchsetzung eines Urteils wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. In dieser Situation griff nun das Lehnsrechtliche Verfahren. Durch die Aberkennunng der Reichslehen war Heinrich von seinen Gefolgsleuten getrennt und ausschließlich auf eigene Kräfte angewiesen. Allerdings hätte der Kaiser auch einem seiner Gefolgsleute beraubten Heinrich gegenüber kaum aus eigenen Kräften die Lehnsenthebung durchsetzen können. Er war also unbedingt auf die Hilfe der Fürsten angewiesen, eine Hilfe, für die er sich erkenntlich zeigen mußte. Darüber hinaus mußte der Kaiser die Wiederholung einer Gefahr durch Machtkonzentration in einer Hand verhindern. Den Fürsten, hier vor allem den Nachbarn Heinrichs, war die Ausschaltung Heinrichs als Störer ihrer Interessen wichtig. Das mit der Gelnhauser Urkunde verknüpfte Geschehen lag damit sowohl im Interesse der Fürsten wie auch des Kaisers.
Zur Begründung läßt sich anführen:
Die für den Sommer des Jahres 1180 (St.Jakobi=25.Juli) geplante Reichsheerfahrt gegen Heinrich wurde ebenfalls in Gelnhausen beschlossen.34 Eine Untersuchung zu den Reichsheerfahrten der Jahre 1125-1254 zeigt, daß die in der Gelnhauser Urkunde als Hauptbegünstigte genannten Philipp von Heinsberg und Bernhard von Anhalt (Sohn Albrechts des Bären), auch die Hauptheerführer des Kriegszugs gegen Heinrich waren und ihre Lehnsleute die Masse der Teilnehmer stellte.35 Kein einziger süddeutscher Fürst oder Graf nahm an den Kriegszügen gegen Heinrich (1180/1181) teil, sondern es finden sich dort, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ausschließlich am Sturz Heinrichs persönlich interessierte und profitierende Kreise.36 Das erklärt, warum es in Gelnhausen schon zu einer Lehenvergabe kam, obwohl die Entmachtung Heinrichs noch nicht bewerkstelligt war: Den Einsatz der Fürsten bei Durchsetzung des Urteils hatte der Kaiser mit dem Preis der Lehensausgabe zu bezahlen. Die dabei vorgenommene Teilung kam wiederum den Interessen des Kaisers entgegen: eine Machtkonzentration, wie sie in den Händen Heinrichs bestanden hatte, konnte sich in dieser Konstellation nicht wiederholen.
Die Sichtweise, daß mit der Gelnhauser Urkunde kein Verfassungskompromiß dokumentiert wurde, der neben anderem auch den Leihezwang zum Inhalt hatte, sondern daß es sich tatsächlich um einen politischen Kompromiß handelte, der eine Folge aus den Umständen und dem Vorgeschehen war, scheint mir bei der Betrachtung dieses Dokuments wesentlich angemessener zu sein.
Ebenso ist auch der Wortlaut der Urkunde, der sich innerhalb der Dispositio auf die Zustimmung der Fürsten beim Akt der Lehensausgabe bezieht, nicht als ein Hinweis auf einen den König im Sinne des Leihezwangs in seinem Handeln zwingenden Rechtssatz zu verstehen. Darauf verwies schon Hermann Heimpel in seiner Rede über Kaiser Barbarossa.37 Heimpel führte aus, daß der Ausdruck "ex sententia principum" sich vielmehr auf die Zustimmung der Fürsten zum Verfahren der Belehnung an Philipp von Heinsberg bezieht.38 Und ein weiteres Indiz, daß der Gelnhauser Urkunde keinerlei Leihezwang sondern politisches Kalkül zu Grunde lag, findet sich in der Beschriftung des Grabsteins von Philipp von Heinsberg auf die Alfred Haverkamp hinweist: Der Kölner Erzbischof soll zum Erwerb des westfälischen Teiles des Herzogtums Sachsen an die kaiserliche Kasse 50000 Mark Silber abgeführt haben.39 Die Summe scheint doch zu hoch zu sein, wenn der Kaiser (bei Leihezwang) generell zur Lehensausgabe verpflichtet gewesen wäre.
3.2 Vorteilsvergabe durch nicht angewandten Leihezwang - ein Hinweise auf die fehlende Verankerung des Leihezwangs im Rechtsbewußtsein
Im vorigen Abschnitt ist dargelegt worden, daß gerade im Fall der Gelnhauser Urkunde aus den damit verbundenen Umständen erhebliche Zweifel dagegen erhoben werden können, daß Friedrichs Handeln vom verfassungsrechtlichen Prinzip des Leihezwangs bestimmt war; vielmehr deuten starke Hinweise darauf hin, daß er von den Notwendigkeiten der Politik gelenkt wurde. Es soll nun ein Beispiel erörtert werden, wo das Instrument des Leihezwangs zum Vorteil des Königs hätte angewandt werden können. Daß es auch hier nicht Anwendung fand, spricht dafür, daß es im Bewußtsein des Herrschers gar nicht existierte, obwohl zu dieser Zeit die schriftliche Niederlegung des Leihezwangs im Sachsenspiegel bereits erfolgt war.
Die Zeit des Interregnums wurde mit der Thronbesteigung Rudolfs im Jahre 1273 beendet. Mit dem Beginn von Rudolfs Regierung begann die Revindikationspolitik, das Bemühen, verdunkeltes, entfremdetes und widerrechtlich besetztes Reichsgut der Krone erneut zu unterstellen. Die Rechtmäßigkeit seines Strebens wurde Rudolf auf dem Reichstag zu Nürnberg durch Fürstenspruch ausdrücklich bestätigt.40 In diesem Zusammenhang war dann im Jahre 1281, ebenfalls auf einem Reichstag in Nürnberg, beschlossen worden, daß die künftige Wiederausgabe von Reichsgut nur mit Zustimmung von König und Fürsten vorgenommen werden konnte.41 Es wurde damit also eine deutliche Eingrenzung der Lehensausgabe vorgenommen, die nur wenig mit dem Rechtsprinzip des Leihezwang harmoniert, wenn es Einzug in die Politik gefunden hätte.
Von der Revindikationspolitik besonders betroffen war Ottokar von Böhmen, der in der Zeit des Interregnums seinen Einflußbereich durch die Einvernahme von Ländereien, auf die er keinen Rechtsanspruch hatte, erheblich erweitern konnte. Zwei Feldzüge waren notwendig, bis Ottokars Widerstand durch den Sieg bei Dürnkrut im Jahre 1278 endgültig gebrochen war. Bereits 1276 hatte Ottokar die Landschaften Österreich und Steiermark an die Krone zurückgeben müssen, der sie durch das Aussterben der Babenberger (1246) zustanden.42 Zwischen 1276 und 1282 waren diese Länderreien, ganz im Gegensatz zum Rechtssatz des Leihezwanges, der von einer Wiederausgabe innerhalb von Jahr und Tag spricht, einer Reichsverwaltung unterstellt, bis am Jahresende 1282 dann Rudolfs Söhne Albrecht und Rudolf damit belehnt wurden.43
An dieser ausführlichen Belehnungsurkunde fällt die eigenartig formulierte Arrenga auf, wo sich der König auf römisches Recht beruft, demzufolge er nicht dem bürgerlichen Gesetz unterstellt sei. Allerdings räumt er ein, er sei dem Naturrecht unterworfen. Die Narratio der Urkunde greift den Gedanken des Naturrechtes auf, und berichtet, daß er, der König, auf Anregung und Anordnung dieses Naturgesetzes bestrebt sei, die Standeserhöhung und Entfaltung seines Geschlechtes zu betreiben.
Aus der Abfassung der Urkunde wird das Bemühen um seine Familie nicht nur als Motiv seines Handelns deutlich, es wird auch als Begründung für Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs herangezogen. Völlig konform mit dem Reichstagsbeschluß des Jahres 1281, gegen den diese Belehnung sonst verstoßen hätte, hatte sich Rudolf bereits im Sommer des Jahres um das Einverständnis der Kurfürsten bemüht.44
Die Belehnung der Söhne Rudolfs ist in dieser Form wenig verständlich, wenn Rudolf der Leihezwang als Rechtsprinzip bewußt gewesen wäre. Seine konsequente Anwendung in diesem Fall hätte ihm eine wesentlich festere Rechtsgrundlage gegeben als die Berufung auf das Naturrecht, aus dem heraus er einem inneren Drang zur Verbesserung seiner Familie folgte. Daß die Belehnung in der vorliegenden Weise begründet wurde, deutet aber sehr daraufhin, daß der Leihezwang als verfassungsgemäßes Instrument nicht im Rechtsbewußtsein verankert war.
Goez verweist in seiner Arbeit zum Leihezwang auch auf den vergeblichen Versuch Rudolfs hin, das Herzogtum Schwaben wieder herzustellen, und zeigt auf, daß Rudolf an keiner Stelle den Leihezwang erwähnte, der ihm hierbei von außerordentlichem Nutzen hätte sein können.45
3.3 Weitere Umstände, die auf ein Fehlen des Leihezwangs im Rechtsbewußtseins deuten
Es finden sich weitere verschiedene Merkmale, die erkennen lassen, daß der im Sachsenspiegel formulierte Rechtssatz eines Leihezwangs nicht zum Instrumentarium der mittelalterlichen Politik gehörte.
So gehört vor allem dazu die Verletzung der Zeitbestimmung, die eine Wiederausgabe innerhalb eines Jahres und eines Tages vorsah.
Aus seinen untersuchten Fällen schloß Goez, daß die Könige die Zeitbestimmung von Jahr und Tag nicht beachteten und nach Gutdünken, ohne Berücksichtung der Frist, ihre Leihepraxis handhabten.46 Er stellte sowohl Fälle fest, wo dafür erkennbare Gründe vorlagen, als auch solche, wo diese völlig fehlten. Gerade aus dem Fehlen von Gründen für eine Fristenverletzung, also eines grundlosen Gesetzesbruchs, ist der Schluß zu ziehen, daß den Herrschern, und den ihnen gegenüber oft als Widerpart auftretenden Reichsfürsten, das im Sachsenspiegel vertretene Rechtsprinzip nicht bewußt oder sogar völlig unbekannt gewesen sein muß.
Das von einem mangelnde Bewußsein dieses Rechtsprinzips des Sachsenspiegels ganz allgemein ausgegangen werden kann, zeigt auch, daß von maßgeblichen Reichsfürsten mehrfach die freie Verfügungsgewalt des Königs über heimgefallene Reichslehen urkundlich bestätigt wurde. Zu nennen sind vor allem die Weistümer, die beim Reichstag in Frankfurt 1252 vom Kölner Erzbischof und den Bischöfen von Straßburg und Würzburg zu Gunsten König Wilhelms von Holland für Recht erkannt und verkündet wurden: Nicht fristgemäß gemutete Reichsfürstentümer und sonstige Reichslehen sollten dem König ledig werden, der dann darüber nach Belieben frei verfügen könne.47 Wäre den Fürsten das Prinzip eines Leihezwanges bewußt gewesen, so hätten sie, besonders dem schwachen Wilhelm von Holland gegenüber, kaum einen Rechtssatz formuliert, in dem sie bestätigten, der König könne über die heimfallenden Lehen und Fürstentümer verfügen wie es ihm beliebe.
4. Zusammenfassung
Es ist festzuhalten, daß auf Grund der Untersuchung von H.G. Krause nicht nur der Wortlaut des Sachsenspiegel auf einen Leihezwang verweist, sondern Repgow tatsächlich auch von einem Leihezwang ausgegangen ist. Allerdings sah er das Prinzip des Leihezwanges nicht unter Lehnsrechtlichen, sonder unter landrechtlichen Aspekten. Das von ihm gemeinte Fahnlehen war die vom Kaiser übertragene Gerichtshoheit, wozu auch ein entsprechendes Territorium gehörte.
Allen Rechtsquellen, außer dem Sachsenspiegel und dem davon herrührenden Schwabenspiegel, ist dieses "Leihezwang" genannte Rechtsprinzip nicht bekannt.
De facto war der Leihezwang nicht im allgemeinen Bewußtsein vorhanden. Dennoch wurden die Fahnlehen in der Regel immer wieder ausgegeben, aber aus anderer Intention. Es scheinen für die Lehensausgabe eine Fülle von Gründen maßgebend gewesen zu sein, zu welchem Zeitpunkt ein König welches Lehen an wen ausgab. Die Anwendung und der Wunsch nach Wahrung eines Rechtsprinzips vom Leihezwang, oder überhaupt ein Bewußtsein davon, sind dabei allerdings nicht erkennbar.
Bei der Behauptung eines Leihezwang-Prinzips, daß die staatliche Entwicklung Deutschlands massiv in eine bestimmte Richtung beeinflußte, setzten die Verfechter dieses Prinzips stillschweigend bei Heimfall von Fahnlehen einen generellen Einbehaltungswillen der Könige und das Bemühen der Herrscher um ein umfangreiches Krongut voraus. Auf Grund des Wahlkönigtums spielten für die früheren Herrscher aber Überlegungen zur eigenen Familienpolitik eine bedeutende Rolle. Auch war das Reich in seinem Selbstverständnis ein Lehnsstaat und die Wiederausgabe von Lehnsgut eine Selbstverständlichkeit.
Die in der Einleitung genannte, ehemals als Konsens geltende Überzeugung, in dem im Sachsenspiegel formulierten Leihezwang die Ursache der unterschiedlichen Entwicklung Frankreichs und Deutschlands zu sehen, hat heute keinen Bestand mehr. Vielmehr werden heute andere, unterschiedliche Faktoren als wesentlich angesehen.
Für die Entwicklung Deutschlands waren besonders prägend:
Der zahlreich vorhandene Allodialbesitz, der den Aufbau eines zusammenhängenden Flächenstaates unmöglich machte, dann die Einrichtung des Wahlkönigtums. Besonders für die Zeit nach den Staufern gilt, daß in Deutschland Familiensinn und Staatsraison sich best ä ndig Widerpart geleistet haben.48
5. Quellen- und Literaturverzeichnis
5.1 Quellen
Repgow, E.: Sachsenspiegel (=Monumenta Germaniae historica, Fontes iuris Germanici antiqui, NS, Bd. 1, Teile 1 und 2, ed. von K.A. Eckardt, Göttingen 1955 und 1956), zitiert: Repgow, E., Sachsenspiegel
Weinrich, L.: Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts-, und Sozialgeschichte bis 1250, Darmstadt 1977, (=Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe, Bd. XXXII)
Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches im Spätmittelalter (1250-1500), Darmstadt 1983, (=Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom Stein - Gedächtnisausgabe, Bd. XXXIII) zitiert: Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte (1250-1500)
5.2 Literatur
Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte im Hohen Mittelalter, Göttingen 21983, (=Deutsche Geschichte, Bd.2, hrsg. von J. Leuschner)
Giesebrecht, W.v.: Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd.6, Meersburg 1930
Goez, W.: Der Leihezwang, phil. Habil., gedruckt Tübingen 1962
Haverkamp, A.: Aufbruch und Gestaltung, Deutschland 1056-1273, München 1984, (=Deutsche Geschichte Bd.2, hrsg. von P.Moraw)
Heimpel, H.: Deutschland im späten Mittelalter, in: Just, L.: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.1, Teil V
Heimpel, H.: Kaiser Friedrich Barbarossa und die Wende der staufischen Zeit, Straßburg 1942, (=Straßburger Universitätsreden, Heft 3), zitiert: Heimpel, H., Kaiser Friedrich Barbarossa
Krause, H.G.: Der Sachsenspiegel und das Problem des sogenannten Leihezwangs, in: ZRG germ. Abteilung, Bd.93, 1976, S. 21-99, zitiert: Krause, H.G., Sachsenspiegel
Krieger, K.-F.: Die Lehnshoheit der deutschen Könige im Spätmittelalter (ca.1200-1437), Aalen 1979
Leuschner, J.: Deutschland im Späten Mittelalter, Göttingen 21983, (=Deutsche Geschichte, Bd. 3, hrsg. von J. Leuschner)
Maschke, E.: Der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, in: Just, L.: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.1, Teil IV
Mitteis, H.: Lehnrecht und Staatsgewalt, Untersuchungen zur Mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Darmstadt 1933, rep. Köln-Wien 1974
Mitteis, H.: Rezension von H.Gunia, Leihezwang, ZRG germ. Abteilung, Bd.59 1939, S.399-407
Stengel, E.E.: Abhandlungen und Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte, Köln 1960, zitiert: Stengel, E.E., Abhandlungen
[...]
1 Repgow, E.: Sachsenspiegel, (MGH, font.iuris Germ. ant., K.A. Eckardt ed.), S.143
2 Repgow, E.: Sachsenspiegel, S.138 f
3 Repgow, E.: Sachsenspiegel, S.229
4 Mitteis, H.: Rezension von H.Gunia, Leihezwang, ZRG germ. Abteilung, Bd.59 1939, S.400
5 Krause, H.G.: Der Sachsenspiegel und das Problem des sogenannten Leihezwangs, in: ZRG germ. Abteilung, Bd.93, 1976, S. 25
6 Gunia, H.: Der Leihezwang, ein angeblicher Grundesatz des Reichsstaatsgesetzes im Mittelalter, phil. Diss., Berlin 1938
7 Goez, W.: Der Leihezwang, S. 14
8 Goez, W.: Der Leihezwang, phil. Habil., gedruckt Tübingen 1962
9 HRG, Sp. 896, s.v. Eike von Repgow
10 Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte im Hohen Mittelalter, Göttingen 21983, S. 109 (Deutsche Geschichte Bd.2, hrsg. von J. Leuschner)
11 Goez, W.: Der Leihezwang, S. 238
12 Auctor vetus de beneficiis, Teil [1]: Lateinische Texte, hrsg. von K.A. Eckardt, Hanover 1964 (MGH Fontes iuris Germanici antiqui NS 2.1)
13 Krause, H.G.: Der Sachsenspiegel, S. 89
14 Krause, H.G.: Der Sachsenspiegel, S. 93f, FN 211
15 Goez, W.: Der Leihezwang, S.1-19, besonders S.15
16 Goez stützte sich dabei auf die Forderung von Heinrich Mitteis, der sagte: Erstes Erfordernis einer solchen Untersuchung ist eine möglichst umfassende Heranziehung der Rechtstatsachen. Die Aussagen der Rechtsquellen im eigentlichen Sinne können zwar die Richtung weisen, aber nicht das Endergebnis bestimmen. (Mitteis, H.: Lehnrecht und Staatsgewalt, Untersuchungen zur Mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, S. 11 f, zitiert als Vorspruch bei W. Goez, Der Leihezwang.
17 Krause, H.G.: Der Sachsenspiegel, S. 89
18 Schwabenspiegel, Landrecht § 121, zitiert bei Goez, W.: Leihezwang, S. 94-105
19 Goez, W.: Der Leihezwang, S. 208, S. 226
20 Mitteis, H.: Lehnrecht und Staatsgewalt, S.432
21 Mitteis, H.: Lehnrecht und Staatsgewalt, S.442
22 Mitteis, H.: Lehnrecht und Staatsgewalt, S.443
23 Haverkamp, A.: Aufbruch und Gestaltung, Deutschland 1056-1273, S.237
24 Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte im hohen Mittelalter, S.154
25 Maschke, E.: Der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, in: Just, L.: Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.1, IV., S. 33
26 Maschke, E.: Der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, S.42
27 Maschke, E.: Der Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum, S.42f
28 Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte im hohen Mittelalter, S.178f, 186
29 Horst Fuhrmann spricht in seiner “Deutschen Geschichte im hohen Mittelalter” von einem Feststellungsurteil (S.187).
30 Stengel, E.E.: Abhandlungen und Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte, S.128ff
31 Pegauer Annalen, Reichersberger Chronik, zitiert bei Stengel, E.E.: Abhandlungen, S. 129
32 Stengel, E.E.: Abhandlungen, S.130f
33 Das Vergehen der Majestätsbeleidigung entstammt dem römischen Recht, das über Jahrhunderte vergessen und erst zu Beginn des 1200 Jahrhunderts durch den Gelehrten Inerius Werner in Bologna wieder zum Gegenstand der Wissenschaft gemacht worden war. (Fuhrmann, H.: Deutsche Geschichte im hohen Mittelalter, S.86)
34 Pegauer Annalen: Expeditio usque ad festum sancti Iacobi omnibus principus contra ducem Heinricum iudicitur ab imperatore Friderico (MGH SS 16, 263), zitiert bei: Goez, Der Leihezwang, S.231
35 Gattermann, G.: Die deutschen Fürsten auf der Reichsheerfahrt, Studien zur Reichskriegsverfassung der Stauferzeit, 2 Teile, phil. Diss., Frankfurt 1956, maschinenschriftlich, Teil 1, S.106 ff, zitiert bei Goez, W.: Der Leihezwang, S.231 FN 29
36 Goez, W.: Der Leihezwang, S.233 ff
37 Heimpel, H.: Kaiser Friedrich Barbarossa und die Wende der staufischen Zeit, Straßburg 1942,
38 Heimpel, H.: Kaiser Friedrich Barbarossa, S.21f
39 Haverkamp, A.: Aufbruch und Gestaltung, S.239
40 Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches im Spätmittelalter (1250-1500), Nr. 26, S.108 ff
41 Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte (1250-1500), Nr. 40, S.146; und: Leuschner, J.: Deutschland im Späten Mittelalter, Göttingen 21983, S. 121 (Deutsche Geschichte, Bd. 3); auch: Goez, W.: Der Leihezwang, S.146
42 Heimpel, H.: Deutschland im Späten Mittelalter, S. 20-25
43 Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte (1250-1500), Nr. 47b, S. 158 ff
44 Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte (1250-1500), Nr. 47a, S. 156 f
45 Goez, W.: Der Leihezwang, S.148
46 Goez, W.: Leihezwang, S. 185
47 Weinrich, L.: Quellen zur Verfassungsgeschichte (1250-1500), Nr. 4, S.8 ff
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Abhandlung über den Leihezwang im Sachsenspiegel?
Die Abhandlung untersucht die Theorie des Leihezwangs, die besagt, dass deutsche Könige verpflichtet waren, heimgefallene Fahnlehen innerhalb eines Jahres und eines Tages wieder auszugeben. Diese Theorie wurde im 19. Jahrhundert aufgestellt, um die unterschiedliche Entwicklung Deutschlands und Frankreichs zu erklären. In Deutschland, so die Theorie, habe sich kein zusammenhängendes Krongut bilden können, da der Leihezwang die ständige Vergabe von Fahnlehen erzwang und somit die Bildung eines einheitlichen Flächenstaates verhinderte.
Was ist der Sachsenspiegel und welche Bedeutung hat er für die Leihezwang-Theorie?
Der Sachsenspiegel ist ein deutsches Rechtsbuch aus dem 13. Jahrhundert, verfasst von Eike von Repgow. Er enthält Aufzeichnungen geltender ostfälischer Rechtsgewohnheiten. Der Sachsenspiegel wird in der Abhandlung untersucht, da er den Rechtssatz des Leihezwangs erwähnt. Die Abhandlung analysiert, ob Eike von Repgow tatsächlich einen Leihezwang beabsichtigte und ob dieser Rechtssatz Auswirkungen auf die Politik der deutschen Könige hatte.
Was sind Fahnlehen und warum sind sie im Kontext des Leihezwangs relevant?
Fahnlehen waren Lehen, die mit einer Fahne (Banner) als Zeichen der Belehnung vergeben wurden. Sie waren in der Regel mit Amtsaufgaben und Gerichtsbarkeit verbunden. Im Kontext des Leihezwangs sind sie relevant, weil die Theorie besagt, dass Könige verpflichtet waren, diese Fahnlehen innerhalb einer bestimmten Frist wieder auszugeben, was die Anhäufung von Krongut verhindert haben soll.
Wie lautet der Rechtssatz des Leihezwangs im Sachsenspiegel?
Der Rechtssatz lautet im Landrechtsteil: Die keiser l î et alle geistl î che vorstenl ê n mit deme ceptre, al werltl î che vanl ê n l î et her mit vanen. Nich ê n vanl ê n ne m û t her och haben j â r unde tach ledich. Und im Lehnrecht: Iz ne mach och nieman nich ê n gerichte l î en, daz yme gelegen is, iz ne s î eyn sunderlich gerichte, daz in s î n gerichte h ô re, alse gr â veschaph d û t in de marke unde in andere vanl ê n,daz m û t her wol verl î en, unde ne m û t iz s â n mit rechte nicht ledich behalden uber eyn j â r. Also ne m û t die koning nich ê n vanl ê n. Vereinfacht gesagt, bedeutet dies, dass der König heimfallende Fahnlehen innerhalb eines Jahres wieder ausgeben musste.
Was ist die Gelnhauser Urkunde von 1180 und welche Rolle spielt sie in der Leihezwang-Debatte?
Die Gelnhauser Urkunde von 1180 wird in der älteren Forschung als Beweis für den Leihezwang angesehen. Sie dokumentiert die Verteilung von Sachsen nach dem Sturz Heinrichs des Löwen. Mitteis interpretierte die Urkunde als ersten Schritt zur Anerkennung des Leihezwangs. Die Abhandlung argumentiert jedoch, dass die Urkunde eher ein politischer Kompromiss war, der durch die Umstände und das Vor- und Folgegeschehen motiviert war, und nicht ein Ausdruck des Leihezwangs.
Welche Argumente sprechen gegen die praktische Anwendung des Leihezwangs?
Die Abhandlung führt mehrere Argumente gegen die praktische Anwendung des Leihezwangs an:
- Es gab zahlreiche Sonderregelungen (Erblichkeit von Lehen, Agnatenerbrecht, Eventualbelehnung, Expektanz, Gesamtbelehnung), die die Möglichkeit des Heimfalls und damit die freie Verfügung des Königs über Fahnlehen stark begrenzten.
- Es gibt keine Verleihung, die erkennen ließe, dass der König bewusst aus dem im Sachsenspiegel erhobenen Verleiheprinzip gehandelt hätte.
- Die Könige beachteten die Zeitbestimmung von Jahr und Tag oft nicht.
- Maßgebliche Reichsfürsten bestätigten mehrfach die freie Verfügungsgewalt des Königs über heimgefallene Reichslehen.
Was sind die Schlussfolgerungen der Abhandlung bezüglich des Leihezwangs?
Die Abhandlung kommt zu dem Schluss, dass Eike von Repgow zwar von einem Leihezwang ausging, diesen aber unter landrechtlichen und nicht lehnsrechtlichen Aspekten sah. Der Leihezwang war de facto nicht im allgemeinen Bewusstsein vorhanden und gehörte nicht zum Instrumentarium der mittelalterlichen Politik. Die Vergabe von Fahnlehen erfolgte aus anderen Intentionen und nicht aufgrund eines Bewusstseins für ein Leihezwang-Prinzip. Die These, dass der Leihezwang die staatliche Entwicklung Deutschlands maßgeblich beeinflusst hat, wird heute nicht mehr unterstützt.
Welche Faktoren werden heute stattdessen für die unterschiedliche Entwicklung Frankreichs und Deutschlands verantwortlich gemacht?
Für die Entwicklung Deutschlands werden heute vor allem der zahlreich vorhandene Allodialbesitz und die Einrichtung des Wahlkönigtums verantwortlich gemacht. Nach den Staufern konkurrierten Familiensinn und Staatsraison miteinander.
- Quote paper
- Florian Speer (Author), 1993, Von der Theorie des sogenannten "Leihezwangs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96749