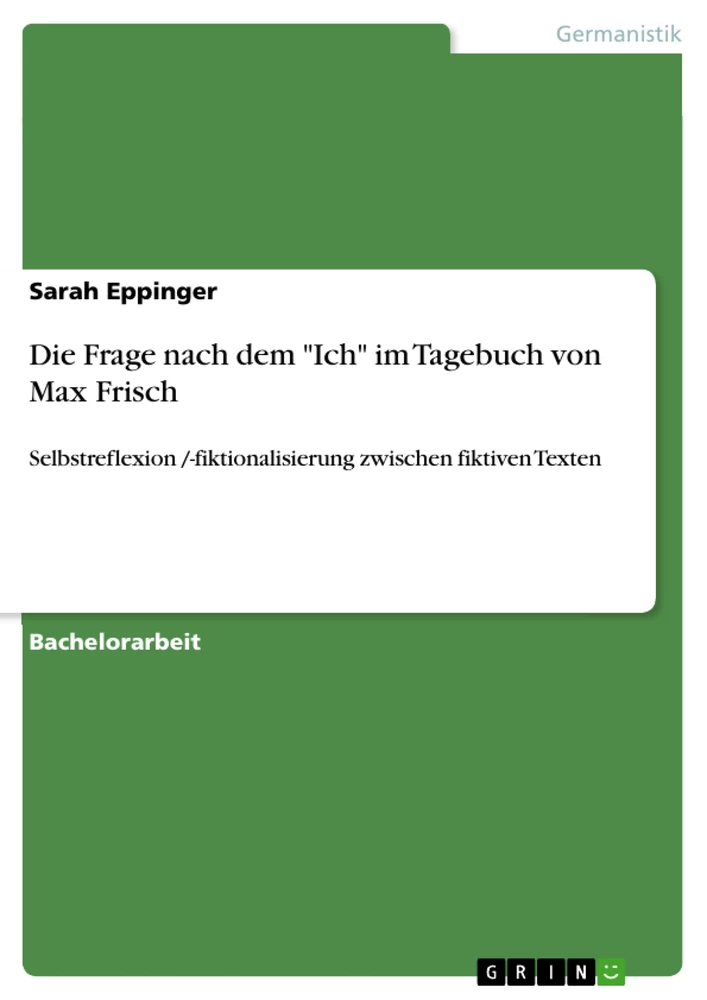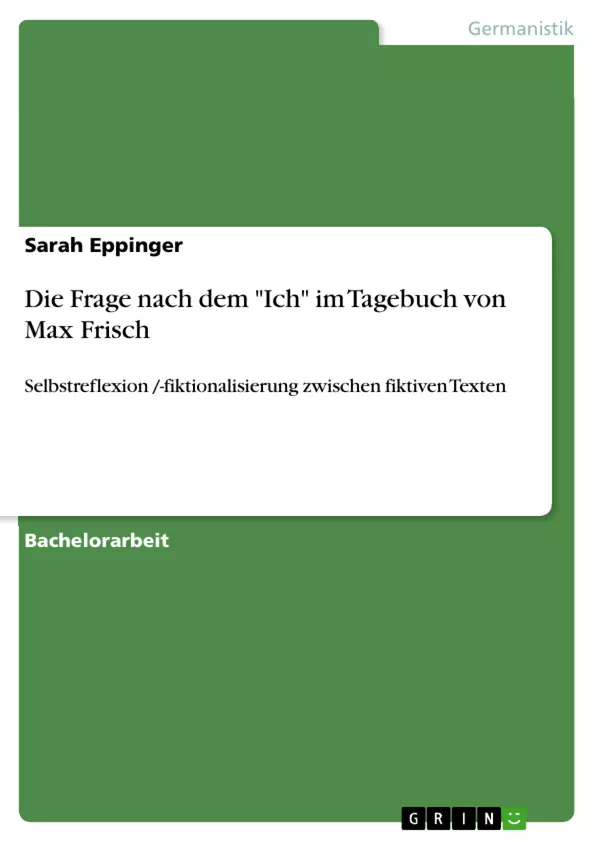Bildet sich das „Ich“ im Laufe des Schreibprozesses erst heraus oder reflektiert es sich bereits selbst im Geschriebenen? Dies soll in der Arbeit am Beispiel des ersten Tagebuchs von Max Frisch, welches in den Jahren 1946 bis 1949 verfasst wurde, untersucht werden.
Innerhalb der Literaturwissenschaft ist dem Tagebuch lange keine Aufmerksamkeit geschenkt worden. Sei es wegen der zunächst oberflächlich anmutenden Banalitäten des Alltags, die im Tagebuch Erwähnung finden oder sei es dem Umstand geschuldet, dass jeder Mensch in der Lage ist, ein solches Buch zu verfassen und der literarische Wert dementsprechend auf den ersten Blick gering sein mag. Jedoch hat sich das Interesse an diesem Alltagsgegenstand im Laufe der Zeit, genauer gesagt im 19. Jahrhundert, geändert: Man erkannte, dass das Tagebuch ganz neue literarische Perspektiven ermöglicht. Durch seine multimedialen Möglichkeiten ist es universell gestaltbar und erlaubt dem Leser eine scheinbare Nähe zum Autor, der sein Innerstes, seine Gedanken, Wünsche und Hoffnungen in diesem Buch festhält. Doch bei näherer Betrachtung muss vorsichtig mit dieser These umgegangen werden, da dies nicht ausnahmslos auf alle Arten von Tagebüchern zutrifft. Eben die bezeichnende Offenheit des Tagebuchs macht es schwer, normative Thesen über diese Art von Literatur aufzustellen. Dazu gehört auch die Frage nach dem Sprecher-Ich.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung des Tagebuch Max Frischs in den Kontext der Tagebuchliteratur
- 2.1 Überblick Tagebuchliteratur
- 2.1.1 Journal intime, Künstlertagebuch oder literarisches Tagebuch?
- 2.1.2 Privates versus öffentliches Tagebuch
- 3. Analyse des Tagebuchs
- 3.1 Einteilungskriterien und grundsätzliche Beobachtungen
- 3.2 Faktische Passagen
- 3.3 Beschreibende Passagen
- 3.4 Schriftsteller Passagen
- 3.5 Reflexive Passagen
- 3.6 Fiktionale Passagen
- 3.7 Mischformen
- 3.8 Auswertung
- 4. Das diaristische „Ich“: Selbstreflexion versus Selbstfiktionalisierung
- 4.1 Fiktion und Reflexion
- 4.1.1 Problematisierung innerhalb der Tagebuchliteratur: Autofiktion
- 4.1.2 Gegenüberstellung im Tagebuch von Max Frisch
- 4.1.3 Die Figur Marion – eine Projektion?
- 5. Fazit
- 6. Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das erste Tagebuch von Max Frisch (1946-1949) mit dem Ziel, das diaristische „Ich“ im Spannungsfeld zwischen Selbstreflexion und Selbstfiktionalisierung zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Formen des Tagebuchs, die von Max Frisch genutzt werden, und geht auf die Problematik der Autofiktion in diesem Kontext ein.
- Einteilung und Klassifizierung des Tagebuchs von Max Frisch im Kontext der Tagebuchliteratur
- Analyse der verschiedenen Passagen im Tagebuch (faktisch, beschreibend, fiktional etc.)
- Die Funktion des fiktionalen Elements im Tagebuch und die Rolle der Figur Marion
- Die Frage nach dem Verhältnis von Selbstreflexion und Selbstfiktionalisierung im Tagebuch
- Die Relevanz des Tagebuchs als Quelle für Max Frischs weiteres literarisches Schaffen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Bedeutung des Tagebuchs in der Literaturwissenschaft. Sie stellt das erste Tagebuch von Max Frisch als Gegenstand der Untersuchung vor und skizziert die Forschungsfragen und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 ordnet das Tagebuch von Max Frisch in den Kontext der Tagebuchliteratur ein. Es wird ein Überblick über die verschiedenen Unterarten des Tagebuchs gegeben und der „Journal intime“, das Künstlertagebuch und das literarische Tagebuch im Detail betrachtet. Kapitel 3 analysiert das Tagebuch anhand verschiedener Kriterien, wie z.B. der Unterscheidung in faktische, beschreibende, fiktionale und reflexive Passagen. Es werden zudem Mischformen und Muster innerhalb des Tagebuchs identifiziert. Kapitel 4 beleuchtet die Frage nach dem diaristischen „Ich“ und untersucht die Spannungen zwischen Selbstreflexion und Selbstfiktionalisierung im Tagebuch. Dabei werden verschiedene Forschungspositionen zur Problematisierung des Tagebuchs hinsichtlich des Sprecher-Ichs aufgezeigt und auf das Tagebuch von Max Frisch übertragen. Besondere Aufmerksamkeit wird der Figur des Puppenspielers Marion geschenkt, der eine wichtige Funktion im ersten Jahr des Tagebuchs einnimmt.
Schlüsselwörter
Tagebuch, Max Frisch, Selbstreflexion, Selbstfiktionalisierung, Autofiktion, Journal intime, Künstlertagebuch, literarisches Tagebuch, Figur Marion, Sprecher-Ich, Analyse, Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Sarah Eppinger (Author), 2019, Die Frage nach dem "Ich" im Tagebuch von Max Frisch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/967936