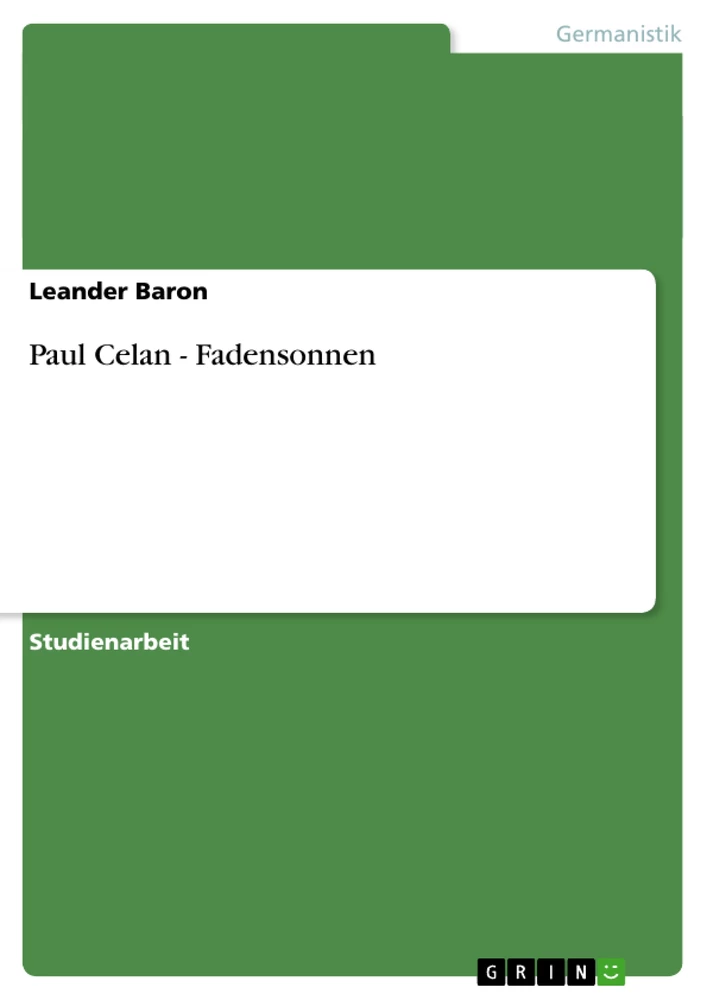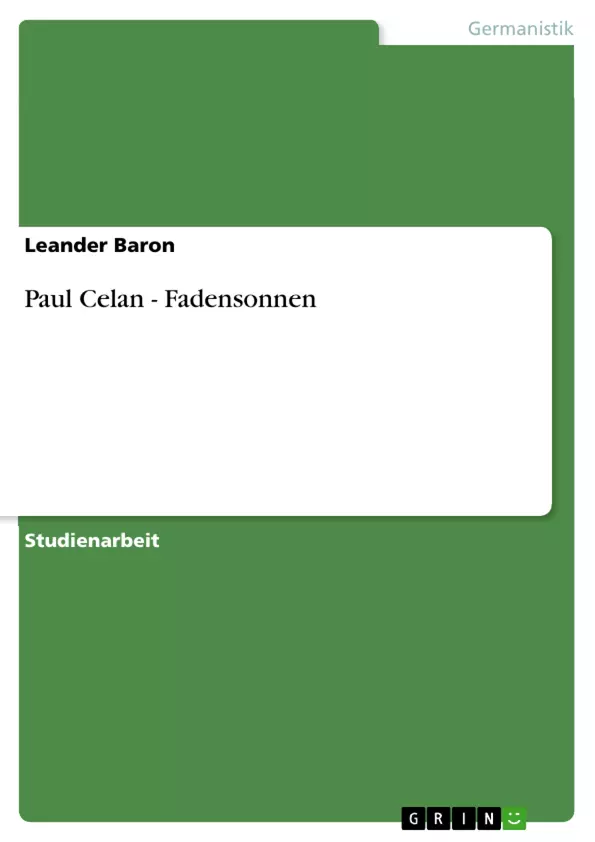Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Hoffnung an einem seidenen Faden hängt, eine Welt, die in grauschwarzer Ödnis versinkt, aber in der ein winziger Lichtstrahl, eine "Fadensonne", die Möglichkeit eines Neubeginns verspricht. Diese tiefgründige Auseinandersetzung mit Paul Celans Gedichtzyklus "FADENSONNEN" entführt Sie in eine Landschaft der Verzweiflung und des stillen Trotzes, wo selbst inmitten der Trostlosigkeit noch Lieder zu singen sind. Entdecken Sie die vielschichtigen Interpretationen von Hans-Georg Gadamer und Otto Pöggeler, die das Werk aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: Gadamer sieht in den "Fadensonnen" eine erhabene, wenn auch ablenkende Schönheit, während Pöggeler in ihnen dunkle Vorboten und den drohenden Schatten des Todes erkennt. Die Analyse der kraftvollen Symbolik von Licht und Finsternis, von Leben und Tod, eröffnet einen neuen Blick auf Celans Werk und dessen Relevanz für unsere Zeit. Ergründen Sie die Bedeutung der "reißenden Fäden", die die Fragilität der Existenz und die Zerrbrechlichkeit der menschlichen Verbindung zur Natur verdeutlichen. Doch inmitten der Dunkelheit keimt eine zarte Hoffnung auf: die Möglichkeit einer besseren Welt, jenseits der gegenwärtigen Misere, in der Töne, Lieder und Licht wieder frei ergriffen werden können. Tauchen Sie ein in diese poetische Reise und lassen Sie sich von der Kraft der Sprache und der Tiefe der menschlichen Erfahrung berühren. Diese Auseinandersetzung ist mehr als nur eine Interpretation; sie ist eine Einladung zur Reflexion über die conditio humana, über die Möglichkeit von Trost und Neubeginn angesichts von Leid und Zerstörung. Schlüsselwörter: Paul Celan, FADENSONNEN, Gedichtinterpretation, Lyrik, Hans-Georg Gadamer, Otto Pöggeler, Nachkriegsliteratur, deutsche Literatur, Symbolik, Licht und Finsternis, Hoffnung, Verzweiflung, Tod, Leben, Interpretation, Analyse, Poesie, Sprachanalyse, Ödnis, Erinnerung, Trauma, Jenseits, Neuanfang, Gedichtzyklus, Literaturwissenschaft, Deutsch. Lassen Sie sich von Celans Worten fesseln und entdecken Sie die verborgenen Schätze in seinen Zeilen, die auch heute noch eine tiefe Resonanz in uns auslösen. Wagen Sie es, in die grauschwarze Ödnis einzutauchen und die "Fadensonnen" der Hoffnung zu suchen.
INHALT
0 Einleitung
1. Belastbare Fäden
1.1 Fadensonnen
1.2 positive Assoziationen
2. Interpretation von Sekundärliteratur
2.1. Hans-Georg Gadamer
2.2. Otto Pöggeler
3. Reißende Fäden
4. Ausblick Rückblick
0. Einleitung
Mit der Lektüre der Zeilen des Gedichts „FADENSONNEN“, dass Paul Celan 1963 schrieb und nach dem er seinen 1968 erschienenen Gedichtzyklus benannte, rückt sehr rasch und eindringlich die Ausstrahlung und Kraft seiner Dichtung in den Blick. Eigene Assoziationen werden durch aussagekräftige Bilder angeregt.
1. Belastbare Fäden
1.1. Fadensonnen
FADENSONNEN
über der grauschwarzen Ödnis. Ein baum-
hoher Gedanke
greift sich den Lichtton: es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.
1.2. Positive Assoziationen
Es geht um Sonne, Sonnen sogar.
Licht, Energie, Wuchs und Leben scheinen gemeint zu sein. Sie wärmt, sie erhellt, wenn auch nur vermittels eines Fadens oder mehrerer Fäden, den oder die sie durch aufreißende schwarze Wolken zu senden vermag. Ein Faden, der vielleicht als Strahlenbündel von kleinstem Lumen mehrere Sonnenfasern vereint, hätte Kraft aufzuweisen. Ein fest gesponnener Faden kann tragendes Teil eines Netzes, oder dichter: eines Gewebes sein. Er verbindet nicht nur, er bindet auch an, vereint.
Der hier nur durch aufgewirbelten also belebten Staub sichtbar werdende Faden, treibt einer Ödnis die Schwärze aus. Sie gibt der Allmacht der Sonne nach und weicht einem weicheren Grau. Noch hält sich das Dunkel hartnäckig, der oder die Fäden sind möglicherweise noch neu und schwach; das transportierte, die Dunkelheit antagonisierende Licht, bereitet sich seinen Weg durch enge Durchlässe zwerchfellartiger Wolken.
Das Licht, das Ton ist, wird berührt. Wieder steht die Aktion im Mittelpunkt. Aktiv wird ein Ton be-griffen, ein Lichtfaden ergriffen. Die Dynamik des Vorgangs wird weiter untermauert durch baumhafte Größe.
In der dritten Zeile des Gedichts ist von einem Baum die Rede. Er ist zwar klein geschrieben, der Baum, er entsteht aus dem deklinierten
Adjektiv „baumhoher“, durch Abtrennung mit Zeilenumbruch des Wortteils -„hoher“, was als Indiz für eine Schwächung des Naturells, der Stärke des Baumes gesehen werden könnte. Möglicherweise aber, sieht man ihn ob der dämmrigen Atmosphäre nur nicht genau. Weil er durch seine sachliche Aussagekraft eine gesamte Zeile des kurzen
Gedichts beherrscht und sie schlicht ausfüllt, könnte man geneigt sein, darauf zu schließen, dass er von Bedeutung ist: der „baum-“ kann doch ein ganzer Baum sein, mit allen baumesgleichen Attributen. So kann er beispielsweise allein stehen, auch in einer ansonsten kompletten „Ödnis“, in der er Überlebender ist, womöglich ohne, dass jemand ihn je noch sehen wollte.
Ein von einem Individuum gedachter Gedanke hat riesenhafte Kraft. Er ist im Stande, den hellen Ton sinnlich wahrzunehmen, der - parallel zum gerade erst sichtbar werdenden Licht - wahrscheinlich noch kaum hörbar ist. Das Individuum bewundert das Naturschauspiel vor Ort, oder es besitzt starke Einbildungskraft, sendet also seinen Gedanken an diesen Ort, der vielleicht real existiert - hat. Vielleicht aber existiert er auch nur in der Phantasie, es käme auf eins. Ob er gar physisch baumhoch reichte, oder von hohem - also gutem - Willen beseelt wäre, ist nicht nachprüfbar, beides ist vorstellbar:
Der aktiv greifende Gedanke selbst in „baumhoher“ Gestalt, oder der passive, gelenkte Gedanke, durch den zugegriffen wird.
Der Lichtton eben, auf den in unterschiedlicher Weise zugegriffen werden mag, ist es scheinbar, der auf ein Ende aller Bestrebungen verweist. Ist er ein Mittel zum Zweck, ist er Schlüssel zum endgültigen Ziel; nur durch ihn kann ergriffen, gesehen und verstanden werden, was erreichbar ist, was noch nicht getan ist. Der folgende Doppelpunkt verdeutlicht mit der ihm eigenen Emphase, dass das Nachfolgende volle Gültigkeit hat und so für sich selbst spricht.
Wieder einen Vers als möglich abschließendes Ganzes wertend, endet dieser fünfte mit dem - so besehen - intransitiv gebrauchten Verb sein, in seiner konjugierten Form „es sind“, was ihm existenziellen Aussagecharakter verleiht. Wer oder was ist?
Dieser nach dem im Nominativ stehenden Subjekt suchenden Frage wird mit den letzten beiden Versen Rechnung getragen.
Die Lieder sind es.
Die jenseits der Menschen noch zu singenden Lieder sind.
Können welche gesungen werden, ist es also noch denkbar, im zeitlichen und räumlichen Jenseits jener zu singen, nach allem, was Menschen getan haben? Oder gibt es schlicht noch ausreichend (unendlich) viele, so dass in Ruhe gesungen werden kann?
Wie es auch sein wird, freilich liegt es Liedern in der Natur, zum Beisammensein oder Mitsingen zu ermuntern. Den Singenden geht es tatsächlich gut, oder sie machen sich Mut.
2. Interpretation von Sekundärliteratur
2.1. Hans-Georg Gadamer
Hans-Georg Gadamer vermittelt dann seine gemischten Gefühle mit der Interpretation des Celanschen Gedichts, wenn er einerseits die Größe und die über allem stehende Macht und Kraft des Lichts sowie die jeden denkbaren Raum sprengende beschriebene Weite lobt, aber einschränkt, dass es sich um eine Ablenkung für den Betrachter handelt, dem das Schauspiel ohnehin nur durch seine Fähigkeit erfahrbar wird, baumhaft riesige Gedanken aufbringen zu können.1
Da, wo er steht und es sieht, gibt es keinen Trost für auf der Erde Geschehenes, er kann nur aufschauen. Gadamer versteht die Fäden zunächst einmal nicht als zu dünn gewordene Sonnenteile, die an eine vergangene bessere Zeit gemahnen. Er sieht die runde Sonne durch die den Himmel verdeckenden Wolken. Die „gewaltigen Räume“ entstehen durch sichtbare Sonnenstrahlen. Sie machen hier die unendliche Weite der Welt für den Betrachter fassbar, lassen begrenzte Räume entstehen. In ihnen kann das spirituell anmutende Naturschauspiel der „Fadensonnen“ stattfinden. Diese Räume haben nach seiner Lesart etwas für einen jeden Erhebendes.
Dem Sinn Suchenden wird bei Gadamer geholfen, die ultimative Aussage des Gedichts wird denn auch mitgeliefert, deren gibt es sogar zwei.
Da in der Menschenlandschaft nichts Erhabenes mehr sichtbar sei, richte man den Blick nach oben und erfahre die sich durch das Himmelsschauspiel eröffnenden Räume, die gleichwohl die Trostlosigkeit vergessen machten. Des Weiteren werden die letzten zweieinhalb Verse als abrundende Quintessenz vorgestellt: „Es sind noch Lieder zu singen jenseits der Menschen.“
2.2. Otto Pöggeler
Otto Pöggeler beschreibt uns Paul Celans Gedicht unter Zuhilfenahme der Erich Fried Interpretation von 1972, in der analysiert wird, wie aus den „Lieder[n]“, die „jenseits der Menschen“ „noch [...] zu singen“ seien, Celans Freitod im Jahre 1972 herauslesbar sei.2
Pöggeler sieht dunkle Gestalten, Erscheinungen. Seine Wolkengebirge, die - wohl nach einem Gewitter - die Sonne verstecken, wirken so bedrohlich wie die in anonyme Fäden zersplitterte Sonne verloren. Die „,grauschwarze Ödnis‘“, die, so Pöggeler, Celan von seiner Übersetzung des Gedichts Die Zwölf von Alexander Block ableite, in der von Öde und Ödigkeit die Rede sei, und die praktisch als Oberbegriff „alles Öde“ zusammenfasse, sei alles, was verbleibe. Allerdings könne sich aus ihr noch der menschliche Gedanke erheben, er übersteige alles und müsse so den Denkenden von allen Menschen unterscheiden.
Weiter wird hier der „Lichtton“ , der durch Wolken geprägt ist, mit einer „anklingen[den] Grundgestimmtheit“ zusammen als eins begriffen, die ,baumhohen Gedanken‘, wenn sie gedacht werden, können zu Lieder werden, die noch zu singen sind.
3. Reißende Fäden
So fest ein Faden sein kann, so viel er verbinden mag, so leicht kann er wohl zerreißen. Symbolisch für die Angebundenheit der Erde an die Sonne sowie die Abhängigkeit von ihr, von physikalischer Energie für Leben und Weiterentwicklung, können die Fäden, die bildlich die Erde an die Sonne zu binden suchen, womöglich die Last nicht halten. Die grauschwarze Ödnis Erde hängt quasi am seidenen Faden, wenn überhaupt noch, die Lebenskraft kommt nicht an.
Die Fäden brächten vielleicht das Licht.
Von einem anderen Standpunkt aus gesehen sind sie aber nur noch schwach, welk und blass und „ faden “ (vgl. engl.: to fade). Was gibt es ohne Energie dieser „grauschwarzen Ödnis“ dann noch abzugewinnen. Ödes Grauschwarz, grauschwarze Öde, in Ermangelung eines Besseren bedingt und verbrüdert man sich gegenseitig zum unauflösbaren fatalistischen Bund.
Wenn es noch möglich ist, den Lebensboten in Form von Licht in warmem Ton zu erreichen, dann bedarf es dazu übernatürlicher Kraft.
Scheinbar wird sie ja aufgebracht, die verwendete sachliche Aussageform lässt keinen Zweifel zu.
Der zur bis ins Unermessliche gesteigerten Einbildungskraft fähige Denkende gestattet seiner Phantasie Höhenflüge ohne Aussicht auf Belohnung. Denn was kann ihn denn dort oben in luftigen Baumeshöhen erwarten, den Denkenden und seinen Gedanken. Ein Lichtton, der es schaffte, die Schwärze der Welt in modriges Grau zu verwandeln, ist er es wert, ist er überhaupt noch zu fassen, oder ist er viel eher längst verloschen beziehungsweise verklungen, falls er jemals zu sehen oder zu hören war. War denn jemand da, der hätte sehen oder hören können.
Dennoch wird zugegriffen.
Nichts erwartet den Zugreifenden.
4. Ausblick Rückblick
Lieder sind zu singen, gewiss. Aber nicht mehr dort. Es hat sich ausgesungen, dort lebt nichts mehr.
Ein an Vergangenes mahnender oder am Ende sentimentaler Gedanke mag sich noch hin und wieder hierher verirren, finden wird er nichts als Schwärze, erahnte Gräue.
Was hier geschehen ist wird hoffentlich nicht mehr besungen, wenn so das Resultat aussieht. Es darf auch nicht gesungen werden, um davon abzulenken, was geschehen ist, das Geschehene bleibt eingemeißelt und das hat Vor- und Nachteile.
Es darf ja nicht vergessen werden, damit man vor Wiederholungsfehlern gefeit sei, es brennt aber auch für alle Zeiten immer neue Narben ein, lässt die Wunden der Opfer, die solch eine Weltvernichtung mit sich bringen muss, nie heilen.
Gesungen werden soll woanders.
Im Jenseits von dort - in einer besseren Welt, wo Töne, Lieder und Licht von Anwesenden ergriffen werden können.
[...]
1 aus: Hans-Georg Gadamer Wer bin Ich und wer bist Du? Kommentar zu Celans >Atemkristall< Bibliothek Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1986
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Gedichts „FADENSONNEN“ von Paul Celan?
Das Gedicht „FADENSONNEN“ beschreibt eine grauschwarze Ödnis, über der Fadensonnen stehen. Ein baumhoher Gedanke greift sich den Lichtton, was darauf hindeutet, dass es noch Lieder jenseits der Menschen zu singen gibt.
Welche positiven Assoziationen werden mit den Fadensonnen verbunden?
Die Fadensonnen werden mit Sonne, Licht, Energie, Wuchs und Leben assoziiert. Sie spenden Wärme und Helligkeit, selbst wenn sie nur durch Fäden durch die dunklen Wolken scheinen. Ein Faden, der Licht transportiert, kann die Schwärze der Ödnis vertreiben.
Wie interpretiert Hans-Georg Gadamer das Gedicht von Celan?
Gadamer lobt die Größe und Kraft des Lichts sowie die Weite des Raums, sieht dies jedoch auch als Ablenkung, die nur durch die Fähigkeit des Betrachters erfahrbar wird, baumhaft riesige Gedanken aufzubringen. Er betont die Räume, die durch die sichtbaren Sonnenstrahlen entstehen, und die tröstende Wirkung des Himmels Schauspiels.
Wie interpretiert Otto Pöggeler das Gedicht von Celan?
Pöggeler bezieht sich auf Erich Frieds Interpretation und sieht dunkle Gestalten und Erscheinungen. Er verbindet die „grauschwarze Ödnis“ mit Celans Übersetzung von Alexander Blocks Gedicht *Die Zwölf* und deutet den Freitod Celans hinein. Er sieht den menschlichen Gedanken, der sich aus der Ödnis erhebt und die Möglichkeit, dass baumhohe Gedanken zu Liedern werden können, die noch zu singen sind.
Was bedeutet der Begriff "Reißende Fäden" im Kontext der Analyse?
Der Begriff symbolisiert die Zerbrechlichkeit der Verbindung zwischen Erde und Sonne und die Abhängigkeit der Erde von Energie für Leben. Die Fäden, die die Erde an die Sonne binden, können die Last nicht halten, was zu einer grauschwarzen Ödnis führt, in der die Lebenskraft fehlt. Es wird auch auf die Vergänglichkeit und das "Verblassen" (engl. "to fade") hingewiesen.
Welche Perspektiven werden im Ausblick Rückblick präsentiert?
Es wird betont, dass es dort, wo Schwärze herrscht, nichts mehr zu singen gibt. Es gibt eine Mahnung an die Vergangenheit und die Gefahr des Vergessens, aber auch die Notwendigkeit, nicht von dem Geschehenen abzulenken. Gesungen werden soll woanders, in einer besseren Welt, wo Töne, Lieder und Licht ergriffen werden können.
Welche Sekundärliteratur wird im Text zitiert?
Es werden zitiert: Hans-Georg Gadamer, *Wer bin Ich und wer bist Du? Kommentar zu Celans >Atemkristall<* (1986) und Otto Pöggeler, *Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans.* (1986).
- Quote paper
- Leander Baron (Author), 2000, Paul Celan - Fadensonnen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/96794