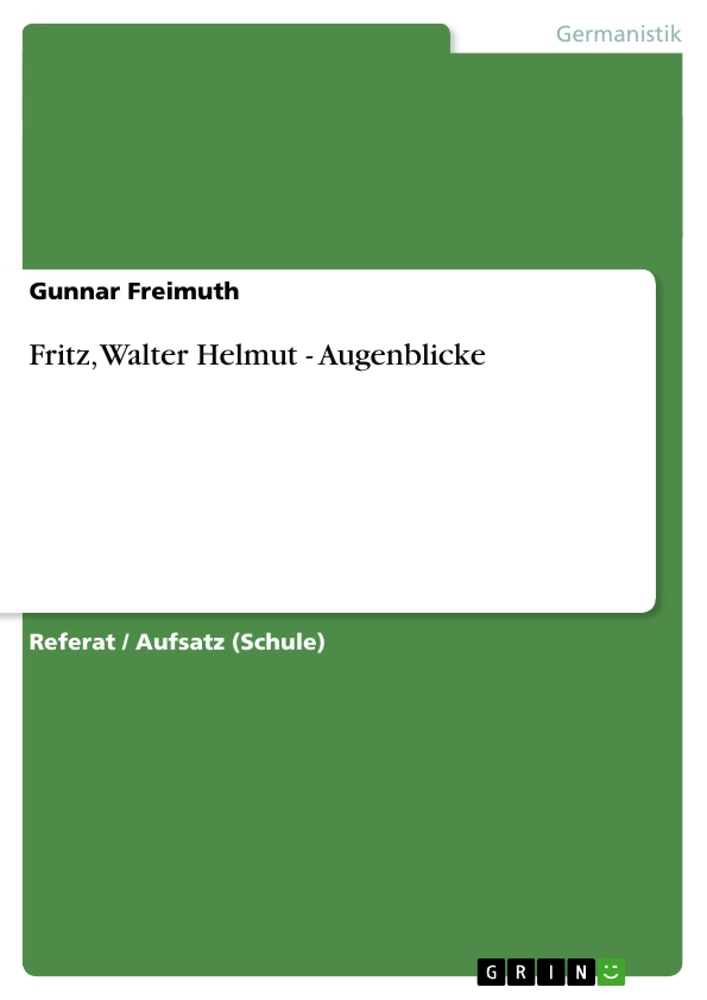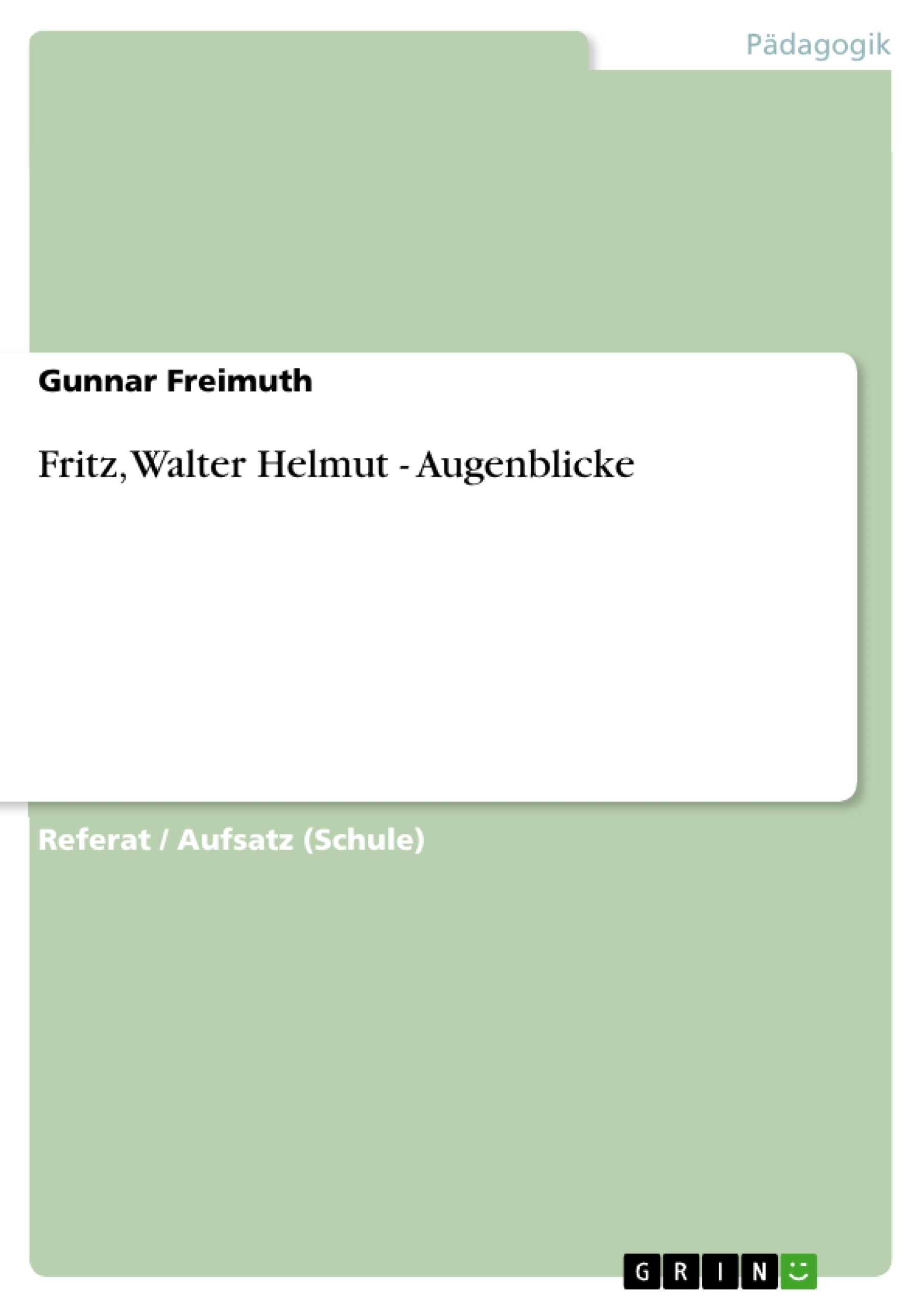Augenblicke
Im Jahre 1964 verfaßte der deutsche Schriftsteller Walter Helmut Fritz die Kurzgeschichte „Augenblicke“. Es wird ein sehr gespanntes Verhältnis zwischen einer Mutter und ihrer Tochter erzählt.
Eines Tages schminkte sich Elsa im Badezimmer, als plötzlich ihre Mutter hineinkam. Angeblich wollte sie sich die Hände waschen und Elsa überkam wieder einmal ein Gefühl von Unsicherheit und nahezu panischer Angst. Als ob sie es schon gewußt hatte, daß ihre Mutter unter diesem Vorwand hineinkäme, stürmte Elsa aus dem Bad über den Flur in ihr Zimmer. Nach einer Weile nachdenklicher Minuten und einem nochmaligen kurzen Gespräch mit ihrer Mutter verließ Elsa die kleine Wohnung und fuhr mit der Straßenbahn in Richtung Innenstadt. In der Nähe der Post sollte es eine Wohnungsvermittlung geben. Elsa trug sich mit dem Gedanken, die Mutter zu verlassen und sich eine eigene Wohnung zu suchen. Dies jedoch gelang ihr nicht, da sie keine Adresse bei sich hatte und in der Eile vergessen hatte sie sich aus dem Telefonbuch zu suchen. Nach einigem Herumfragen gab sie die Suche letztendlich auf. Geplagt von den Gedanken an ihre Mutter („...daß ihre Mutter alt und oft krank war...“) beschloß sie noch einen Spaziergang durch die Stadt zu machen. Zu den Menschen, am denen sie an den zahlreichen Geschäften vorbei ging spürte sie eine gewisse Zuneigung. Nach stundenlangem Schlendern durch die Straßen und vielen Gedanken über ihre Mutter fuhr Elsa kurz vor Mitternacht wieder nach Hause. „Sie kauerte sich in ihren Sessel, und hätte unartikuliert schreien mögen, in die Nacht mit ihrer entsetzlichen Gelassenheit“. Mit diesem emotionalen Gefühlsausbruch Elsas klingt die Erzählung aus.
Elsa ist die eigentliche Hauptperson in der Kurzgeschichte und nimmt die Rolle einer Tochter ein, die sich von ihrer Mutter in ihrem Leben stark eingeengt und benachteiligt fühlt. Sie will um jeden Preis die Wohnung ihrer Mutter verlassen und ihr eigenes Leben führen, indem sie selbst über das bestimmen kann was sie zu tun und zu lassen hat. Sie will ein Leben führen. Nach Außen, ihrer Mutter gegenüber zeigt sie diese Abneigung und Einsamkeit nicht sie will sie ihr direkt auch nicht sagen, um sie nicht dermaßen seelisch zu verletzen. Mit vielen Adjektiven beschreibt der Autor die charakteristischen Eigenschaften Elsas und ihre Gefühlswelt in einigen Situationen („...- behext, entsetzt, gepeinigt...“). Im Gegensatz zur Tochter hat die Mutter ganz andere Charaktereigenschaften. Sie wirkt in der gesamten Handlung sehr ruhig und gelassen. Sie will eigentlich immer nur das Beste für ihre Tochter tut dies aber wahrscheinlich auf sehr penetrante Art und Weise. Sie wirkt sehr aufdringlich und störend und macht sich wahrscheinlich so selber ganz besonders unbeliebt bei Elsa. Wie schon bei Elsa, beschreibt er Autor erst im späterem Verlauf des Geschehens direkt charakteristische Eigenschaften der Mutter. Nach und nach erfährt der Leser etwas über die Mutter selbst und ihr vergangenes Leben („...Ihre Mutter lebte seit dem Tod ihres Mannes allein...“). Erst nach diesen Informationen kann der Leser sich nach und nach denken warum die Mutter Elsa gegenüber oft so reagiert. Der Leser sollte sich wahrscheinlich erst einmal in das Geschehen hineinversetzen, ohne gleich am Beginn der Erzählung mit Stärken und Schwächen er einzelnen Personen konfrontiert zu werden.