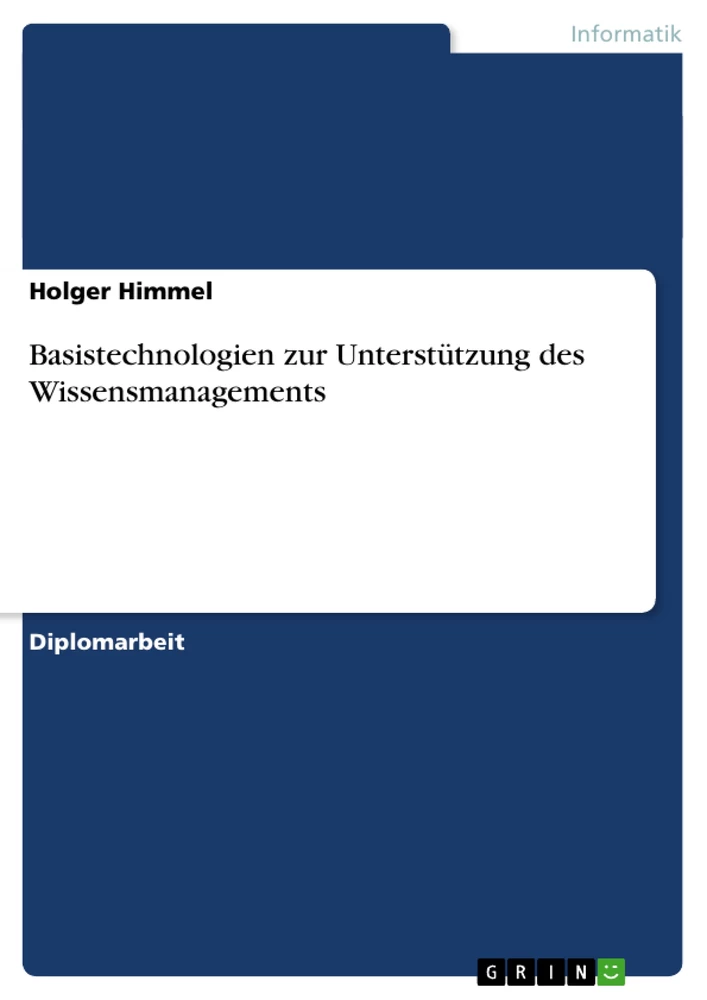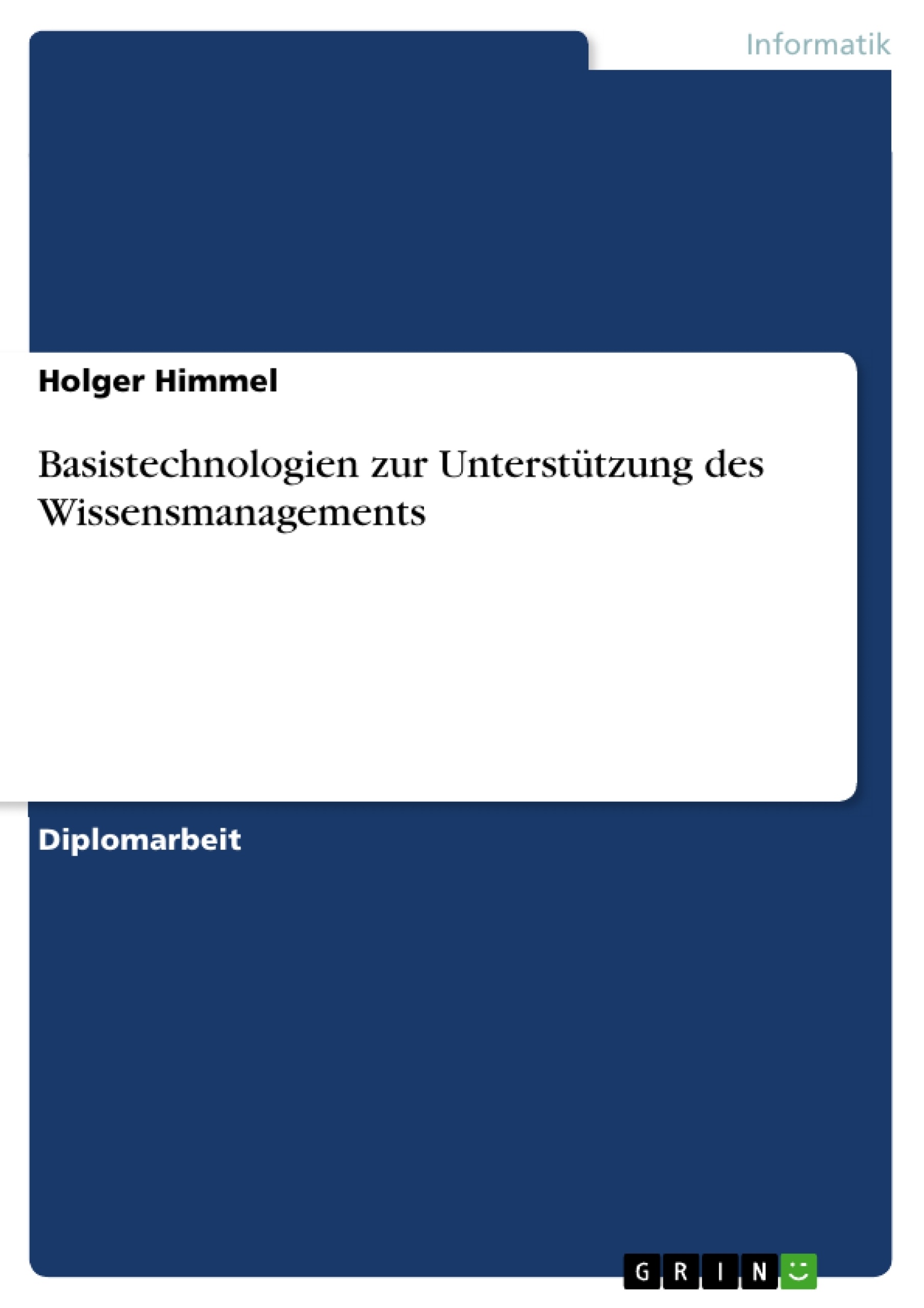Die vorliegende Arbeit stellt einleitend das Thema Wissensmanagement dar. Insbesondere werden in diesem – ersten – Teil der Arbeit die Begriffe Daten, Information und Wissen voneinander abgegrenzt, was vor dem Hintergrund einer techniklastigen Betrachtung des Themas Wissensmanagement dringend erforderlich scheint. In diesem Zusammenhang muss geklärt werden, ob Wissen einer EDV-technischen Verarbeitung zugeführt werden kann. Im Vordergrund stehen hier Fragestellungen wie: Ist Wissen speicherbar? Ist Wissen übertragbar?
Anschließend wird mit dem Phasenmodell des Wissensmanagement nach Probst exemplarisch ein Modell herausgegriffen und ausführlich dargestellt. Probst bezeichnet sein Modell als „Bausteine des Wissensmanagement“ und sieht es als Vorschlag an die Praxis, das Thema Wissensmanagement im Unternehmen aufzugreifen.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt anschließend in der Untersuchung verschiedener Technologien hinsichtlich ihrer Eignung ein Wissensmanagement, wie es Probst darstellt, zu unterstützen. Untersuchte Technologien in diesem Zusammenhang sind Internet/Intranet, Data Warehouse, Dokumentenmanagement-Systeme, CSCW und Groupware-Systeme und Workflowmanagement-Systeme. Jede Technologie wird jeweils dargestellt und anschließend wird der Versuch unternommen, sie den Bausteinen des Wissensmanagements zuzuordnen.
Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass einige Technologien nicht immer klar voneinander abzugrenzen sind und teilweise ineinander übergehen, was eine klare Betrachtung einzelner technologischer Ansätze bzw. Systeme erschwert. Ziel der Arbeit ist es, dennoch eine Zuordnung Technologie – Wissensmanagement- Bausteine zu finden.
Zum Abschluß soll mit Lotus Notes exemplarisch eine Softwarelösung herausgegriffen werden, in der mehrere der betrachteten Technologien zu einem Gesamtsystem vereint sind und das in der Praxis häufig in Bezug zu einer technikorientierten Wissensmanagement-Unterstützung eingeführt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen des Wissensmanagements
- 2.1 Wissen
- 2.2 Wissensarten
- 2.2.1 Implizites und explizites Wissen
- 2.2.2 Individuelles und kollektives Wissen
- 2.3 Wissen als Produktions- und Wettbewerbsfaktor
- 2.4 Wissensmanagement
- 2.4.1 Entstehung
- 2.4.2 Begriffsdefinition
- 2.4.3 Wissensmanagement versus Informationsmanagement
- 2.4.4 Ziele eines Wissensmanagement
- 2.5 Ansätze des Wissensmanagements
- 2.5.1 Humanorientierter Ansatz des Wissensmanagements
- 2.5.2 Technologischer Ansatz des Wissensmanagements
- 2.5.3 Integrativer Ansatz eines Wissensmanagements
- 3 Phasenmodell des Wissensmanagements nach Probst
- 3.1 Wissensziele
- 3.1.1 Normative Wissensziele
- 3.1.2 Strategische Wissensziele
- 3.1.3 Operative Wissensziele
- 3.2 Wissensidentifikation
- 3.3 Wissenserwerb
- 3.4 Wissensentwicklung
- 3.5 Wissens(ver)teilung
- 3.6 Wissensnutzung
- 3.7 Wissensbewahrung
- 3.8 Wissensbewertung
- 3.1 Wissensziele
- 4 Technologische Unterstützung des Wissensmanagements
- 4.1 Internet und Intranet
- 4.1.1 Grundlagen
- 4.1.1.1 Entwicklung
- 4.1.1.2 Kommunikationsprotokoll TCP/IP
- 4.1.1.3 DNS und Rechnernamen
- 4.1.2 Abgrenzung Internet und Intranet
- 4.1.3 Dienste
- 4.1.3.1 Electronic Mail
- 4.1.3.2 World Wide Web
- 4.1.3.3 Newsgroups
- 4.1.3.4 File Transfer Protocol
- 4.1.4 Informationsrecherche im Internet
- 4.1.5 Wissensmanagement-Unterstützung
- 4.1.1 Grundlagen
- 4.2 Data Warehouse
- 4.2.1 Begriff
- 4.2.2 Architektur eines Data Warehouses
- 4.2.2.1 Datenschnittstelle und Transformationsprogramme
- 4.2.2.2 Datenbank, Metadaten und Archivierungssysteme
- 4.2.2.3 Benutzerschnittstelle
- 4.2.2.3.1 Data Access
- 4.2.2.3.2 Online Analytical Processing
- 4.2.2.3.3 Data Mining
- 4.2.3 Organisationsformen
- 4.2.4 Web Warehousing
- 4.2.5 Wissensmanagement-Unterstützung
- 4.3 Dokumentenmanagement-Systeme
- 4.3.1 Grundlagen
- 4.3.2 Dokumentenerfassung und -erstellung
- 4.3.3 Organisation und Speicherung
- 4.3.3.1 Komprimierung
- 4.3.3.2 Attributierung
- 4.3.3.3 Speicherung
- 4.3.4 Retrieval und Bereitstellung
- 4.3.5 Ausgabe
- 4.3.6 Dokumentenverwaltung
- 4.3.7 Wissensmanagement-Unterstützung
- 4.4 CSCW und Groupware-Systeme
- 4.4.1 Grundlagen
- 4.4.2 Systemklasse Kommunikation
- 4.4.2.1 E-Mail-Syteme
- 4.4.2.2 Konferenz-Systeme
- 4.4.3 Systemklasse gemeinsame Informationsräume
- 4.4.3.1 Bulletin-Board-Systeme
- 4.4.3.2 Verteilte Hypertext-Systeme
- 4.4.3.3 Verteilte Datenbanken
- 4.4.4 Systemklasse Workflow Management
- 4.4.5 Systemklasse Workgroup Computing
- 4.4.5.1 Planungssysteme
- 4.4.5.2 Gruppeneditoren
- 4.4.5.3 Entscheidungs- und Sitzungsunterstützungssysteme
- 4.4.6 Wissensmanagement-Unterstützung
- 4.5 Workflowmanagementsysteme
- 4.5.1 Workflow
- 4.5.2 Organisationsmodellierung
- 4.5.3 Definition von Vorgangstypen
- 4.5.4 Ausführung der Vorgänge
- 4.5.5 Ausführung einer Aktivität
- 4.5.6 Vorgangsmanagement
- 4.5.7 Architekturkonzept der Workflow-Management-Coalition
- 4.5.7.1 Workflow Enactment Service
- 4.5.7.2 Process Definition Tools
- 4.5.7.3 Workflow Client Applications
- 4.5.7.4 Invoked Applications
- 4.5.8 Wissensmanagement-Unterstützung
- 4.1 Internet und Intranet
- 5 Lotus Notes als Werkzeug für ein Wissensmanagement
- 5.1 Grundlagen von Lotus Notes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Basistechnologien zur Unterstützung von Wissensmanagement. Ziel ist die Zuordnung verschiedener Technologien zu den Bausteinen eines Wissensmanagement-Modells nach Probst. Die Arbeit analysiert die Eignung von Technologien wie Internet/Intranet, Data Warehouses, Dokumentenmanagement-Systemen, CSCW/Groupware und Workflowmanagementsystemen.
- Abgrenzung der Begriffe Daten, Information und Wissen
- Darstellung und Analyse des Phasenmodells des Wissensmanagements nach Probst
- Untersuchung der Eignung verschiedener Technologien zur Wissensmanagement-Unterstützung
- Zuordnung der Technologien zu den Bausteinen des Probst-Modells
- Beispielhafte Betrachtung von Lotus Notes als integrierte Softwarelösung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Wissensmanagement ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie benennt die zu untersuchenden Technologien und das zugrundeliegende Phasenmodell nach Probst. Die Einleitung dient als Orientierungshilfe für den Leser und umreißt den Fokus der folgenden Kapitel.
2 Grundlagen des Wissensmanagements: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Technologieanalyse. Es differenziert zwischen Daten, Information und Wissen und beleuchtet verschiedene Wissensarten (implizit/explizit, individuell/kollektiv). Es beschreibt Wissen als Produktions- und Wettbewerbsfaktor und definiert Wissensmanagement, unterscheidet es von Informationsmanagement und erläutert verschiedene Ansätze (humanorientiert, technologisch, integrativ). Diese fundierte Basis ist essentiell für das Verständnis der darauf folgenden Kapitel zur technologischen Unterstützung.
3 Phasenmodell des Wissensmanagements nach Probst: Dieses Kapitel beschreibt ausführlich das Phasenmodell des Wissensmanagements von Probst. Es zerlegt das Modell in seine einzelnen Bausteine: Wissensziele (normativ, strategisch, operativ), Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissensverteilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung und Wissensbewertung. Die detaillierte Darstellung dieses Modells bildet die Grundlage für die anschließende Zuordnung der Technologien.
4 Technologische Unterstützung des Wissensmanagements: Dieser zentrale Abschnitt untersucht verschiedene Technologien hinsichtlich ihrer Eignung zur Unterstützung des in Kapitel 3 beschriebenen Wissensmanagement-Modells. Jede Technologie (Internet/Intranet, Data Warehouse, Dokumentenmanagement-Systeme, CSCW/Groupware und Workflowmanagementsysteme) wird einzeln dargestellt und anschließend ihre Rolle im Gesamtkontext des Wissensmanagements eingeordnet. Die Kapitel betonen die Überlappungen und Interdependenzen zwischen den Technologien und versuchen trotzdem eine eindeutige Zuordnung zu den einzelnen Phasen des Probst-Modells.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Daten, Information, Wissen, explizites Wissen, implizites Wissen, Phasenmodell, Probst, Technologie, Internet, Intranet, Data Warehouse, Dokumentenmanagement, CSCW, Groupware, Workflowmanagement, Lotus Notes, Wissensziele, Wissenserwerb, Wissensverteilung, Wissensnutzung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Technologien zur Unterstützung von Wissensmanagement
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht verschiedene Basistechnologien, die das Wissensmanagement unterstützen. Im Mittelpunkt steht die Zuordnung dieser Technologien zu den Bausteinen eines Wissensmanagement-Modells nach Probst. Analysiert werden die Eignung von Internet/Intranet, Data Warehouses, Dokumentenmanagement-Systemen, CSCW/Groupware und Workflowmanagementsystemen. Zusätzlich wird Lotus Notes als Beispiel einer integrierten Softwarelösung betrachtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Abgrenzung der Begriffe Daten, Information und Wissen; Darstellung und Analyse des Phasenmodells des Wissensmanagements nach Probst; Untersuchung der Eignung verschiedener Technologien zur Wissensmanagement-Unterstützung; Zuordnung der Technologien zu den Bausteinen des Probst-Modells; und eine beispielhafte Betrachtung von Lotus Notes.
Welches Wissensmanagement-Modell wird verwendet?
Die Arbeit basiert auf dem Phasenmodell des Wissensmanagements nach Probst. Dieses Modell wird detailliert beschrieben und in seine einzelnen Bausteine zerlegt: Wissensziele (normativ, strategisch, operativ), Wissensidentifikation, Wissenserwerb, Wissensentwicklung, Wissensverteilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung und Wissensbewertung. Diese Bausteine dienen als Grundlage für die Zuordnung der untersuchten Technologien.
Welche Technologien werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die folgenden Technologien im Hinblick auf ihre Eignung zur Unterstützung von Wissensmanagement: Internet/Intranet, Data Warehouses, Dokumentenmanagement-Systeme, CSCW/Groupware und Workflowmanagementsysteme. Für jede Technologie wird deren Funktionsweise erläutert und ihre Rolle im Kontext des Probst-Modells eingeordnet.
Wie werden die Technologien zugeordnet?
Die Zuordnung der Technologien zu den Bausteinen des Probst-Modells erfolgt durch Analyse der jeweiligen Funktionen und Möglichkeiten der Technologien. Die Arbeit hebt dabei die Überlappungen und Interdependenzen zwischen den Technologien hervor, um eine möglichst präzise Zuordnung zu ermöglichen.
Welche Rolle spielt Lotus Notes in der Arbeit?
Lotus Notes wird als Beispiel für eine integrierte Softwarelösung betrachtet, die verschiedene Funktionen zur Unterstützung des Wissensmanagements vereint. Die Analyse von Lotus Notes dient dazu, die praktische Anwendung der im theoretischen Teil vorgestellten Konzepte zu veranschaulichen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Wissensmanagement, Daten, Information, Wissen, explizites Wissen, implizites Wissen, Phasenmodell, Probst, Technologie, Internet, Intranet, Data Warehouse, Dokumentenmanagement, CSCW, Groupware, Workflowmanagement, Lotus Notes, Wissensziele, Wissenserwerb, Wissensverteilung, Wissensnutzung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen des Wissensmanagements, Phasenmodell des Wissensmanagements nach Probst, Technologische Unterstützung des Wissensmanagements und Lotus Notes als Werkzeug für ein Wissensmanagement. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zur umfassenden Analyse der Thematik bei.
- Quote paper
- Holger Himmel (Author), 2001, Basistechnologien zur Unterstützung des Wissensmanagements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9702