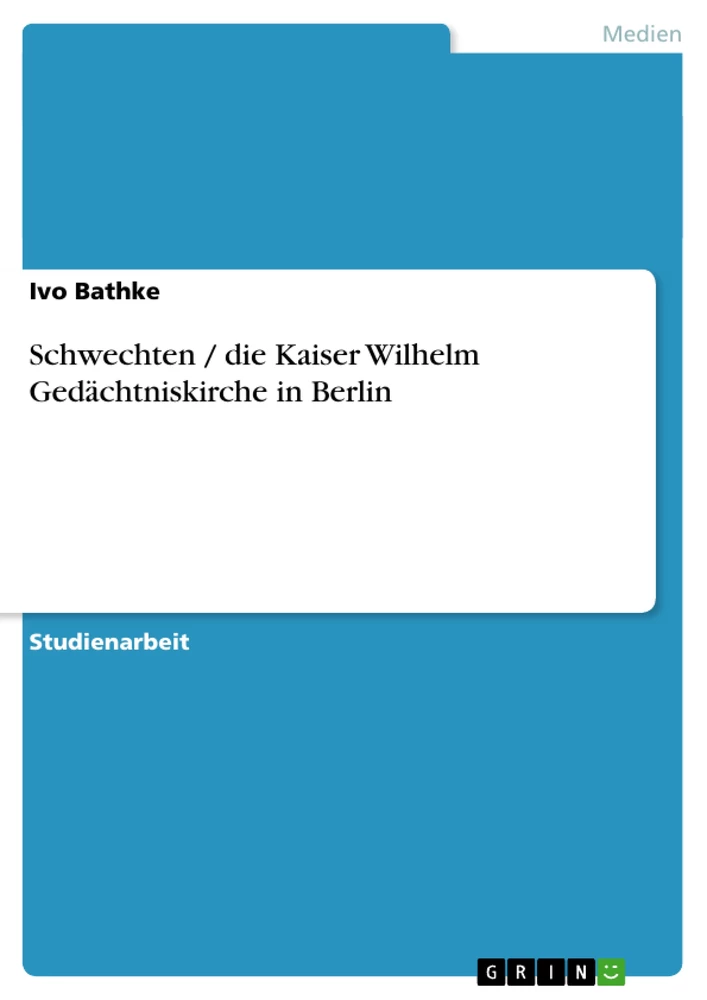Inhalt:
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1.Biographie des Architekten
2.2 Baubeschreibung
2.2.1. Grundriß
2.2.2. Außenbau
2.2.3. Innenräume
2.2.4. Vorbilder
2.3. Städtebauliche Situation
2.4. Kontext und Bedeutung
2.5. Die Kirche heute
3. Fazit
4. Literaturliste
1.Einführung
Anläßlich des Proseminars „Architekten des Historismus“ werde ich im folgenden Text die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche von 1890 in Berlin und den verantwortlichen Architekten Franz Heinrich Schwechten vorstellen und untersuchen. Dabei ist zu beachten ,daß die Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche eine besondere Rolle einnimmt , da sie so ,wie ich sie beschreiben werde, gar nicht mehr existiert, denn sie wurde im 2. Weltkrieg zerstört. Von daher verzeihe man mir den Gebrauch des Präsens bei der Baubeschreibung.
Ansonsten werde ich so vorgehen , wie es üblich ist bei Architekturuntersuchungen: Zunächst einmal werde ich den Architekten vorstellen, dann den Bau und die städtebauliche Situation beschreiben und abschließend den historischen Kontext sowie die Bedeutung erläutern. Auch den Bezug zur Gegenwart werde ich wieder herstellen und die Geschichte des Wiederaufbaues und die heutige Situation erwähnen.
Das Fazit ist natürlich das allwissende Schlußlicht , in dem ich die wichtigsten Erkenntnisse über diesen Bau noch einmal herausstellen werde.
2.Hauptteil
2.1.Biographie des Architekten
Franz Heinrich Schwechten wurde am 12.8.1841 in Köln geboren, wo er auch aufwuchs, zur Schule ging und bis zu seinem Studienbeginn lebte und lernte. Da Köln eine der Hochburgen der Romanik war und ist , ist der Geburtsort und die Herkunft für das Leben und Schaffen Schwechtens von prägender Bedeutung. Nicht nur, daß er die romanische Formensprache der vielen Kirchen Kölns als Heranwachsender passiv aufnahm, er beschäftigte sich auch aktiv und unter fachlicher Aufsicht mit der Architektur der romanischen Epoche. So arbeitete er vor seinem Studium bei Renovierungsarbeiten an romanischen Kirchen in Köln und Umgebung mit und lernte so erste Details der Romanik kennen.
1861 wurde er dann Schüler der Berliner Bauakademie und lernte bei Bötticher, Spielberg und besonders bei Adler1. Während der folgenden Jahre erweiterte er sein Spektrum und sein Repertoire an architektonischen Stilmitteln und Methoden und studierte äußerst erfolgreich. So ging er dann 1868/69 mit dem Schinkelpreis auf Studienreise nach Italien ,um nach seiner Wiederkehr und seinem Studienabschluß 1869 freier Privatarchitekt zu werden. 1875/80 baute er dann den Anhalter Bahnhof in Berlin, einen sehr technoiden und für die Zeit sehr futuristischen Bau , was ihm den Respekt seiner Zunftgenossen einbrachte und bewies ,daß er nicht nur reaktionäre Bauten entwerfen konnte. Doch dazu später mehr .
Schwechtens Kariere verlief weiterhin sehr gut und etliche Auszeichnungen, Aufnahmen bei wichtigen Institutionen und natürlich auch sehr viele Bauten zeugen davon.2
Abschließend kann man sagen , daß Schwechten ein bedeutender und berühmter Architekt seiner Zeit war und mit der Zeit zum „Hofarchitekten“ von Kaiser Wilhelm II. avancierte und sich nach seinen Vorstellungen richten mußte . Das heißt das er seine Entwürfe in einer reaktionären und regressiven Manier planen mußte, was seinem Ruf unter Kollegen zwangsweise schadete, seiner Stellung und seiner Auftragslage hingegen nur nützten.
2.2. Baubeschreibung
2.2.1.Grundriß:
Der Grundriß des fünftürmigen Baus der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist in der Form eines gedrungenen Kreuzes angelegt, in dem sich die einzelnen Komponenten der Kirche folgendermaßen verteilen: Das Langhaus ,Herzstück fast jeder Kirche, ist auch hier zentral gehalten und mündet im Osten in den polygonalen Chor. Dieser ist von einer Art Kapellenkranz, dem durchschreitbaren Chorumgang umgeben. In Achsenrichtung öffnet sich der Chor mit einem Portal ,was wiederum von zwei ¾ Apsiden flankiert wird. Vor dem Chor kreuzt ein großes Querhaus, als waagerechtes Teil des Kreuzes , das Langhaus und bildet mit ihm die Vierung. Im Westen endet das Langhaus am vorgelagerten Westbau , der aus einem kleineren Querhaus, der Vorhalle, sowie dem Hauptportal besteht. Über dem Westbau befindet sich der oktogonale Hauptturm , der mit zwei auf dem Querhaus sich befindenden kleineren Türmen eingerahmt wird. Zudem befinden sich an den Flanken der Vorhalle jeweils eine Apsis.3
2.2.2. Außenbau:
Von außen betrachtet stellt die Kirche eine massive Akkumulation von Baumassen dar, die selbst noch vielgegliedert sind. So erscheint der Bau sehr kompakt , was den angestrebten Monumentaleffekt möglich macht. Auch fällt auf, daß das benutzte Baumaterial Haustein4 ist, was relativ untypisch für Berlin ist , da hier der Backsteinbau überwiegt. Die Verwendung eines solchen Material kommt ebenfalls dem monumentalen Demonstrativcharakter entgegen , weil Haustein wesentlich teurer als Backstein ist. Rein formal gesehen erkennt man folgende Gliederungen, Bauelemente und Anordnungen an der Aussenansicht des Gebäudes:
Schaut man von Westen auf die Kirche erblickt man die hochgschoßige Front, die über dem Portal thront. Das Portal selbst besteht aus drei nebeneinander angeordneten Eingängen, die jeweils von einem Rundbogen überspannt sind. Das hohe zweite Geschoß zeigt ein großes Rosettenfenster und wird von einem Sims mit Rundbogenfries abgeschlossen. Der Sims mit dem Fries zieht sich als eine Art Gürtel um das ganze Gebäude. Darüber befindet sich der Giebel , ebenfalls durch ein Rundbogenfries dekoriert und mit drei rundbögigen Fenstern in der Mitte. Rechts und links von der Front sind zwei kleinere Türme mit spitzem Helm zu sehen, die den alles überragenden achteckigen Hauptturm einrahmen. Der Turm hat eine Zwergengalerie und wird von einem spitzen Helmdach bedeckt, was auf der Spitze Kaiserkrone, Stern und Kreuz trägt, als über alles thronenden Symbole für die Verbindung von Staat und Kirche.
Auf der gegenüberliegenden Seite, der Ostseite, befindet sich der Chor mit seiner spitzen Dachpyramide und den verschiedenen Gesimsen und Zwerggalerien. Der Chorumgang steht als Basis bzw. als Erdgeschoß unter dem eigentlichen Chor hervor und wird so zu einer Art Sockel. Zwei Apsiden flankieren an diesem Sockel ein kleineres Portal. Neben der Dachpyramide heben sich noch zwei kleinere quadratische Türme in die Höhe und machen den fünftürmigen Bau komplett. Sieht man die Kirche von der Breitseite fällt einem als erstes wahrscheinlich das große Rosettenfenster auf , was unter dem Giebelgeschoß am Querhaus prangt. Das Langschiff wird durch mehrere Simse, Friesen und Lisenen in zwei Geschosse aufgeteilt und weist noch einige verhältnismäßig kleine Fenster auf .
2.2.3.Innenräume:
Allgemein kann man zu den Innenräumen sagen, daß sie sehr prächtig und vielfältig dekoriert sind. So finden wir dort eine große Anzahl von Wandmalereien , imposante figurative Mosaike und im Chor, in der Vierung, im Langhaus und in den Querarmen hohe und prächtige Sterngewölbe. Dies ist besonders interessant , da Sterngewölbe eigentlich typische Überdachungen gotischer Bauart sind und die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ein historistischer Bau mit einer reinen romanischen Tendenz ist. Dieses Auffinden zweier Stile unterschiedlicher Epochen kann und soll uns als Indiz gelten , daß wir es hier mit einem historistischen Bau zu tun haben . Dieses festzustellen erweist sich in manchen Fällen als gar nicht so einfach und daher will ich dies hier explizit herausstellen.5
Zum ikonographischen Programm der Kirche läßt sich in allen Abschnitten des Kirchenraumes eine aufeinander abgestimmte Koexistenz von christlichen, biblischen und weltlich, preußischen Motive feststellen. So bildet das Kuppelmosaik des Chores Kreuz und Reichsadler ab, als Zeichen der Symbiose von Staat und Kirche . Im Langhaus wird die biblische Heilsgeschichte thematisiert und drückt damit die Sorge um ein Volk aus und indirekt auch die Sorge Preußens bzw. Kaiser Wilhelm II. um sein Volk. Zwischen die biblischen Darstellungen werden aber auch weltliche Würdeträger gestellt, wie etwa der General Moltke, als würden sie zur Heilsgeschichte dazu gehören. Am Portal findet sich auch eine fast schon dreiste Vermischung von christlichen und weltlichen Themen, die aber geschickt so gewählt sind , daß die christlichen Themen die staatlichen unterstützend flankieren. Es wird eigentlich die Kirche und ihre religiöse Funktion zur staatlichen Selbstdarstellung bzw. Propaganda mißbraucht oder benutzt, je nach Standpunkt. Als Beispiel der gewählten biblischen Geschichten sei hier die Errettung des Jünglings Naim genannt , die eine Allegorie für den Kampf gegen den Tod ist bzw. generell für den Kampf , was den preußischen Idealen ja sehr nahe kommt.6
Die Vorhalle im Westbau der Kirche ist fast ausschließlich profaner Thematik, d.h. dem Andenken an Kaiser Wilhelm 1. Gewidmet und wird daher auch Kaiser Wilhelm Gedächtnishalle genannt. Im Gegensatz zu anderen Kirchen ist dies bemerkenswert , da hier die Sakralisierung eines weltlichen Herrschers eindeutig im Vordergrund steht und dafür ein ganzer Abschnitt des Kirchenraums gebraucht wird. So ist im Tonnengewölbe der Vorhalle das ganze Herrschergeschlecht der Hohenzoller als Mosaik abgebildet, wobei natürlich Wilhelm besonders emporgehoben wird . Unter dem Gewölbe, in Sichthöhe des Betrachters ergänzt ein Relief mit der Darstellung von den Taten7 Wilhelms den Denkmalcharakter .In den Apsiden befindet sich noch ein weiteres Mosaik , was den Kontext Wilhelms zur deutschen Geschichte erläutert, indem es seine Ahnen der Macht zeigt.8 Bei allen Abbildungen werden sehr idealisierte, nationalistische und martialische Mittel benutzt, wie etwa Krieger, die Germania vom Niederwalddenkmal, deutsche Eiche, Kaiserkrone und die Siegesgöttin Nike. Wie schon oben erwähnt sind auch hier die wenigen christlichen Darstellungen passend zum Thema gewählt.
Zusammenfassend können wir festhalten , daß die Innenräume der Kirche bewußt auf Repräsentation der preußischen Macht und Ideale ausgerichtet sind . Dafür wird sogar eine katholische gotische Bauform , das Sternengewölbe, benutzt , da dieses einen sehr hohen Wirkungsgrad hat , was die Beeindruckung von Menschen angeht.
2.2.4. Vorbilder:
Da der Historismus generell ein „Sammelsurium“ von schon vergangenen Stilen älterer Epochen ist, orientiert er sich natürlich auch an konkreten Beispielen bzw. Vorbildern. Im Fall der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist die Epoche von vorne hinein vom Auftraggeber festgelegt worden , nämlich die Romanik. Daher sind die architektonischen Vorbilder für diesen Bau ausschließlich Kirchen aus der romanischen Zeit von ca. 1000-1200 n. Chr., und um es genauer einzugrenzen die der rheinischen Spätromanik. Trotz dieser relativ engen geographischen Eingrenzung sind es doch viele Bauten aus denen der Architekt Schwechten Elemente übernommen hat. Dadurch daß Schwechten in Köln aufgewachsen ist , kann man nahezu alle romanischen Kirchen Kölns zu den Vorbildern zählen. Aber auch Kirchen aus dem Kölner Umland dienen als Beispiele , wie die kleine Dorfkirche in Sinzig oder das Bonner Münster, das besonders bei der städtebaulichen Planung (siehe nächstes Kapitel) d.h. die Plazierung der Kirche auf einem isolierten Platz, Pate stand. Die Ostpartie , also der Chor , ist von der Marienkirche zu Gelnhausen beeinflußt, die Details der Giebel sind vom Mainzer Dom inspiriert und die monumentale Vieltürmigkeit hat den Limburger Dom als Vorbild.
Es läßt sich auch ein anderer wichtiger Einfluß Schwechtens anhand der Bauweise ablesen. Nämlich der seines Lehrers Adler, Architekt vieler historistischer Bauten , die ebenfalls Romanik bezogen sind. Zum Beispiel die reformierte Kirche in Insterburg, von der Schwechten den Chorumgang und das östliche Portal übernimmt oder die Thomaskirche in Berlin, die auch Ähnlichkeiten aufweist.
In den Innenräumen wird die strikte Vorbildfunktion der Romanik allerdings etwas gelockert, so daß wir hier auch gotische Elemente finden , wie das schon erwähnte Sterngewölbe. Auch profane Gebäude sind im Innenraum als Vorbild zugelassen, wovon die Mosaike zeugen , die vom Hohenzollernhaus übernommen wurden.
2.3.Städtebauliche Situation:
Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche ist von Grund auf ein durchgeplannter und wohl kalkulierter Bau , der in all seinen Facetten der Vorstellung seines Auftraggebers , Kaiser Wilhelm II. , entsprechen mußte .Da dieser einen beeindruckenden Monumentaleffekt anstrebte, wollte er auch die städtebauliche Situation auf dieses Effekt maßgeschneidert anpassen.
Eine zentrale Lage an einem Knotenpunkt der Stadt schien am geeignetsten , um eine besonders hohe repräsentative Wirkung zu gewährleisten. So wurde dann der Auguste Viktoria Platz im westlichen Teil von Berlin gewählt, da er diesen Anforderungen entsprach. Zu der zentralen Lage wurde noch beschlossen , daß die Kirche frei auf einer Art Verkehrsinsel und schräg zu den Achsen der anliegenden Straßen stehen sollte, so daß keine Straße frontal auf eine Seite der Kirche auflief , sondern sich immer zwei Seiten als Ansicht bieten. Auch diese Maßnahmen , die eine Vielansichtigkeit , Hervorhebung und Extravaganz des Baues förderten, unterstützen die Monumentalität und Wirkung .
Doch dem Kaiser schwebte noch mehr vor ,als die bloße Heraushebung der Kirche aus dem Stadtbild. Er strebte eine Schaffung eines „Romanischen Forum“ an , d.h. ein Umgebung der Kirche mit einem Viertel was einheitlich im neoromanischen Stil gebaut war, zur Schaffung eines städtebaulichen Zentrums unter dem preußischen Stildiktat. Also wurden zunächst zwei Häuser gebaut, um der Kirche einen geeigneten Rahmen zu schaffen. Das erste „romanische Haus“ ist an der Westseite des Platzes gelegen und vom Ausehen ,besonders von der Fassade her, an das Ausehen der Kirche angepaßt. Der viergeschoßige Bau, der natürlich auch sehr auf Repräsentation bedacht ist , weist auch etliche Zitate von romanischen Bauten auf: So dient die Laacher Abteikirche als Vorbild für die Ecktürme , das Treppengeschoß ist der Kaiserpfalz in Goslar entnommen und die Gesimsanordnung der Wartburg , als nationale und religiöse Referenz an diesen wichtigen Bau der deutschen Geschichte.9 Das zweite “romanische Haus“ liegt gegenüber dem ersten und ist vom Bau her ähnlich gehalten.
In diesen Bauten wurden Geschäfte ,Banken , Restaurants, etc. angesiedelt, um die Bourgeoisie an den Platz zu binden , da die Monumentalität der Kirche ja an ihre Adresse gerichtet war ,doch dazu im nächsten Kapitel mehr.
2.4. Kontext und Bedeutung:
Nach dem Tod Kaiser Wilhelm 1. beschließt sein Nachfolger Wilhelm II. ihm ein Denkmal zu setzen in Form einer Kirche im neoromanischen Stil. Ein Denkmal , um seine Familie zu ehren und damit sich selber aufzuwerten, sowie aller Welt den Status der preußischen Kaiserfamilie zu zeigen, insbesondere der aufsteigenden Bourgeoisie, die zunehmend Einfluß bekam.
Eine Kirche ,deshalb, weil er erstens alle anderen Denkmalsformen schon gebaut hatte10, zweitens weil Wilhelm dem Verlust an Religiosität und damit der Moral und der Kaisertreue im Volk entgegen wirken wollte. Er wollte also dem Volk einen Ort des Glaubens geben, allerdings mit dem Hintergedanken seine Machtposition zu stützen. Der dritte Grund war ein sozialpolitischer , denn in Berlin herrschte zu dieser Zeit ein Mangel an Kirchen , die sog. Kirchennot und der Bau einer Kirche durch den Kaiser brachte ihm sicherlich die Sympathien des Volkes ein, was natürlich in seinem Interesse war. Doch der Bau einer Gedächtniskirche ,d.h. einem Denkmal in sakraler Form, hatte noch einen weiteren , mehr psychologischen Grund, der aber sehr wichtig ist. Durch diese Sakralisierung der preußischen Familie wird sie fast heilig gesprochen, was einen bedeutenden Eindruck auf das Volk machen sollte. Der neoromanische Stil als Vorgabe für die Kirche war für Kaiser Wilhelm geradezu selbstverständlich, da Preußen die Romanik zum urdeutschen und protestantischen Stil erklärt hatte. Denn die Romanik war der Stil des Stauferreichs, auf das sich Preußen und die Hohenzollern sich beriefen, da die Staufer als erste ein deutsches Einheitsgebiet erschufen und ausweiteten, sowie das Christentum einführten. Zudem ist die Bauweise der Romanik eine relativ schlichte, was eine Parallele zu den protestantischen Idealen schafft. Ein Vergleich und eine Referenz an die Leistungen der Staufer stellte den Kaiser höher, stellte seine Ideale und Tradition dar und legitimierte letztendlich seine Macht.
Daß generell im historistischen Stil gebaut wurde und die durchaus schon vorhandene Moderne verneint wurde liegt auch auf der Hand , denn parallel zum statischen Politikverständnis der preußischen Monarchie hatte diese auch ein statisches und regressives Kunstverständnis, was sich ja ergänzte .
2.5. Die Kirche heute:
Am 23.11.1943 wird die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche während eines Luftangriffs schwer getroffen und fast vollständig zerstört.
Nach dem Krieg entbrannte eine heftige Diskussion um die weitere Existenz der Ruine . Die Frage nach Wiederaufbau, Restaurierung, Abriß oder Neubau erhitzte die Gemüter und bildete wieder einmal verschiedene Parteien, wie schon in der Bauphase 1890. So waren die Christen gegen die Kirche , da sie sie für zu verweltlicht hielten, die Konservativen waren für die Erhaltung aus patriotischen Gründen und die unpolitischen Ästheten spalteten sich auch noch mal in Gegner und Befürworter.
Eine Kampagne des Berliner Tagesspiegel „Rettet den Turm“ beendete die Diskussion und führte zur Erhaltung der Ruine als Mahnmal des 2. Weltkrieges und zu einer Ergänzung durch einen modernen Neubau. Der Architekt Egon Eiermann beginnt 1959 mit dem Bau der Kirche. In Anlehnung an den oktogonalen Hauptturm der ehemaligen Kirche entsteht nun ein ebenfalls achteckiger Turm in einer modernen Bauweise sowie noch kleinere Gebäude im selben Stil.
Dieser architektonische Kontrast der Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche ist heute wieder Blickfang und städtebaulicher Höhepunkt in Berlin.
3.Fazit
Als Fazit läßt sich festhalten , daß die Kaiser Wilhelm Kirche ein wohl kalkulierter Monumentalbau ist mit dem Anspruch einer „imperial-sakralen Staatskirche“ und der Absicht Macht zu demonstrieren und diese zu legitimieren , an die Adresse des aufstrebenden städtischen Bürgertums.
Mit diesen Attributen versehen war die Kirche immer ein Sreitfall an dem sich bis in die heutige Zeit die Gemüter scheiden. Doch alles in allem ist der Bau sehr wichtig, da er architektonisch ausgereift und imposant ist, sehr schön die Strategien und Absichten seines Auftraggebers durchscheinen läßt und letztendlich noch eine Lektion in Sachen Denkmalschutz bereithält.
4. Literaturliste
Die Bauwerke und Kunstdenkmäler von Berlin; Beiheft 9;
Berlin 1982;
Vera Frowein-Zierhoff :
Die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche;
Hrsg.: Landeskonservator;
Berlin und seine Bauten;
Teil 4: Sakralbauten;
Berlin 1997;
Hrsg.: Architekten und Ingenieur Verein zu Berlin;
[...]
1 Adler errichtete 1864 die Thomaskirche in Berlin, welche eine ähnliche Formensprache besitzt, wie die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Man kann dies also als weiteren Einfluß Schwechtens werten.
2 1885 Mitglied des Senats der preußischen Akademie der Künste ; 1880/82 Kriegsakademie ; 1888 Philharmonie und Becksteinsaal ; 1890 Mitglied der Bauakademie ; 1890 Leiter eines Meisteratelier an der Technischen Hochschule Charlottenburg ; 1905/10 Kaiserschloß in Posen für Wilhelm 2. ; 1908 Hohenzollernbrücke in Köln ; 1908 Kriegsschule in Potsdam ; 1909 Erlöserkirche in Essen ; 1911/15 protestantische Kirche in Rom ; etc.
3 Siehe auch Abbildung1 im Anhang.
4 z.B.: Oberstreiter Granit; Brohltahler Tuffstein
5 obwohl hier die Rosettenfenster am Außenbau , als romanikfremde Bauart, auch als Indiz gelten können.
6 Fast alle biblischen Darstellungen der Kirche haben etwas entweder mit der Heilsgeschichte, Kampf und Tapferkeit oder Macht und Herschaftsanspruch zu tun. Jedoch alle hier zu behandeln würde den Rahmen sprengen.
7 Bemühen um die Einheit des dtsch. Reiches, Idealisierung seiner Schlachten
8 Karl der Große, Heinrich1. , Otto der Große, Rudolf von Habsburg
9 Luther sei hier genannt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?
Der Text ist eine umfassende Untersuchung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin, ihres Architekten Franz Heinrich Schwechten, und des historischen Kontexts. Er beinhaltet eine Einführung, eine detaillierte Baubeschreibung (Grundriss, Außenbau, Innenräume), eine Diskussion über Vorbilder, eine Analyse der städtebaulichen Situation, eine Bewertung des Kontextes und der Bedeutung des Gebäudes, eine Beschreibung der Kirche heute, ein Fazit und eine Literaturliste. Die Analyse legt besonderen Wert auf die Repräsentationsabsichten der preußischen Macht.
Wer war Franz Heinrich Schwechten?
Franz Heinrich Schwechten (1841-?) war ein bedeutender Architekt des Historismus, der besonders durch seine reaktionären und regressiven Entwürfe bekannt wurde, die oft im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. entstanden. Er wuchs in Köln auf, studierte an der Berliner Bauakademie und avancierte später zum "Hofarchitekten". Zu seinen Werken gehören der Anhalter Bahnhof in Berlin und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.
Wie war der Grundriss der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche angelegt?
Der Grundriss der Kirche war in Form eines gedrungenen Kreuzes angelegt, bestehend aus Langhaus, polygonalem Chor mit Kapellenkranz (Chorumgang), Querhaus und Westbau mit Hauptturm. Es handelte sich um einen fünftürmigen Bau.
Welche Materialien wurden beim Bau der Kirche verwendet?
Die Kirche wurde hauptsächlich aus Haustein (z.B. Oberstreiter Granit, Brohltahler Tuffstein) gebaut, was für Berlin untypisch war, da dort der Backsteinbau üblich war. Die Verwendung von Haustein unterstrich den monumentalen Charakter des Baus.
Welche Stilelemente wurden im Innenraum der Kirche verwendet?
Die Innenräume waren reichhaltig dekoriert mit Wandmalereien, Mosaiken und Sterngewölben. Die Sterngewölbe, typisch für die Gotik, sind ein Beispiel für den Historismus, der Stile verschiedener Epochen kombinierte.
Welche Vorbilder hatte Schwechten beim Bau der Kirche?
Schwechten orientierte sich an romanischen Kirchen des Rheinlandes, darunter Kirchen in Köln, Sinzig, das Bonner Münster, die Marienkirche in Gelnhausen und der Mainzer Dom. Ein weiterer Einfluss war sein Lehrer Adler, dessen Bauten ebenfalls romanische Stilelemente aufwiesen. Auch gotische und profane Bauten dienten als Vorbilder für Inneneinrichtungselemente.
Wie war die städtebauliche Situation der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche?
Die Kirche befand sich an einem zentralen Verkehrsknotenpunkt, dem Auguste-Viktoria-Platz (heute Breitscheidplatz). Sie stand frei auf einer Art Verkehrsinsel und schräg zu den Achsen der anliegenden Straßen, um die Monumentalität und Wirkung zu erhöhen. Kaiser Wilhelm II. plante sogar ein "Romanisches Forum" mit neoromanischen Bauten rund um die Kirche.
Welche Bedeutung hatte die Kirche im historischen Kontext?
Die Kirche wurde von Kaiser Wilhelm II. als Denkmal für seinen Vorgänger, Kaiser Wilhelm I., in Auftrag gegeben. Sie diente als Demonstration der preußischen Macht, der Kaiserfamilie zu Ehren und der Stabilisierung der Kaisertreue im Volk, insbesondere gegenüber dem aufstrebenden Bürgertum. Die Wahl des neoromanischen Stils sollte an das Stauferreich erinnern und die Macht des Kaisers legitimieren.
Was geschah mit der Kirche im Zweiten Weltkrieg und danach?
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde am 23. November 1943 durch einen Luftangriff schwer beschädigt und fast vollständig zerstört. Nach dem Krieg gab es eine Diskussion über Wiederaufbau, Abriss oder Neubau. Schließlich wurde die Ruine als Mahnmal erhalten und durch einen modernen Neubau von Egon Eiermann ergänzt.
Was ist das Fazit des Textes?
Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war ein Monumentalbau mit dem Anspruch einer "imperial-sakralen Staatskirche", der Macht demonstrieren und legitimieren sollte. Sie war und ist ein Streitfall, aber architektonisch ausgereift und ein wichtiges Beispiel für Denkmalpflege.
- Quote paper
- Ivo Bathke (Author), 1999, Schwechten / die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97207