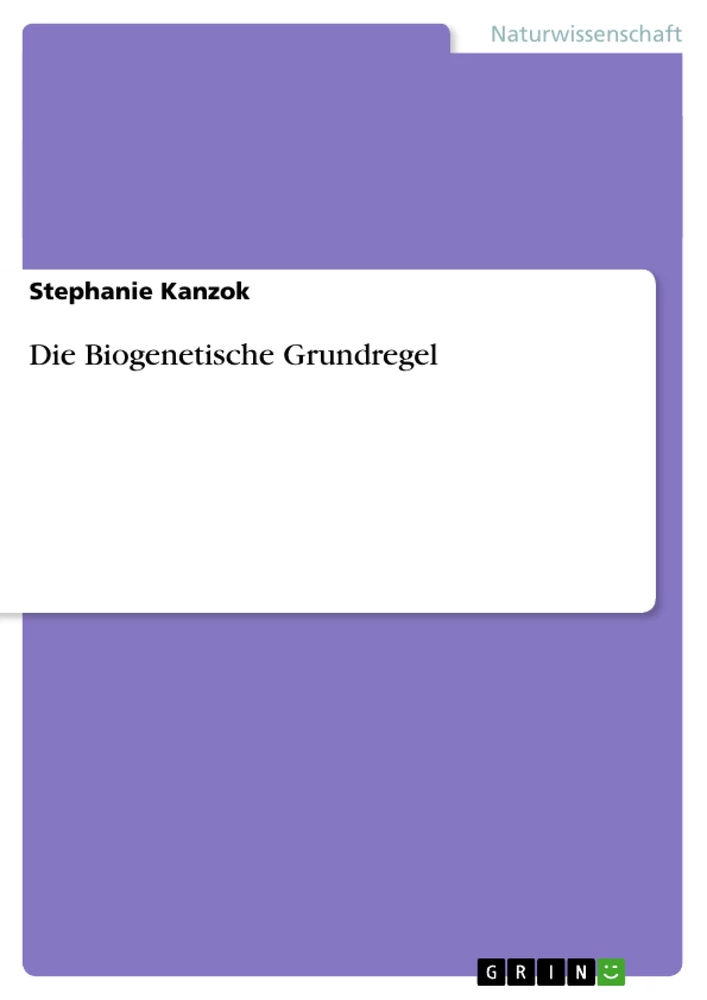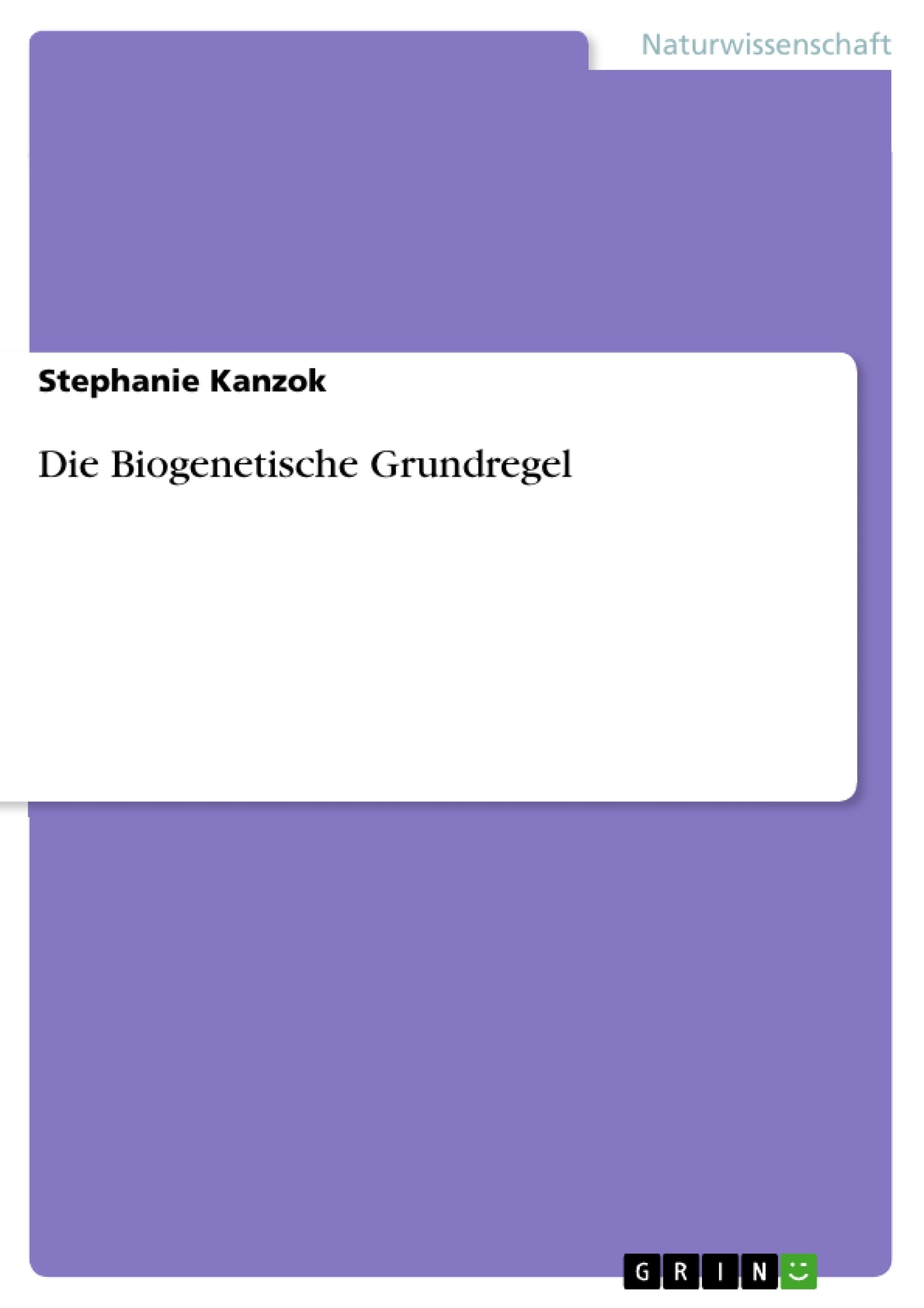Stellen Sie sich vor, Sie könnten die verborgenen Pfade der Evolution entschlüsseln, indem Sie die Entwicklung eines einzelnen Organismus beobachten. Dieses Buch entführt Sie in die faszinierende Welt der biogenetischen Grundregel, einer einst bahnbrechenden Theorie, die besagt, dass die Ontogenese – die Entwicklung eines Individuums – eine verkürzte und beschleunigte Rekapitulation der Phylogenese, der Stammesgeschichte seiner Vorfahren, darstellt. Wir begeben uns auf eine spannende Reise von den antiken Weisheiten des Aristoteles über die bahnbrechenden Entdeckungen von Karl Ernst von Baer bis hin zur kontroversen Formulierung der biogenetischen Grundregel durch Ernst Haeckel. Anhand detaillierter Erklärungen zentraler Begriffe wie Transitorische Bildungen, Anlagen, Zwischenstrukturen und Caenogenesen wird ein tiefes Verständnis für die komplexen Prozesse der Embryonalentwicklung vermittelt. Es wird untersucht, wie Ontogenese und Phylogenese ineinandergreifen, welche Rolle die vergleichende Embryologie spielt und welche Ausnahmen und Einschränkungen die biogenetische Grundregel mit sich bringt. Der Leser erfährt, wie die Ontogenese im Laufe der Evolution vielfältige Veränderungen erfahren hat, von Abwandlungen und Reduktionen von Endstrukturen bis hin zu Verschiebungen von Strukturen zwischen Ontogenesestadien. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Caenogenesen und Rekapitulationen, den faszinierenden Mechanismen, die Einblicke in die Anpassungsfähigkeit und die evolutionären Pfade der Lebewesen ermöglichen. Das Buch beleuchtet die funktionale Bedeutung der Rekapitulation des Kiemendarmes und diskutiert, inwiefern ontogenetische Untersuchungen für phylogenetische Aussagen relevant sind. Kritische Einwände gegen die Rekapitulationsregel werden ebenso berücksichtigt wie Argumente, die die Ontogenese als wertvolle Quelle für die phylogenetische Forschung bestätigen. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, ob es eine ontogenetische Methode zur Rekonstruktion der Phylogenie gibt und welche Schlussfolgerungen aus dem Vergleich verschiedener Arten gezogen werden können. Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die sich für Evolutionsbiologie, Entwicklungsbiologie und die tiefgreifenden Verbindungen zwischen individueller und stammesgeschichtlicher Entwicklung interessieren. Es bietet einen umfassenden Überblick über die biogenetische Grundregel, ihre Bedeutung und ihre Grenzen und regt zum Nachdenken über die komplexen Mechanismen des Lebens an. Tauchen Sie ein in die Welt der Embryonen und entdecken Sie die verborgenen Botschaften, die sie über die Evolution unseres Planeten bereithalten.
THEMA: DIE BIOGENETISCHE GRUNDREGEL
- Rekapitulieren Organismen in der Ontogenie die Phylognie? -
1. Die Geschichte der phylogenetischen und ontogenetischen Entwicklung
a) Aristoteles (400 v.Chr.): Frage nach Bildung unterschiedlicher Teile des Embryos
Aristoteles stellte sich die Frage wie unterschiedliche Teile des Embryos gebildet werden.
Er kam dabei auf 2 Theorien:
Teile des Embryos sind von Anfang an vorgeformt und werden im Laufe der Zeit nur noch größer (Präformation)
Es entstehen permanent neue Strukturen, ein Prozeß den er Epigenese nannte. (Favorisierte Theorie)
Aristoteles Vorstellungen prägten das Denken in Europa bin in das 17 Jhd. Das die Epigenese die richtige Theorie war wurde aber erst im 19 JD. endgültig geklärt.
b) Karl Ernst von Baer (1828): ,,Gesetz der Embryonenähnlichkeit"
Baer stellte fest, dass bei Wirbeltieren die Embryonen einander ähnlicher sind als die aus ihnen entstehenden Adulten. Je jünger die Embryonalstadien dabei waren, umso schwerer waren sie zu unterscheiden (Bsp. Fisch, Amphib, Echse, Vogel oder Säugetier). Diese Gesetzmäßigkeit nannte er das ,,Gesetz der Embryonenähnlichkeit".
c) Matthias Schleiden / Theodor Schwan (1839): Zelltheorie
Die Zelltheorie war eine der aufschlußreichsten Entwicklungen in der
Biologie. Man erkannte, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen und sich durch Zellteilungen weiterentwickeln.
Entwicklung konnte also nicht nach dem Prinzip der Präformation von statten gehen sondern musste das Ergebnis der Epigenese sein.
d) Charles Darwin (1858): ,,Vergleichende Embryologie"
Darwin setzt dann die Ergebnisse der vergleichenden Embryologie für seine Evolutionstheorie ein.
e) Ernst Haeckel (1866): ,,Biogenetische Grundregel"
Haeckel wollte eine Methode entwickeln um die Stammesgeschichte einer Art nachvollziehen zu können. Dabei legt er eine der bedeutensten Regeln in der Biologie fest, die ,,biogenetische Grundregel". Diese besagt: ,,Die Ontogenese ist die kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenese bedingt durch die physiologischen Funktionen der Vererbung und Anpassung".
Haeckel erkannt aber auch schon, dass es Einschränkungen seiner Theorie gab.
2. Einige Begriffserklärungen
Transitorische Bildungen:
Bildungen, die nur kurzzeitig aufgebaut werden; Vorübergehende Bildungen
Anlagen:
Wenig differenzierte Vorstufen eines Organs oder einer Struktur
Zwischenstrukturen:
Vorstufen eines Organs oder einer Struktur, die eine spezifische Qualität aufweisen und mit der schließlich gebildeten Struktur homologisierbar sind.
Endstruktur:
Den fertig ausgebildeten Zustand eines Organs, einer Struktur oder einer physiologischen und ethologischen Leistung nennen wir Endstruktur.
Sonderstruktur:
Eine Struktur die eine Sonderfunktion auf einem Zwischenstadium übernimmt (besondere Vorläuferstruktur).
Caenogenesen:
Bildung transitorischer Endstrukturen oder Sonderstrukturen, die spezielle Anpassungen eines Ontogenesestadiums darstellen.
Rekapitulationen:
Das transitorische Auftreten von Zwischenstrukturen ehemaliger Endstrukturen sowie die vorübergehende Bildung ehemals dauerhafter Endstrukturen.
Organogenese:
Anlage und Differenzierung spezieller Strukturen (Organen) wie z.B. Extremitäten, Herz, Augen.
Heterochronie:
Als Heterochronie bezeichnet man sie zeitliche Verschiebung in der zu erwartenden Reihenfolge von Entwicklungsvorgängen.
Homolog:
In der Phylogenie stammesgeschichtlich gleichwertig, sich entsprechend, übereinstimmend von entwicklungsgeschichtlicher Herkunft. Das heißt Organe können einander sehr ähnlich sein oder durch Funktionswechsel im Verlauf der stammesgeschichtlichen Entwicklung eine sehr unterschiedliche Ausformung erfahren.
Analog:
Organe besitzen eine gleich Funktion, ihr entwicklungsgeschichtliche Herkunft ist jedoch unterschiedlich.
3. Was ist Ontogenese und Phylogenie und in welchem Zusammenhang stehen sie? Entwicklung=
Die gerichtete, zeitlich geordnete und in sich zusammenhängende Abfolge von Veränderungen
Entwicklung kann in:
- Funktioneller Hinsicht (z.B. Auftreten neuer oder verschwinden bereits ausgebildeter Verhaltensfunktionen)
- Organisatorischer Hinsicht (z.B. Koordination oder Verselbständigung einzelner Verhaltensfunktionen)
- Struktureller Hinsicht (z.B. durch den Aufbau bzw. Abbau übergeordneter verhaltensregulierender Systeme)
In ihrer Gesamtheit stellen diese Punkt den Entwicklungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Entwicklung kann man aber auch genauer betrachten. Man unterscheidet in der Entwicklungsbiologie zwischen Ontogenie (Entwicklungsgeschichte des Individuums) und Phylogenie (Entwicklungsgeschichte der Art). Ontogenie und Phylogenie werden durch die biogenetische Grundregel in einen engen Zusammenhang gebracht. Die Tatsache, dass ,,die Ontogonie die Phylogenie rekapituliert" belegt unter anderem die vergleichende Embryologie.
In der Embryonalentwicklung durchlaufen nahe verwandte Lebewesen ähnliche Stadien. Alle Wirbeltierembryonen legen sich zum Beispiel in einem ihrer Entwicklungsstadien seitlich an ihrer Kehle Kiementaschen an. In diesem Stadium der Entwicklung sind Ähnlichkeiten zwischen Fischen, Fröschen, Schlangen, Vögeln, Menschen und allen anderen Wirbeltierarten viel Offensichtlicher als Unterschiede. Erst mit voranschreitender Entwicklung nehmen die Wirbeltiere die charakteristischen Merkmale ihrer Klasse an.
Dies macht den Gedanken vom Zusammenhang der Ontogenie mit der Phylogenie sehr naheliegend und es entwickelte sich daraus der Versuch die Stammesentwicklung durch Beobachtung der Individualentwicklung aufsteigend zu rekonstruieren. Im folgenden wird sich aber zeigen, dass die biogenetische Grundregel auch viele Ausnahmen besitzt.
Auch wenn es Ausnahmen gibt, liefert die Ontogenie wichtige Hinweise auf die Phylogenie. Es ist ebenso eine Tatsache, dass phylogenetische Änderungen stets individuelle Verschiedenheiten des ontogenetischen Programms voraussetzen. Dies liefert das ,,Rohmaterial" für den evolutiven Wandel.
4. Wie verläuft die Ontogenese?
Die Entwicklung der Wirbeltiere verläuft sehr unterschiedlich. Es gibt dennoch eine Reihe gemeinsamer Stadien, die man anhand der Entwicklung der Frosches (beliebtester Organismus in der experimentellen Embryologie da er große Eier besitzt, die Embryonen widerstandsfähig und leicht in einem einfachen Nährmedium zu kultivieren sind).
Stadium 1: BEFRUCHTUNG
- Unbefruchtetes Ei als große Eizelle. Unterteilt in animaler Pol (wird zum Vorderende d.h. Kopf des Embryos) und vegetativer Pol ( Ansammlung von Dottergranula)
- Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium sowie Fusion der weiblichen und männlichen Kerne. (Zygote) Stadium 2-8: FURCHUNGSTEILUNGEN
- Beginn der Furchung; mitotische Teilungen, bei denen die Zellen zwischen den einzelnen Teilungen nicht wachsen und dadurch immer kleiner werden. o Nach ca. 12 Teilungen besteht der Embryo (Blastula; viele kleine Zellen die einen flüssigkeitsgefüllten Hohlraum, das Blastocoel, einschließen; befindet sich über den Dotterzellen)
- Keimblätter haben sich herausgebildet; Mesoderm als äquatoriales Band, welches später Muskeln, Knorpel, Knochen sowie andere Organe wie Herz, Niere und Blut bildet. Entoderm aus dem sich Darm, Lunge und Leber entwickeln. Ektoderm (aus der animalen Region hervorgehend) aus dem sich Epidermis und Nervensystem entwickeln.
Stadium 10-12: GASTRULATION
- Starke Umordnung der Zellen
- Entoderm und Mesoderm wandern in das Innere des Embryos
- Mesoderm bildet im Innern stabförmige Struktur die Chorda dorsalis
Stadium 13-15: NEURULATION
- Ektoderm faltet sich über Chorda zu einem Rohr (Neuralrohr), aus dem sich Gehirn und Rückenmark entwickeln.
- Organe sowie Gliedmaßen werden an den entsprechenden Stellen angelegt aber noch nicht weiter entwickelt
Stadium 26: ORGANOGENESE
- Entwicklung der Organe, Gliedmaßen, Augen, usw.
- Differnezierung spezialisierter Zellen wie Muskeln, Knorpel und Neuronen
- Embryo entwickelt sich innerhalb von 48h zu einem Kaulquappe mit typischen Wirbeltiereigenschaften
- Larvalstadium mit bestimmten Larvalmerkmalen wie: Ruderschwanz, Kiemen, Hornkiefer, kehlständige Haftdrüsen, stark verlängerter, spiralig aufgewundener Darm, Seitenlinienorgan, Exkretion von Ammoniak, Lungen mit jeweils einem als Trommelfell dienendem Membranbezirk.
Stadium 45: METAMORPHOSE
- Kaulquappe entwickelt sich zum adulten Tier.
- Larvalmerkmale bauen sich zum Teil ab, es entstehen neue Merkmale wie:
Extremitäten, Dentinzähne, äußeres Trommelfell, Exkretion auf Ausscheidung von Harnstoff umgestellt, Verlust des Ruderschwanzes.
Stadium 45: METAMORPHOSE
- Kaulquappe entwickelt sich zum adulten Tier.
- Larvalmerkmale bauen sich zum Teil ab, es entstehen neue Merkmale wie: Extremitäten, Dentinzähne, äußeres Trommelfell, Exkretion auf Ausscheidung von Harnstoff umgestellt, Verlust des Ruderschwanzes.
5. Wie hat sich die Ontogenese im Laufe der Evolution verändert?
Evolution kann in jedem Ontogenese-Stadium einsetzen. D.h. es können ontogenetische Zwischenstadien als auch Adultstadien von der evolutiven Weiterentwicklung oder Reduktion betroffen sein.
a) Abwandlungen bzw. Reduktionen der Endstruktur
Die Endstruktur kann allein für das Adultstadium evolutiv abgeändert sein. Sie kommt nur noch transitorisch auf dem Zwischenstadium als nicht-caenogenetische Sonderstruktur vor.
Bsp.:
Keimendem des Neunauges; bei Ammocoetes Larve noch als Kiemen- und Filterapparat in Gebrauch, nach der Metarmorphose jedoch reines Atemorgan. (Abb. 66H) Embryonal angelegtes Cölom bleibt bei Arthropoden nur in Resten (Exkretionssystem, Septum unter dem Röhrenherz, Gonaden) erhalten.
Plattfische haben zunächst eine normale Fischform und werden erst im Laufe der Ontogenese Asymmetrisch
Vollständiger Abbau einer ehemals dauerhaften Endstruktur. Die Struktur ist dann nur noch auf eine frühe Phase der Ontogenese beschränkt.
Bsp.:
Schwanz einer Froschkaulquappe
Zähne von Stör Larven
Chorda eines Vogelembryos
Jungvögel des südamerikanischen Schopfhuhns mit 2-3
beweglichen, krallenartigen Fingern, die nach 2-3 Wochen wieder verschwinden.
Die gesamte Endstruktur wird umgewandelt. Es werden aber noch ehemalige Zwischenstrukturen durchlaufen.
Bsp.:
Herz in der Vogelentwicklung zuerst fischähnlich; wird im Laufe der Entwicklung zu einem Vogelherz umgebaut. Umwandlung der Kiemendarmanlagen der Tetrapoden in branchiogene Organe.
Adultstruktur wird völlig zurückgebildet, während ihre Zwischenstruktur erhalten bleibt.
Bsp.:
Embryonen zahnlosen Bartwale und Ameisenbären legen Zahnglöckchen an (Abb. 66A/C)
Anlage eines ,,Schwänzchen" beim Menschen
Caenogenetische Endstrukturen vom Abbau betroffen. Nur noch die ehemalige Zwischenstruktur ist erkennbar.
Bsp.:
Schnecken die ein freies Larvenstadium reduziert haben können trotzdem Larvalorgane (z.B. wie Veliger-Larve lappenartige Fortsätze) im Ei anlegen, ohne, dass diese im Gebrauch sind. Dottersack der Placentalia ist auffällig klein und wird frühzeitig zurückgebildet (Mensch 2. Monat)
b) Verschiebung von Strukturen zwischen Ontogenesestadien (Abb. 64)
Im Laufe der Evolution werden Merkmale auf frühe oder späte Ontogenesestadien verlagert.
Adultation
Die adulte Endstruktur wird auf ein frühes Stadium vorverlegt und tritt schon dort in Funktion.
Bsp.:
Bei den Mollusken besitzt die Veliger-Larve der Ganglioneura im Gegensatz zur Trochophora der Polyplacophora bereits eine Schale. Das Adultmerkmal wurde durch Reduktion in einem späteren Stadium zum Larvalmerkmal. Veliger- Larven mariner Nacktschnecken legen eine
Schale an, die später abgeworfen wird.
Fötilisation
Larvale oder jugendliche Merkmale werden beim Adultus beibehalten und ersetzen ursprüngliche Adultmerkmale.
Bsp.:
Beibehalten einer durchgehenden Chorda beim Hai
Wimpernkleid und in der Epidermis liegende Nervenstränge bei verzwergten Polychaeten
Sonderfall: Neotenie
Sind sehr viele Merkmale fötalisiert und kommt es damit gleichsam zur Geschlechtsreife auf Larvalem Zustand spricht man von Neotenie.
6. Was sind Caenogenesen und Rekapitulation?
a) Caenogenesen und ihre Entstehung
Caenogenesen sind Bildungen transitorischer Endstrukturen oder Sonderstrukturen. Sie stellen spezielle Anpassungen eines Ontogenesestadiums dar. Beispiel: der Hornkiefer und die Sonderstruktur der Lunge sind Bildungen die sich auf Larvalstadien der Frösche beschränken und sonst nirgends als Adultstruktur vorkommen. Man kann sie deshalb als spezielle Anpassung an ein ontogenetisches Stadium bezeichnen und somit auch als Caenogenese.
Caenogenesen sind meist evolutive Neubildungen mit einer eigenen
- ntogenetischen Entwicklung.
Beispiele:
- Hornkiefer bei Frosch-Kaulquappen
- Außerembryonale Hilfsorgane (Dottersack, Amonitenfalte, Allantois) bei Amnioten (Abb. 62A)
- Eizahn bei Vogelküken (Abb. 62D)
- Tracheenkiemen wasserlebender Insektenlarven (Abb. 62 H-K)
- Spezielle Bildungen zur Herstellung des Kontaktes mit dem Wirt bei Glochidium-Larven bestimmter Süßwassermuscheln (Abb. 62F)
Es können auch caenogenetische Sonderstrukturen auftreten aus der sich später die Endstruktur der Adulten bildet. Dabei haben sich vorhandene Zwischenstrukturen oder frühzeitig auftretende Endstrukturen caenogenetisch an ontogenetische Bedingungen angepasst.
Beispiele:
- Fangmaske bei Libellenlarven (Abb. 62L)
- Darmkiemen bei Larven der Großlibellen (Abb. 62K)
- Grabbbeine der Singzikaden (Abb. 62G)
- Vorderextremitäten neugeborener Känguruhs (Abb. 62B)
Übergang zwischen caenogenetischer Sonderstruktur und Endstruktur verläuft fließend.
b) Rekapitulation und ihre Ursache Rekapitulation ist das Auftreten transitorischer Zwischenstrukturen ehemaliger Endstrukturen sowie die vorrübergehende Bildung ehemals dauerhafter Endstrukturen.
Man kann sie also als Wiederholungen alter Zustände in der Entwicklung bezeichnen.
Rekapitulationsentwicklungen scheinen auf den ersten Blick nicht sinnvoll. Sie sind zunächst nur historisch zu verstehende Teilabläufe. Man fragt sich wieso diese rekapitulierten Anlagen im Laufe der Evolution nicht abgebaut wurden. Dies liegt an bestimmten Restfunktionen die sie noch weiterhin erfüllen. Beispiel:
Augen und Ohrverschluss in der Embryonalentwicklung plazentaler Säugetiere.
Man schließt hierbei nicht auf taube und blinde adulte Stammarten, sondern nur auf vorrübergehende blinde und taube Nestjungen. Dieser Verschluss ist sinnvoll bei Nesthockern (Mäusen, Kanninchen), bei denen sich das noch nicht fertige Sinnesorgan in einem flüssigkeitsgefülltem, schützenden Milieu befindet und dort nachgeburtlich ausdifferenzieren kann. Dies wäre eigentlich als Caenogenese zu betrachten (Anpassung an frühe Geburt). Bei bestimmten Arten kommt es nun aber zu einem scheinbar ,,unsinnigen" festhalten an dieses Stadium (=Rekapitulation) Vorübergehender Verschluss von Augen und Ohren findet man bei Föten von Nestflüchtern wie Pferd oder Hase aber auch bei Traglingen wie z.B. den Mensch, wobei diese aber mit offenen Augen zur Welt kommen.
Beispiele:
- Zahnanlagen bei Bartenwalen (Vorübergehende Bildung von Zahnanlagen aus dem Unterkiefer eines Blauwalembryos) Abb.66 A-C
- Pottwalembryo mit 70cm Länge mit Rekapitulation der HinterextremitätenKnospe (Abb.66D)
- 3 Jugendstadien des Glattbutts. Ausgehend von einem symmetrischem Fisch in normaler Schwimmlage erfolgt die Wanderung des rechten Auges nach links (Abb.66E)
- Schwanz des Höckerschwan-Embryos mit seitlichen Reihen stehenden Schwanzfedernanlagen (Archaeopteryx-Schwanz)
Wie erklärt man sich nun aber das Auftreten von Rekapitulationen?
Bei der Erklärung von Rekapitulationen ergänzen sich evolutive und aktuelle Ansätze.
EVOLUTIVER ANSATZ:
Die bestehende Kontinuität zwischen der Generationsfolgen läßt einen völligen Abbau und Neubau von Strukturen nicht zu, sondern nur einen Anbau, Umbau, Stillegen oder eine teilweise Reduktion. Dies ist aber auch nur möglich, wenn die Funktionstüchtigkeit insgesamt nicht beeinträchtigt wird. Rekapitulationen stehen aber dennoch unter dem Einfluß des Selektionsdrucks
GENETISCHER ANSATZ:
Der genetische Ansatz liefert die Erklärung für den Schutz der bestehenden Programme vor dem Abbau. Die Tatsache, dass ein Gen auf ganz unabhängig erscheinende Merkmale Einfluss nehmen kann (Polyphänie) und ein Merkmal aber auch durch mehrere Gene (Polygenie) gesteuert sein kann, bedingen eine wechselseitige Stabilisierung (Abb. 68). Eine Abänderung scheint also kaum tolerierbar, da es unter Umständen ,,zu einem Einbruch des gesamten Gefüges" kommen könnte. Die erklärt warum bestimmte Merkmale auch scheinbar unnötig gebildet werden. Die Gene die zu ihrer eigenen Bildung notwendig sind gleichzeitig für die Bildung eines anderen Merkmals verantwortlich, auf das nicht verzichtet werden kann.
c) Vergleich zwischen Rekapitulation und Caenogenese
Rekapitulationen und Caenogenesen sind nicht immer einfach zu unterscheiden. Beide betreffen transitorische Strukturen und können deshalb leicht verwechselt werden. Sie bilden aber auch keine echten Gegensätze. Rekapitulation ist nur dann eindeutig als Rekapitulation zu bezeichnen wenn sie sich
I. Mit einer Zwischenstruktur einer anderen Art identifizieren läßt, bei der sie sich zu einer Endstruktur weiterentwickelt.
II. Mit einer dauerhaften Endstruktur einer anderen Art homologisierbar ist.
Beispiel: Gehörknöchelchen beim Mensch homologisierbar mit Zwischenstruktur des primären Kiefergelenks bei Nicht-Säugern Rekapitulationen nehmen also Bezug auf Merkmalsausbildungen und sind dadurch nur durch einen Vergleich mit anderen Organismen zu identifizieren.
Caenogenesen sind zwar auch transitorische Bildungen, gleichzeitig aber noch spezielle Anpassungen an ein ontogenese Stadium, die nur bei einer Art vorkommen und nirgendwo sonst als Adultstruktur auftreten.
d) Die Funktionale Bedeutung der Rekapitulation des Kiemendarmes
Die Embryonen aller Wirbeltiere legen in einem Entwicklungsstadium Kiemenbögen- und Spalten an. Diese sind aber nicht als Reste von Kiemenspalten- und Bögen eines ausgewachsenen Fisches zu betrachten, sondern als Strukturen, die bereits bei der Ahnenform dieses Embryos vorhanden gewesen sein müssen.
Als die Landwirbeltiere das Meer verließen wurden die Kiemen überflüssig, die embryonale Anlage der Kiemen blieb jedoch erhalten. Im Laufe der Zeit wurden sie modifiziert und es entstanden verschiedene Strukturen im Kopf- und Halsbereich .
Was rechtfertigt nun aber heute noch die Anlage des Kiemendarmes? Welche Verwendung hat der Kiemendarm heute?
- Der Kiemendarm ist Bildungsort wichtiger endokriner Drüsen bzw.
lymphatischer Organe (Gaumenmandeln, Thymus, Nebenschilddrüse,
Ultimobranchialkörper), deshalb werden weiterhin bei Säugern Kiementaschen angelegt.
- Das Material der zwischen den Kiementaschen angelegten Knorpelspangen findet Verwendung bei der Bildung von Kieferbogen (Meckelscher Körper), Knochen des primären Kiefergelenks (daraus wiederum Gehörknöchelchen) und Knorpeln des Kehlkopfes und der Luftröhre.
- Bildet Leitstrukturen für das Blutgefäßsystem
7. Welche Bedeutungen haben ontogenetische Untersuchungen für phylogenetische Aussagen?
a) Was spricht gegen die Rekapitulationsregel?
- Rekapitulationen sind lückenhaft und im Laufe der Zeit sind viele
Informationen verloren gegangen. Man darf aber nicht den Fehler machen aus dem Nicht-Vorhandensein einer Struktur zu schließen sie sei nie da gewesen (Bsp. beiVogelembryonen gibt es zahnlose Arten) Wäre es tatsächlich der Fall, dass ein Individuum in seiner Ontogenese alles Stadien durchläuft, so wäre man in der Lage daraus seine Geschichte unmittelbar abzulesen. Dies ist aber nicht so.
- Ein weitere Nachteil der Rekonstruktion der Stammesgeschichte aus der
Ontogenes ist die Schwierigkeit ein Merkmal als Caenogenese oder Rekapitulation auszuweisen. Ontogenetische Untersuchungen allein liefern keine stichhaltigen Aussagen über die Phylogenese. Nur vergleichende Methoden und die Untersuchung mehrerer Arten kann Aufschluß über die Phylogenese geben.
- Rekapitulationen betreffen nicht vollständige Ahnenformen, sondern nur einzelne Organe oder Strukturen (z.B. Säugetiere durchlaufen in Embryogenese nicht einen Fisch sondern sondern nur ganz bestimmte embryonale Zustände, die mit denen anderer Wirbeltiere vergleichbar sind).
Es werden also nicht ausgebildete und funktionstüchtige Strukturen wiederholt sondern nur die embryonalen Zwischenstrukturen der Ahnenformen (Rekapitulation Kiemendarm d.h. keine volle Ausbildung von Kiemenspalten und Blättchen sondern nur Anlage in Form von Kiementaschen und Kiemenfruchen)
- Die zeitliche Abfolge verschiedener Merkmale läßt nicht unbedingt auf die entsprechende historische Rheinfolge schließen. Es ist zwar allgemein schon der Fall, dass allgemeineres Bauplanmerkmale vor spezielleren gebildet werden, ist es einem Organismus aber zum Vorteil , ändert er im Laufe der Zeit die zeitliche Abfolge der Merkmalsausbildungen (=Heterochronie). (z.B. Pluteus-Larve : Vor der Bildung des Urdarms schon ein Mesodermschub, da daraus entstehende Mesenchymzellen für Skelettbildung benötigt werden; Vogelentwicklung : Frühe Wölbung der Mittelhirns, als verarbeitendes Zentrum der Seheindrücke d.h. dominierendes Sinnesorgan der Augentwicklung, falsch wäre hier die Schlußfolgerung auf ein ursprüngliches dreiteiliges Mittelhirn; Froschkaulquappe bildet zuerst Hinterbeine dann Vorderbeine; Tetrapoden : Bildung der Zunge vor der Bildung der Zähne. Bei Wirbeltieren umgekehrt)
b) Was spricht für die Rekapitulationsregel und macht die Ontogenese zu einer Quelle für die phylogenetische Forschung?
- Die Ontogenetische Forschung führt zu einer wichtigen Erweiterung der Merkmalsbasis als Grundlage für die phylogenetische Forschung. Sie unterliegt ebenfalls einem evolutivem Wandel und beinhaltet somit
Informationen die es durch Vergleiche zu entdecken und für die Erforschung der Stammesgeschichte nutzbar zu machen gilt (z.B. Auftreten von transitorischen Merkmalen oder Larvalstadien für die systematische
Zuordnung eines Taxons hilfreich) (Bsp.: Entdeckung der Chorda bei Larven der Ascidien ermöglicht Zuordnung zu den Tunicaten; zuvor zu den Mollusken gezählt)
- Durch Ontogenese können sich Hinweise auf eine Homologisierung von
Strukturen ergeben. (Entwicklung der Vogelfeder entspricht in der Aufwölbung der Epidermis zunächst der Anlage einer Reptilienschuppe; Homologisierung der Hypobranchialrinne des Kiemendarmes von Branchiostoma mit der Schilddrüse der Gnathosthomata; Kiefergelenksknochen Articulare und Quadratum mit Gehörknöchelchen Hammer/Amboß)
- Die Ontogenese kann wichtige Hinweise auf die morphologische Herkunft und ursprüngliche Lage eines Organs geben. (Lunge und Leber der Wirbeltiere als Abgliederungen vom Darm; Schilddrüse und Thymus Bildungen des Kiemendarms; auch Aufschlussüber Weg wie bestimmte Organe und Strukturen gebildet werden Bsp. Cölom Abschnürung aus Darmdivertikeln oder Auseinanderweichen mesodremalen Gewebes)
- Rekapitulationsentwicklungen geben Hinweise auf den sekundären Verlust von Endstrukturen durch Umbau oder Abbau. Vorraussetzung ist die Homologisierung der entsprechenden Bildung mit der Zwischenstruktur einer bekannten Endstruktur. ( Floh-Arten besitzen zum Teil noch Fortsätze währen der Puppe, die sich mit Anlagen von Vorderflügeln homologisieren lassen. Indiz, dass Siphonaptera ihre Flügel sekundär verloren haben. Manche Schwimmenten zeigen Verhaltensweisen, die mit Balzbewegungen anderer Arten homologisierbar sind nur in der Jugend; d.h. fehlen den Erwachsenen sekundär)
8. Gibt es eine ontogenetische Methode zur Rekonstruktion der Phylogenie?
Im Vorhergegangenen wurde gezeigt, dass es nicht möglich ist aus der Ontogenese einer Art nicht deren gesamt Stammesgeschichte abzulesen ist. Um brauchbare Ergebnisse zu erzielen ist es notwendig zwischen den Arten zu vergleichen und Homologien festzustellen (bzgl. Furchungsmuster, Larvalmerkmale, Zwischenstrukturen, Sonderstrukturen, transitorische und bleibende Strukturen). Nur so ist es möglich transitorische Bildungen als Rekapitulationen ehemaliger Endstrukturen zu erkennen.
D.h. die Ontogenese gibt also Aufschluss über eine nicht mehr vorhandene Ahnenstruktur einer Ahnenart. Oft tendiert man zu der Aussage, dass über Rekapitulationen keine neuen Erkenntnisse mehr gewonnen werden können. Dies ist aber nicht der Fall. Im Gegenteil, viele Aussagen wurden erst durch rekapitulierte Strukturen möglich.
,,Die ontogenetische Methode besteht in der Suche nach Merkmalen der Grundmuster eines Taxons. Die Interpretation der Befunde hängt von der Möglichkeit zur Homologisierung ab. Damit ist die Methode nicht eigenständig, sondern Teil der phylogenetischen Arbeitsweise" (S.163)
Literatur:
Sudhaus, W. / Rehfeld, K. (1992): Einführung in die Phylogenetik und Systematik. Stuttgart: Fischer Verlag.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Textes?
Das Thema des Textes ist die biogenetische Grundregel und die Frage, ob Organismen in der Ontogenie die Phylogenie rekapitulieren.
Wer waren einige der wichtigsten Figuren in der Geschichte des Verständnisses von phylogenetischer und ontogenetischer Entwicklung?
Zu den Schlüsselfiguren gehören Aristoteles, Karl Ernst von Baer, Matthias Schleiden, Theodor Schwann, Charles Darwin und Ernst Haeckel.
Was ist die Zelltheorie und welchen Einfluss hatte sie auf das Verständnis der Entwicklung?
Die Zelltheorie besagt, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen und sich durch Zellteilungen entwickeln. Dies widerlegte das Prinzip der Präformation und bestätigte die Epigenese.
Was ist die biogenetische Grundregel nach Ernst Haeckel?
Die biogenetische Grundregel besagt: "Die Ontogenese ist die kurze und schnelle Rekapitulation der Phylogenese, bedingt durch die physiologischen Funktionen der Vererbung und Anpassung."
Können Sie einige Begriffserklärungen aus dem Text nennen?
Zu den Begriffserklärungen gehören: Transitorische Bildungen, Anlagen, Zwischenstrukturen, Endstruktur, Sonderstruktur, Caenogenesen, Rekapitulationen, Organogenese, Heterochronie, Homolog und Analog.
Was ist der Unterschied zwischen Ontogenie und Phylogenie?
Ontogenie ist die Entwicklungsgeschichte des Individuums, während Phylogenie die Entwicklungsgeschichte der Art ist.
Wie verläuft die Ontogenese bei Wirbeltieren und welche Stadien gibt es?
Die Ontogenese der Wirbeltiere umfasst Stadien wie Befruchtung, Furchungsteilungen, Gastrulation, Neurulation, Organogenese und Metamorphose.
Wie hat sich die Ontogenese im Laufe der Evolution verändert?
Die Evolution kann in jedem Stadium der Ontogenese einsetzen, sowohl in ontogenetischen Zwischenstadien als auch in Adultstadien. Es gibt Abwandlungen oder Reduktionen der Endstruktur, Verschiebungen von Strukturen zwischen Ontogenesestadien und Adultation und Fötilisation.
Was sind Caenogenesen und Rekapitulationen?
Caenogenesen sind Bildungen transitorischer Endstrukturen oder Sonderstrukturen, die spezielle Anpassungen eines Ontogenesestadiums darstellen. Rekapitulationen sind das transitorische Auftreten von Zwischenstrukturen ehemaliger Endstrukturen sowie die vorübergehende Bildung ehemals dauerhafter Endstrukturen.
Was spricht gegen die Rekapitulationsregel?
Rekapitulationen sind lückenhaft, und viele Informationen sind im Laufe der Zeit verloren gegangen. Es ist auch schwierig, ein Merkmal als Caenogenese oder Rekapitulation auszuweisen. Ontogenetische Untersuchungen allein liefern keine stichhaltigen Aussagen über die Phylogenese.
Was spricht für die Rekapitulationsregel?
Die ontogenetische Forschung führt zu einer wichtigen Erweiterung der Merkmalsbasis als Grundlage für die phylogenetische Forschung. Sie unterliegt ebenfalls einem evolutiven Wandel und beinhaltet somit Informationen, die es durch Vergleiche zu entdecken und für die Erforschung der Stammesgeschichte nutzbar zu machen gilt.
Gibt es eine ontogenetische Methode zur Rekonstruktion der Phylogenie?
Es ist nicht möglich, aus der Ontogenese einer Art deren gesamte Stammesgeschichte abzulesen. Um brauchbare Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, zwischen den Arten zu vergleichen und Homologien festzustellen.
- Quote paper
- Stephanie Kanzok (Author), 2000, Die Biogenetische Grundregel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97216