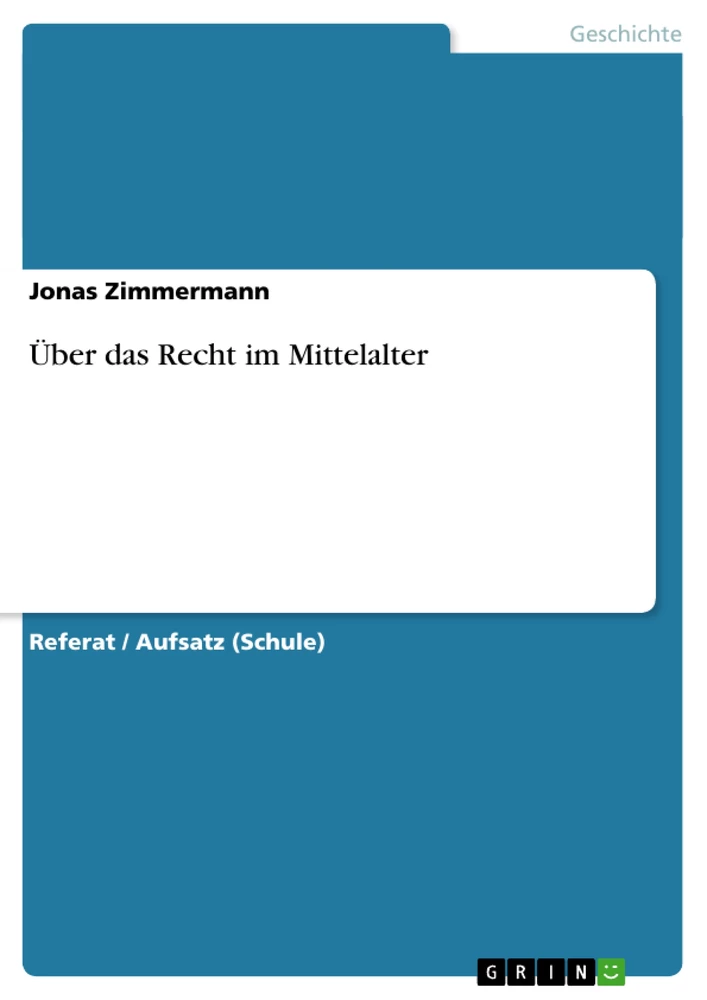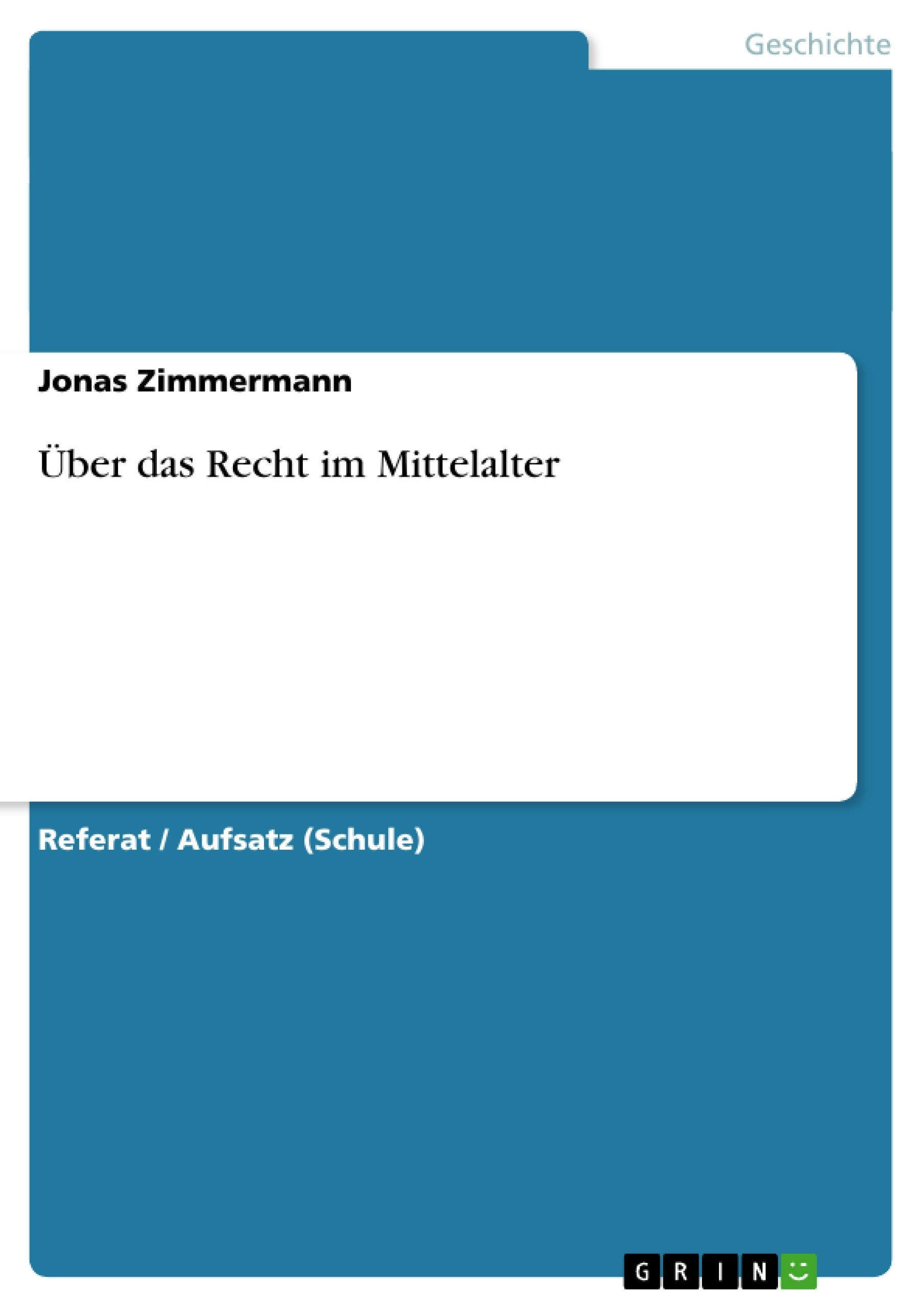Gliederung:
1. Rechtsentwicklung
1) germanische und frühe fränkische Zeit (bis 500)
- ‚Ureinwohner’, die Germanen haben mündlich überliefertes Recht
- erste Aufzeichnungen im 6. Jh. (z.B. Lex Salica), teilweise beeinflußt durch röm. Recht
- Recht ordnet Zusammenleben
- Recht ist fester Bestandteil der Gesellschaft (weder durch Gott noch durch Menschen gemacht)
- Einteilung in Sippe und ‚Familie’ (im lat. Sinne) à Ausübung der Rechtspflichten
- keine Staaten im heutigen Sinne, nur ‚Hundertschaften’, die in Dings zusammenkamen
2) fränkische Zeit (500 - 900)
- durch Reichsgründung Machtverlagerung vom Landvolk zu den Adeligen
- Grafschaften Bereitstellung von Truppen, Polizeigewalt, richterlichte Gewalt
- Entstehung des Lehnswesens à komplexe Ordnung
- wichtige Quellen u.a. Lex frisiorum, Urkunden (z.B. Schenkungsurkunde v. Halle an Bischof v. Magdeburg, 961)
3) Hochmittelalter (11. Jh. - ca. 1300)
- verschiedene Rechtskreise: z.B. Lehns-, Land-, Straf-, Stadt-, Kirchenrecht
- dauernde Veränderung in Zuständigkeiten, je nach Stärke der betroffenen Bevölkerungsgruppe
- Zerfall des geeinten Reichs in mächtige Kleingebiete
- Königswahl streng ritualisiert à Legitimation durch Wahl durch 7 Kurfürst en, ‚Belagerung und Einnahme’ von Aachen
- è Stellung des Königs eher repräsentativ, da keine wirklichen direkten Einkommen, sondern nur über Lehen
- Zerfall der Grafengerichte zu kleinen Landgerichten, auch mit Blutgerichtsbarkeit
- Landeserweiterung à Rechtstransfer nach Osten
- Geldwirtschaft und Handel erwarten genaue gesetzl. Regelungen
- wichtige Quellen: 1103 Mainzer Landfrieden (erstes Strafgesetzbuch d. Mittelalters, Sachsenspiegel, Stadtrecht (Magdeburger Stadtr.), Weistümer (dörfl. Recht)
4) Spätmittelalter (14./15. Jh.)
- Kaiser Gesetzgeber, aber Gesetze in Abstimmung mit Kurfürsten
- Femegerichte (Straf-) wichtig, aus Grafengerichten zu kaisertreuen - Kirchengerichte, Zuständigkeit der Erzbischof oder Erzpriester - Kooperation weltl.-geistl. Gerichte
- Landesherr erwirbt städt. Rechte vom Kaiser (Stadtgründung, Gerichtsbarkeit etc.); Auseinandersetzung mit Stadtbürgern
- wichtige Quellen z.B. Goldene Bulle von 1356, Reichslandfrieden, erweiterter Sachsenspiegel (dann Schwabenspiegel; gültig in Anhalt und Thüringen bis über 1900), in Städten Stadtrechtsbücher (Magdeburger Recht), Dorfweistümer (von Jakob Grimm gesammelt)
2. Der Sachsenspiegel
1) Die Schrift
- etwa 1230 lat. Urform, bis 1231 auch zwei deutsche Übersetzungen (vom Verfasser)
- enthält Lehns- und Landrecht
- viele Erweiterungen und Ergänzungen
- vergleichsweise unsystematisch, teilw. chaotisch
- geplant als private Niederschrift, dann aber schnelle Verbreitung und praktisches Gesetzbuch
- Eike sieht Recht als gottgegeben, abgeleitet von Karl dem Großen
- vier erhaltengebliebene Bilderhandschriften, Heidelberger die älteste von ca. 1375
3. Das Strafrecht
- Folter zur Erforschung der Wahrheit - Bestrafung bei
a) Tötung
b) Körperverletzung
c) Diebstahl
d) Ketzerei, Gotteslästerung
e) Brandstiftung
f) Betrug
g) geschlechtliche Vergehen
- Strafarten
a) Acht (Entzug aller Rechte und des Eigentums)
b) Bußen (Totschlagbuße)
c) „Strafen an Haut und Haar“ (Tötung, Verbannung,
Verstümmelung)
d) Freiheitsstrafen (meist nur kurzzeitig)
e) Ehrenstrafen (Pranger, Kopfhaarentfernung)
f) Kirchenstrafen
Quellen
- Eike von Repgow, „Der Sachsenspiegel“, kommentiert und übersetzt von Walter Koschorreck
- „Recht im Alltag der mittelalterlichen Bevölkerung“, hrsg. vom LISA Halle
- „Die Goldene Bulle“, Kaiser Karl IV
- Diether Krywalski, „Die Welt des Mittelalters
- „Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Halle“, anon., 1788
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist ein umfassender Sprachüberblick, der den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Leitthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt die Rechtsentwicklung, den Sachsenspiegel und das Strafrecht im Mittelalter.
Was sind die wichtigsten Punkte der Rechtsentwicklung?
Die Rechtsentwicklung wird in vier Phasen unterteilt: germanische und frühe fränkische Zeit (bis 500), fränkische Zeit (500 - 900), Hochmittelalter (11. Jh. - ca. 1300) und Spätmittelalter (14./15. Jh.). Wichtige Aspekte sind die mündliche Überlieferung des Rechts, der Einfluss des römischen Rechts, die Rolle von Sippen und Familien, die Entstehung des Lehnswesens, die Bildung von Grafschaften und die Entwicklung verschiedener Rechtskreise (Lehns-, Land-, Straf-, Stadt-, Kirchenrecht).
Was ist der Sachsenspiegel?
Der Sachsenspiegel ist eine Rechtssammlung, die um 1230 von Eike von Repgow verfasst wurde. Er enthält Lehns- und Landrecht und diente als praktisches Gesetzbuch. Es existieren mehrere Bilderhandschriften, wobei die Heidelberger die älteste ist (ca. 1375).
Was sind die Schwerpunkte des Strafrechts im Sachsenspiegel?
Das Strafrecht umfasste die Folter zur Wahrheitsfindung und Bestrafung von Tötung, Körperverletzung, Diebstahl, Ketzerei, Gotteslästerung, Brandstiftung, Betrug und geschlechtlichen Vergehen. Strafarten waren Acht, Bußen, Strafen an Haut und Haar (Tötung, Verbannung, Verstümmelung), Freiheitsstrafen, Ehrenstrafen und Kirchenstrafen.
Welche Quellen werden im Dokument genannt?
Zu den genannten Quellen gehören: Eike von Repgow, „Der Sachsenspiegel“, „Recht im Alltag der mittelalterlichen Bevölkerung“, „Die Goldene Bulle“, Diether Krywalski, „Die Welt des Mittelalters“, „Historisch-topographische Beschreibung der Stadt Halle“, und Heinrich Fichtenau, „Lebensordnungen des 10. Jhs.
- Arbeit zitieren
- Jonas Zimmermann (Autor:in), 2000, Über das Recht im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/97292